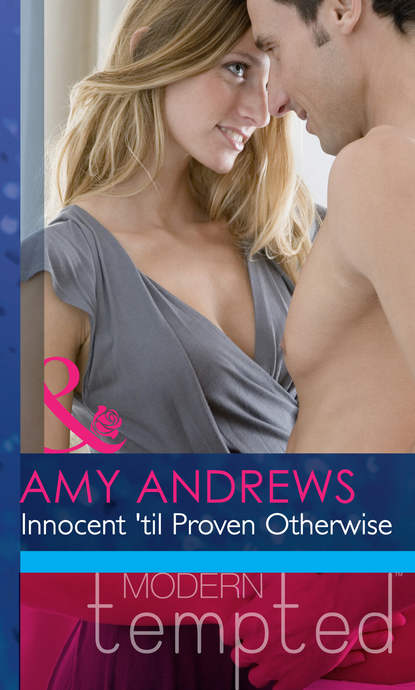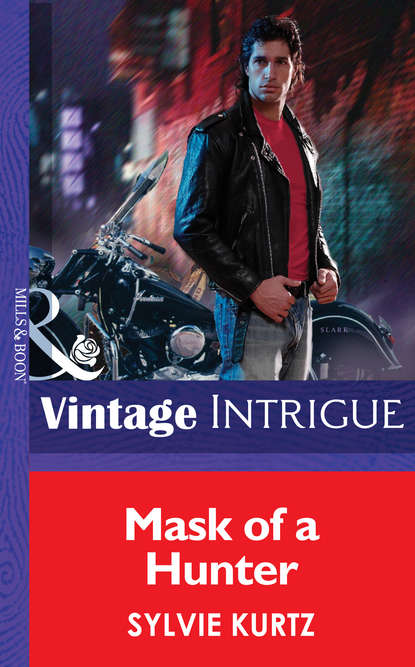Morgensonnenschein

- -
- 100%
- +
Dora holte mich aus meinen düsteren Gedanken, als sie über meine gedrückte Miene zu lachen anfing. „Wie schaffst du es nur, schon morgens so schlechte Laune zu haben?“
„Und wie schaffst du es nur immer, so nervig zu sein?“, erwiderte ich mürrisch, hellte meine Miene dann aber doch etwas auf, was meine Schwester mit einem triumphierenden Blick zur Kenntnis nahm, während sie mir gegenüber am Tisch Platz nahm.
Meine Mutter weckte Leo auf und zusammen aßen wir unser Frühstück. Danach zogen meine Schwester und ich unsere grauen Schuluniformen an, wuschen uns und standen schließlich startbereit vor der Tür, wo uns unsere Mutter eine Glasflasche überreichte, die ich in meine selbstgenähte kleine Tasche steckte, die auch einen Block und ein paar Stifte enthielt. Wir verabschiedeten uns und traten durch die Tür in den Morgen. In der kleinen Gasse, an der unsere Wohnung lag, war bereits reger Betrieb. Um der Enge zu entkommen rannten wir bis zum Ende der Straße, die in einen großen erhöhten Platz mündete. Die Sonne stand noch nicht hoch genug, um die Häuser in unserem Rücken zu überwinden und die unter uns liegenden Gebäude zu bescheinen. Wir standen an der verfallenen Mauer, die den Platz vom darauf folgenden Hang abgrenzte und blickten über die vielen rauchenden Schornsteine, die sich in der Ferne in ihrem eigenen Qualm verloren. Wie ich schon früher festgestellt hatte, war der Anblick Limestones am Morgen nicht mal halb so schön wie der von Ardesia, aber trotzdem hatte er etwas anziehendes. Ich sog die kühle Luft ein, die schon am Morgen eine schwache Rauchnote hatte und gab schließlich dem Ziehen meiner Schwester an meinem Arm nach. Wir folgten weiteren Gassen, bis wir pünktlich zum Siebenuhrfünfundzwanziggong das rostige Schultor passierten, hinter dem wir über den von Unkraut überwucherten Hof zum Schulgebäude gingen, einem alten grauen Betonklotz, der weiterer Erwähnungen nicht würdig war. Mein Stundenplan sah heute mittelmäßig aus, zuerst Stonisch, dann Mathe, Doppelstunde Murla, Geschichte und Kunst. In Mathe war ich ganz gut und auch an Stonisch hatte ich nichts auszusetzten, Geschichte war allerdings das schlimmste, was man mir antun konnte, eine dreiviertel Stunde lang Erzählungen darüber, wie hervorragend die Preisrichter waren und was sie alles für uns getan hatten. Heute sollte es besonders schlimm werden, denn der Besuch eines Preisrichters war angekündigt worden. Ich hatte meine Mutter angefleht mich krankzumelden, doch diese hatte erwidert, es wäre gar nicht schlecht, dem Feind einmal von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und diesen mit Fragen zu löchern und hatte sich dann lachend wieder ihrer Näharbeit zugewandt. Wirklich hilfreich! Gerade hatten wir den Eingang erreicht und meine Schwester, die vier Klassen unter mir, also in der sechsten Klasse, war, verabschiedete sich von mir, um danach in Richtung ihres Klassenzimmers zu verschwinden. Ich selbst bog in einen Gang und folgte einer schnatternden Menge Fünftklässler zu meiner ersten Unterrichtsstunde.
Der Vormittag verging wie im Flug und schon saß ich in meinem Geschichtsklassenzimmer. Wie in allen Fächern hatte ich auch in diesem miefigen, kleinen und dreckigen Raum den hintersten Platz belegt, den Blick auf die Uhr über der Tür gewandt. Ruckartig und ohne Vorwarnung öffnete sich diese, als mein Geschichtslehrer, ein alter grauhaariger und ausgemergelter Mensch, und ein weiterer Mann das Zimmer betraten. Die ganze Klasse erhob sich und unser Lehrer zeigte mit einem Wink, nachdem er seine abgenutzte Ledertasche auf das hölzerne Pult geknallt hatte, dass wir uns setzen könnten. Er nahm ebenfalls Platz und der andere Mann, der wahrscheinlich der Preisrichter war, trat mit einem Räuspern in das spärliche Licht einer Glühbirne und begann seinen Vortrag. Ich hörte nur mit halbem Ohr zu. Er begann mit der Legende zur Entstehung von Stones, jeder kannte sie. Vor ein paar hundert Jahren war Stones eine Wüste gewesen, doch durch einen sintflutartigen Regen war das Land grün geworden und schließlich hatten es auch einige Menschen für sich entdeckt, genauer der Stamm der Sontes. Die Mitglieder des Stammes waren alle unterschiedlich begabt gewesen, so erzählte es die Legende. Die einen waren gut darin niedere Arbeiten zu verrichten, die anderen glänzten wiederum in Führungsrollen. Der letzte bekannte Stammesführer war Marpel gewesen, ein weiser Mann, dem, wie jedem Anführer, ein Rat aus weiteren Männern gleicher Gesinnung unterstellt gewesen war und mit gleicher Gesinnung meinte ich vor allem gleichen Talents oder besser gesagt gleicher Wertigkeit. Über Marpel stand nur ein anderer Mensch, einer, der den Wert eines Menschen sehen konnte, der damalige Preisrichter, der in der Überlieferung nicht namentlich genannt wurde. Um noch einmal zu Marpel zu kommen oder vielmehr zu dem Grund, warum er der letzte Anführer war, musste man wissen, dass zu dessen Herrschaftszeit die Ernten reich waren und deshalb die Bevölkerung schon bald explodierte. Menschen unterschiedlicher Schichten lebten auf engsten Raum zusammen und schon bald kam es zu Unruhen vor allem unter den Leuten niederer Schichten, was wohl daran lag, dass die erntereichen Jahre vorbeigewesen waren. So hatte Marpel die geniale Idee gehabt das Gebiet zwischen den einzelnen Schichten zu teilen und den Tapfersten aus jeder Schicht zum Leiter des Neuanfangs zu ernennen. Eines Nachts trafen sich die Auserwählten, um die Gebiete aufzuteilen. Marpel hatte das Land in die Erde gemalt und überreichte jedem einen Stein, den er auf das Gebiet legen sollte, auf welches er Anspruch erhob. Er selbst hatte seinen Stein, einen Marmor, schon auf das Gebiet an der Küste gelegt, das heutige Marpel, da er das Meer und die sanfte Hügellandschaft der Küste liebte und die anderen folgten seinem Beispiel. Sein Bruder legte einen Kieselstein direkt neben den Marmor in das Gebiet, welches nun Pebble hieß, der Vertreter der 3. Schicht legte ein Stück Schiefer auf ein Gebiet südöstlich des Meeres, Ardesia, ein Mann aus der 4. Schicht warf seinen Kalkstein mit geschlossenen Augen und er landete neben Ardesia, dem heutigen Limestone. Der Mann aus der 5. Schicht, ein bescheidener Mensch, nahm ein Stück Kohle aus dem Feuer und legte es auf den einzigen noch freien Platz, fernab vom Glanz Marpels, um so den Standpunkt von Coalman zu begründen. Dies war also der Beginn des ganzen Unglücks, denn darauf folgten mehrere Aufstände gegen das System, die blutig niedergeschlagen worden waren. Da diese nicht in das Bild der Preisrichter passten, war es auch nicht verwunderlich, dass sie bei der Erzählung des Preisrichters unerwähnt blieben. Dieser knüpfte nahtlos das Heutige an die Legende von damals an, ohne die enorme Zeitspanne dazwischen zu beachten. „Das heutige Stones lässt sich von Historikern schon aus dieser frühen Legende herauslesen. Der Preisrichter stand weiter über den einzelnen Vierteln und über Marpel, die Anführer, die damals ihr Gebiet wählten, sind die heutigen Gouverneure von Stones. So fügt sich das eine in das andere. Die Preise drücken noch heute eure, unsere Bestimmung aus.“
Weiter nannte er viele Vorzüge des Systems und erklärte, dass es unsere Aufgabe war dieses wichtige System zu schützen, dass die Genialität dieser Gesellschaftsordnung jeden Tag aufs Neue bewiesen werden musste, um revolutionäre Kräfte im Keim zu ersticken und dass wir unseren Teil dazu beitragen sollten, indem wir treu und folgsam waren und uns diesem fügten. Ungläubig hob ich den Blick, den ich seit mehreren Minuten auf die Bleistiftzeichnungen auf meinem Tisch gerichtet hatte, da ich einfach nicht glauben konnte, dass irgendjemand nur ansatzweise unterstützen konnte, was dieser Mann da vorne predigte. Prüfend schaute ich einigen meiner Klassenkameraden ins Gesicht und wurde nur so von Enttäuschung durchflutet, als ich deren leere Blicke untersuchte. Anscheinend interessierte sich keiner dafür, was von uns verlangt wurde und was wir haben könnten, ihre von Arbeit abgestumpften Sinne nahmen nicht mehr die Ungerechtigkeit war, die in den Worten des Preisrichters mitklang. Die Enttäuschung machte der Wut Platz und brodelnd suchte ich die Quelle der Lügen, die in gesprochene Worte umgewandelt wurden, und machte den Preisrichter auf einem Holzstuhl vor der Tafel aus. Als mein lodernder Blick auf seine fast schwarzen Augen traf, durchfuhr mich ein Schreck, der mir ein leises Keuchen entlockte. Das konnte nicht sein, das durfte nicht sein! Wie konnte er es wagen, seine Leute so zu verraten! Der Schreck verwandelte sich abermals in Wut, in eine Wut, von der mir der Kopf pochte und die mich erzittern ließ. Der Hass war so groß auf diesen Preisrichter, der seine eigene Schicht und damit meine, nämlich die vierte Schicht verriet, dass ich nur am Rande wahrnahm, wie dem Preisrichter kurz seine Gesichtszüge entglitten, bevor er in sachlichem Ton fortfuhr. Zum Ende der Stunde hatte ich mich so weit unter Kontrolle, dass mir das Ausmaß meines Handelns erst so richtig bewusst wurde. Bittere Galle stieg in mir hoch und als schließlich das schrille Geräusch der Schulglocke ertönte, war ich nicht mehr zu halten. Ohne einen weiteren Blick zurück ließ ich das Schulhaus hinter mir und ging zu dem einzigen Ort, an dem ich jetzt noch sicher war.
Kapitel 8
Früher hatten meine Schwester und ich, als wir noch nicht in der Schule waren, immer in der Nähe der Fabrik gespielt, in der meine Mutter tagsüber arbeitete. Dort hatten wir uns in einer Ecke eine Höhle gebaut, in der wir uns bei Regen aufhielten. Diese war auch nicht weit entfernt von der Schule und so war ich nach wenigen Minuten dort und setzte mich noch rechtzeitig in den kleinen Raum aus Holz und Wellpappe, bevor mich die Tränen übermannten. Wie konnte ich nur so dumm sein, wie konnte ich nur! Ich hatte, ohne es zu bemerken nicht nur mein Leben, sondern auch das meiner Familie aufs Spiel gesetzt. Warum hatte ich die Beherrschung verloren, warum nur? Hätte ich nicht darauf vorbereitet sein können, dass es auch Preisrichter aus niederen Schichten gab? Nun war alles aus, unser Glück zerstört. Ich gab mir vielleicht noch einen Tag, dann würden mich die Preisrichter holen, um mich zu einer von ihnen zu machen. Schließlich war es für den Preisrichter ein leichtes gewesen, meine Überraschung und anschließende Wut darauf zurückzuführen, dass ich des Zahlensehens mächtig war. So saß ich nun da, auf der festgetretenen Erde, zusammengekauert und tränenüberströmt. Ich hatte jedes Gefühl für Zeit verloren, bald verdunkelte sich der Himmel, dann begann es zu regnen. Dicke Tropfen drangen durch das löchrige Dach, fielen auf meine leichten Klamotten, die alsbald durchnässt waren und ließen mich frösteln und schließlich beschloss ich, dass es keinen Zweck hatte, es weiter hinauszuschieben. Ich musste meiner Mutter die Wahrheit erzählen, bevor es die Preisrichter tun würden. Ich stand auf, streckte meine steifen Glieder und machte mich durch den Regen auf den Weg nach Hause, eine dunkle Gestalt auf grauem Hintergrund.
Glücklicherweise war es noch nicht allzu spät, als ich mich unserem Haus näherte, vielleicht drei oder vier Uhr. Der Glockenturm war schon vor langer Zeit baufällig gewesen und so war es kein Wunder, das auch die darin eingebaute Uhr kurz darauf ihren letzten Schlag getan hatte, was aber nicht weiter schlimm war, da sich die meisten Leute eh mehr auf die Sonne, als auf ein von den Preisrichtern kontrolliertes Messgerät verließen. Zu Hause angekommen, befreite ich mich im engen Flur zuerst von den nassen, schlammigen Schuhen und der dünnen Jacke, bevor ich unsere Wohnung betrat. Wie erwartet war meine Mutter noch nicht zu Hause und nur meine Schwester saß an dem kleinen Holztisch in der Küche, ihre Schulsachen vor sich ausgebreitet; wir nutzten eben jede Minute aus, in der wir einmal Strom hatten. Als sie mich bemerkte, hob sie den Kopf und ich sah in ihren Augen Erleichterung. Sofort bekam ich ein schlechtes Gewissen. Keine einzige Minute hatte ich daran gedacht, dass meine Schwester sich sicherlich Sorgen machen würde, wenn ich zum Schulende nicht am Schultor erscheinen würde, um mit ihr nach Hause zu laufen. Tausende Entschuldigungen rasten mir durch den Kopf. Ich hatte nacharbeiten müssen, ich war noch einkaufen gegangen… Doch keine dieser Ausreden schien der Wahrheit gerecht zu werden. Ich hatte mir vorgenommen mein Geheimnis zu offenbaren, mich der Wahrheit zu stellen. Warum sollte ich also nicht jetzt anfangen? Erschöpft setzte ich mich auf den Stuhl ihr gegenüber und begann mit matter Stimme zu sprechen. „Hi, wie war dein Tag?“
Sie hob abermals den Kopf, dieses Mal ein spöttisches Funkeln in den Augen. „Gut. Und wie war der Vortrag des Preisrichters? War er so schlecht, dass du danach gleich fliehen musstest?“, fügte sie sarkastisch hinzu.
Ich bewunderte meine Schwester immer wieder dafür, wie sie immer sofort ins Schwarze traf und ärgerte mich gleichzeitig darüber, dass ich nicht bedacht hatte, dass meine plötzliche Flucht in Verbindung mit der vorausgegangenen Rede des Preisrichters eine explosive Tratschmischung abgab, die dazu führte, dass die ganze Schule binnen weniger Minuten über meinen Abgang Bescheid wusste und dass meine Schwester zur ganzen Schule zählte.
„Nicht direkt“, beantwortete ich wage ihre letzte Frage, dann holte ich tief Luft. „Ich habe heute etwas sehr Dummes gemacht…“
„Das sehe ich auch so“, sagte eine Stimme hinter mir.
Erstaunt fuhr ich herum und sah meine Mutter im Türrahmen stehen, auf dem Gesicht eine Mischung aus Sorge und Wut. Meine Mutter war bei einer ihrer Kundinnen gewesen, als deren Tochter von der Schule nach Hause gekommen war und erzählt hatte, dass ich die letzte Stunde Kunst geschwänzt hatte. Für die Lehrer an unserer Schule war es normal, dass der ein oder andere gelegentlich Schulstunden schwänzte, doch meine Mutter war bei dieser Information hellhörig geworden, da es normalerweise so gar nicht meine Art war, einer Stunde fernzubleiben. Also hatte sie auf dem Nachhauseweg einen Abstecher zur Schule gemacht, um dann dort zu erfahren, dass wir in den nächsten Tagen mit Besuch zu rechnen hatten. Meine Mutter hatte eins und eins zusammengezählt und stand nun mit einem heißen Tee in der Hand an die Küchenzeile gelehnt da und erwartete von mir eine Erklärung. Aber wie sollte man bei so einer Sache anfangen? Schließlich beschloss ich der Vollständigkeit zuliebe mit dem Tag anzufangen, an dem ich meine Gabe entdeckt hatte. Ich war gerade einmal fünf gewesen, als ich zum ersten Mal einen Preis gesehen hatte. Damals waren wir ganz frisch in diese Wohnung eingezogen, die Wände waren noch weiß und ich die einzige Tochter meiner Mutter gewesen, da meine Schwester erst ein Jahr später dazugekommen war. So hatten wir also auch noch mehr Geld gehabt und meine Mutter hatte mir eines Tages am Markt ein kleines Amulett gekauft. Wenn man dieses öffnete, hatte man einen kleinen von grünen Ranken umgebenen in das Metall eingelassenen Spiegel gesehen, der gerade wegen seiner Größe ideal für mich gewesen war. Ganz aufgeregt hatte ich mich zu Hause auf einen Stuhl gesetzt und meinen Blick auf den Spiegel gerichtet. Ich hatte mein Spiegelbild betrachtet, die schmalen Lippen, die rosigen Wangen, die großen erwartungsvollen Augen mit den langen Wimpern. Als ich zu meiner Stirn gekommen war, hatte ich dann aber etwas gesehen, was dorthin eigentlich nicht gehörte, nämlich eine grünflammende Zahl, die Zahl 222. Damals hatte ich mich sehr erschrocken und fortan Spiegel gemieden, doch als ich in die Schule gekommen war, hatte ich die Preisrichter durchgenommen, meine mit ihren Fähigkeiten verglichen und war zu dem Schluss gekommen, dass ich wohl selbst eine Preisrichterin war. Glücklicherweise war ich damals schon klug genug gewesen, mein Geheimnis für mich zu behalten und hatte stattdessen begonnen, mehr über meine Begabung zu erfahren. Ich fand heraus, dass die meisten Preisrichter zuerst ihren eigenen Preis sahen und dass sie sich selber als Preisrichter melden mussten und nicht anhand ihres Preises als ein solcher erkannt werden konnten und versuchte, dieselben flammenden Zahlen im Stirnbereich anderer Menschen zu sehen, was nach viel Übung auch mit ersten Erfolgen gekrönt wurde.
Meine Mutter und meine Schwester lauschten stumm meinem Bericht und für lange Zeit war meine Stimme das einzige, was im Raum zu hören war. Als ich geendet hatte, trat eine undurchdringliche Stille ein und mein Magen zog sich vor Aufregung über die Reaktionen meiner Familie zusammen. Nach einer halben Ewigkeit regte sich meine Mutter schließlich. Sie richtete ihren Blick auf einen Punkt irgendwo hinter mir und sagte mit ausdrucksloser Stimme: „Jemand muss Leo von den Nachbarn holen.“
Ohne auf eine Reaktion von Dora zu warten, verließ ich den Raum. Draußen angekommen lehnte ich meinen Kopf an die dreckige Wand des Ganges. Ich war auf alles gefasst gewesen, Wut, Geschrei, nur nicht auf dieses stumme Entsetzen, diesen leeren Blick in den Augen meiner Mutter, der mir ein schwarzes Loch in den Bauch riss. Mein Kopf schwirrte, schwarze Pünktchen tanzten vor meinen Augen und ich sackte restlos zusammen. Nur einmal zuvor hatte ich diesen Ausdruck auf ihrem Gesicht gesehen, damals, als sie mir von meinem Vater und meinem Bruder erzählt hatte. Doch diese abgeschwächte Form war Nichts gegenüber dem Heutigen gewesen. Nach ein paar Minuten riss ich mich zusammen, setzte ein Lächeln, das wohl etwas schief aussah, auf und klopfte an der hellblauen Tür der Nachbarn. Dort empfing mich Frau Son, eine kleine rundliche Frau mittleren Alters. Sie erwiderte mein Lachen und bat mich zu sich herein. Frau Son war Mutter zweier Kinder, einem vierjährigen Mädchen und einem zweijährigen Jungen. Ihr Mann arbeitete in einer Fabrik für Straßenbahnteile am anderen Ende von Limestone und war selten zu Hause anzutreffen, da er frühmorgens das Haus verließ und erst spät am Abend heimkehrte. Meine Mutter brachte Leo an Tagen, an denen sie Hausbesuche machte, zu ihr, für eine kleine Summe Betreuungsgeld, und holte ihn gegen Nachtmittag wieder ab. Unsere Nachbarin lebte von solch kleinen Gefallen, die sie der ganzen Nachbarschaft gab, da sie selbst nicht Arbeiten ging, aber bei dem kleinen Einkommen ihres Mannes mitverdienen musste. So lag Leo vergnügt in einem Bettchen, umringt von mehreren kleinen Kindern, die abwechselnd die Rassel schüttelten, was ihnen ein freudiges Glucksen entlockte und Leo zum Lachen brachte. Frau Son bot mir einen Tee an, den ich dankend annahm und wir saßen einige Zeit einfach nur da und betrachteten die glücklichen Kinder. Ich war froh, dass unsere Nachbarin nie allzu redselig war und wusste, wann andere Leute ihre Ruhe brauchten. Denn dieser kleine Abschnitt des Tages war meine einzige kurze Atempause, da es mir beim Kindergelächter leichter fiel, die düsteren Gedanken in eine Ecke zu schieben und mein Inneres mit der goldenen Farbe des Glücks zu bemalen, die nach dem Besuch wieder abblättern würde. So wurde ich, als ich mit dem schlafenden Leo auf dem Arm im Gang stand, wieder von Empfindungen und Ängsten durchflutet und eine Frage, die Frage aller Fragen, schob sich in den Vordergrund: Wann würden die Preisrichter kommen, um mich zu holen?
Kapitel 9
In den nächsten zwei Tagen fühlte ich mich wie eine tickende Bombe, die bald explodieren und alles in ihrer Umgebung mitreißen würde. In den Gängen der Schule folgte mir häufig Getuschel und unser Geschichtslehrer würdigte mich keines Blickes mehr, was ich aber nicht als Übel empfand. Zu Hause war es wesentlich schlimmer. Meine Mutter hatte die letzten zwei Tage das Haus nicht verlassen, sie sprach mit niemandem und nähte nur stumm vor sich hin, während meine Schwester jedes Mal Tränen in den Augen hatte, wenn sie mich ansah oder mit mir sprach. Der Einzige, der gut gelaunt war, war der kleine Leo, der von all dem nichts verstand. Da sich die Preisrichter die letzten zwei Tage nicht gerührt hatten, ging ich davon aus, dass sie am nächsten Tag, einem Samstag, kommen würden. Beim Abendessen ergriff ich schließlich meine Chance, die Situation noch irgendwie zu retten. „Mama, es tut mir so unendlich leid, dass ich dir nicht früher davon erzählt habe, aber ich hatte Angst, du würdest mich dafür hassen, was ich war, was ich bin.“
Ganz langsam hob meine Mutter den Kopf. „Aber Zelda, wie konntest du glauben, ich würde dich nicht mehr lieben, nur weil du eine gute Preisrichterin wärst?“
„Nur weil ich eine gute Preisrichterin wäre?“, fragte ich verwundert.
„Viele Menschen haben eine gute Begabung für etwas. Deine Schwester singt zum Beispiel gut, aber heißt das, sie muss unbedingt Sängerin werden? Nein! Das ist nur die Auffassung der Preisrichter, die Preisrichter meinen, dass diejenigen, die des Zahlenlesens mächtig sind zu einem von ihresgleichen werden, aber deshalb muss dies noch lang nicht deine Bestimmung sein.“
Wie hatte ich nur so engstirnig sein können? Ich hatte nur den einen Weg gesehen, den Weg, der den Preisrichtern recht war, aber nie hatte ich darüber nachgedacht, dass ich auch ein ganz normales Leben hätte führen können.
„Ich bin nicht sauer auf dich, nur enttäuscht. Hättest du mir so weit vertraut, mir dein Geheimnis anzuvertrauen, hätten wir eine Lösung gefunden. Natürlich bist du nicht schuld, an deiner Offenbarung und ich mache dir deine Kurzsichtigkeit nicht zum Vorwurf, nur musst du mit diesem Fehler leben.“ Bei diesem letzten Satz seufzte sie müde auf. „Wie ich die Preisrichter doch hasse! Sie nehmen mir immer das weg, was mir lieb und teuer ist.“ Doch ihre Worte hörten sich nicht wie ein prasselndes Feuer an, sondern eher wie eine dünne Flamme, die den Kampf gegen den Wind schon längst aufgegeben hatte.
Zutiefst berührt umrundete ich den Tisch und zog sie in eine lange Umarmung. Durch die Wärme meiner Mutter verlor ich etwas an Angst und ein neues Gefühl, Entschlossenheit, setzte meine Adern unter Strom. Ich würde für meine Schicht kämpfen und mich nicht auf die Ansichten der Preisrichter einlassen. Schaudernd dachte ich an den Preisrichter in meinem Geschichtsunterricht, der die Vorstellungen der Preisrichter so überzeugt dargestellt hatte, als hätte er sie selbst erfunden. So würde ich nicht sein! Doch eine leise Stimme in meinem Inneren behauptete das Gegenteil.
Nach dem Abendbrot packten meine Mutter und ich die wenigen Klamotten, die ich besaß, in ein weißes Tuch und legten es am Küchentisch griffbereit für den nächsten Tag hin. Heute erzählte ich eine Gutenachtgeschichte, meine Lieblingsgeschichte. Sie handelte von einem fernen Land, in dem alle Menschen gleich waren und keiner von Geburt an bevorzugt wurde, von einem kleinen Mädchen, das in einem schönen Haus lebte und viele Dinge besaß, von denen wir nur träumen konnten. Das Buch zu dieser Geschichte existierte nicht mehr, da es von den Preisrichtern eingezogen worden war, um die Menschen von den Gedanken an eine derartig schönere Welt abzuhalten. Doch der Buchinhalt war damals schon so populär gewesen, dass die meisten Limestoner den groben Wortlaut auswendig gekonnt hatten und die Geschichte weiterverbreitet worden war. So wurde sie auch heute noch bei Kerzenschein erzählt und ließ Kinderaugen größer werden, bei den vielen Dingen, die es gab und die sie nicht kannten. Mit den Gedanken in meiner Traumwelt aus der Geschichte schlief ich ein. Die ganze Nacht hindurch verweilte ich dort, auf Wolken schwebend und ohne die dunklen Schatten der Sorgen.
Doch wie nach jeder Nacht kam auch nach dieser der Morgen. Kaum hatte ich meine Augen geöffnet, schon störten die vielen rastlosen Gedanken die vom Schlaf zurückgebliebene innere Ruhe, die durch dessen nicht mehr vorhandene betörende Wirkung meinen Problemen schutzlos ausgeliefert war. Ich wusch mich in dem kleinen Bad, das in der Dämmerung des Morgens noch schäbiger wirkte, dann zog ich mich an und trat mein wohl letztes Frühstück mit meiner Familie an. Die Stimmung war betrübt. Kein Lachen erhellte den Morgen, die Stille surrte in den Ohren, ein Anspannung, der keiner lange standhalten konnte.
„Die Preisrichter, was machen sie mit dir?“ Meine Schwester hatte schließlich dem Druck nachgegeben und das Schweigen durchbrochen.
Ja was machten die Preisrichter eigentlich mit mir? Würden sie mich bestrafen, mich ausbilden? „Ich weiß es nicht.“
Ein mulmiges Gefühl machte sich in mir breit, eine Mischung aus Aufregung und Übelkeit.
„Sie werden dich wohl zu einer von ihnen ausbilden, oder es zumindest versuchen“, antwortete meine Mutter.
Dora betrachtete mich mit vor Schreck geweiteten Augen.
„Das werde ich natürlich nicht zulassen“, beteuerte ich, doch tief in meinem Inneren zweifelte ich daran, ob ich überhaupt eine Wahl hatte.