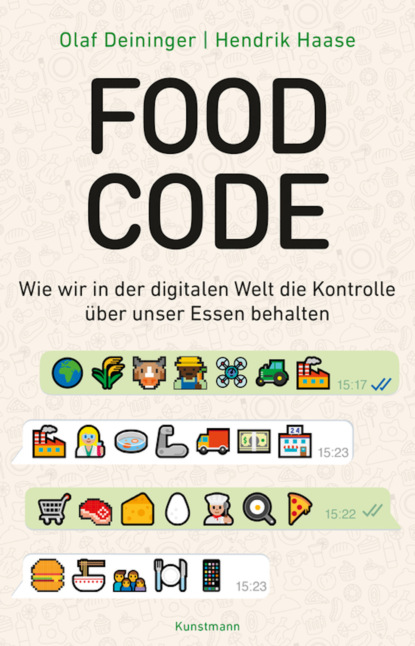- -
- 100%
- +
Diese Entwicklung weckt natürlich auch das Interesse von Händlern wie Amazon. »Alexa, taue das Gemüse auf« oder »Alexa, mach einen Becher Milch warm« sind Sprachbefehle, die vom Amazon Basics Smart Oven seit 2018 verstanden werden. Die nur 60 Dollar teure und 700 Watt starke Mikrowelle von Amazon hat serienmäßig den hauseigenen Sprachassistenten Alexa eingebaut, funktioniert ansonsten genauso wie ein normaler Mikrowellenherd. Einen Unterschied gibt es allerdings: Der Algorithmus überwacht auf Wunsch zum Beispiel die Zahl der verpoppten Popcorntüten und ordert sie automatisch über Amazon nach. Kunden, die das »Auto Popcorn Replenishment« nutzen, bekommen zehn Prozent Rabatt auf die gelieferten Maiskörner.
Auch an June, dem Startup des ehemaligen Apple-Ingenieurs Nikhil Bhogal, hat sich Amazon als Investor beteiligt. Der sprachgesteuerte Ofen für den Küchencounter ist etwas größer als eine Mikrowelle und verfügt im Inneren über eine Kamera, die Temperaturen von über 250 Grad aushalten kann. Damit kann man über das Smartphone dem Backhendl beim Bräunen zuschauen. Mithilfe der Kamera und künstlicher Intelligenz erkennt der Ofen auch automatisch eingeschobene Lebensmittel, zählt und überwacht die Kochvorgänge. Kunden des Lebensmittelhändlers Whole Foods, der ebenfalls Teil des Amazon-Imperiums ist, brauchen seit Oktober 2018 nicht mehr auf die Pizzapackung schauen. June erkennt die Pizza der Eigenmarke automatisch und weiß genau, welche Zubereitungszeit und Temperatur dafür perfekt ist. Diese neuen digitalen Allianzen zwischen Fertiggerichten und smarten Küchengeräten finden sich immer häufiger auf dem Markt. Zwei weitere Beispiele für diese Art von Systemlösungen bieten die Startups Suvie und Tovala. Tovalas Smart Oven ist ein Gerät, das ebenfalls auf der Küchentheke Platz hat und Teil eines »Mahlzeitenservice für wahnsinnig beschäftigte Menschen« ist, so das Werbeversprechen des Startups. Mehrmals die Woche bekommen die Tovala-Ofenbesitzer frisches Essen auf Rädern zum Fertigkochen nach Hause geschickt. Nach dem Scannen des QR-Codes auf den beigelegten Rezeptkarten startet der Ofen das passende Programm. Die Gerichte aus dem Tovala-Universum sind »frisch, international und aus echten Zutaten« – verspricht die Startup-eigene »Food-Philosophy«. Gerichte wie »Limonenkräuter-Risotto« oder »Gebratener Lachs aus der Chesapeake-Bucht mit Remouladensauce & Fingerling-Kartoffeln« stehen auf der Speisekarte. Kunden können sich direkt für ein Abo mit drei, vier, sechs oder mehr Gerichten pro Woche entscheiden. Beworben werden die Plan-Mahlzeiten mit der Aussicht auf »mehr Zeit, um mit deinem Hund spazieren zu gehen, die Kalorien wieder auszuschwitzen oder endlich Gitarre spielen zu lernen«. Dinge, die »wahnsinnig beschäftigte Menschen« eben so machen.
Die heute bereits in der Smart-Home-Ecke von Haushaltsgeschäften und Elektronikmärkten häufiger zu findenden Pfannen, Kochplatten oder Backöfen, die mit Apps steuerbar sind, schauen gegen solche Systemlösungen eher alt aus. Der Schlüssel zum Erfolg scheint für viele tatsächlich nicht mehr im Gerät selbst und dessen smarter Steuerung zu liegen, sondern in der Verbindung mit einem Zusatznutzen wie Einkaufen, Lieferung, Rezeptdatenbank oder Gesundheits services.
Das trieb zuweilen seltsame Blüten, wie vor acht Jahren im Gesundheitsbereich zum Beispiel Hapifork: Die »intelligente Gabel« zählte jeden Bissen und die Geschwindigkeit, mit der die Mahlzeiten verzehrt werden. Das bei zu schnellem Genuss vibrierende Essgerät mit Bluetooth-Funktion war Teil einer Produktfamilie der Firma Hapilabs, die aus Gabel, Waage und Armband zur smarten Gesundheitsüberwachung bestand. Auch SmartPlate, eine Mischung aus dreiteiligem Tellerset, Waage und Mahlzeitenerkennung per KI-Kamera, versucht sich an dieser neuen Art des digitalen Weight-Watchings. Das überwachende Essgeschirr ist allerdings noch nicht auf dem Markt. Die Hapifork dagegen schon fast wieder verschwunden. Chip.de verlieh ihr bereits 2016 einen Platz auf der Liste der »Dinge, die die Welt nicht braucht«. Die meisten Hersteller von vernetzter Küchentechnik versprechen überwiegend Vereinfachung der Zubereitung und Inspiration beim Kochen durch Zusatzangebote wie Rezept-Datenbanken.
Die Firma BSH Hausgeräte will ihren Kunden in der Küche zukünftig eine digitale Koch-Community an die Seite stellen. Das 1967 als Joint Venture von Robert Bosch und Siemens gegründete Unternehmen ist heute eine hundertprozentige Tochter der Bosch-Unternehmensgruppe mit Sitz in München. In vierzig Fabriken in Amerika, Asien und Europa werden Herde, Waschmaschinen oder Kühlschränke für Marken wie Bosch, Siemens oder Gaggenau hergestellt. Damit der smarte Gerätepark im Haushalt untereinander und mit einer App kommunizieren kann, wurde eine eigene digitale Plattform entwickelt. »Mit Home Connect können Sie jetzt Ihr Lieblingsrezept direkt von der App auf Ihren Backofen übertragen. Ihr Ofen wird seine Einstellungen entsprechend anpassen, sodass Sie sofort mit dem Kochen beginnen können.«
Um Kunden im Home-Connect-Kosmos beständig mit neuen Rezepten und praktischen Kochtipps zu versorgen, beteiligte sich die Bosch-Tochter Ende 2017 mit 65 Prozent bei dem Berliner Startup Kitchen Stories. Ursprünglich wollten die beiden jungen Gründerinnen Verena Hubertz und Mengting Gao ein eigenes Restaurant eröffnen, bevor sie auf die Idee einer neuen Koch-App kamen. Die App liefert nicht nur Rezepte, sondern Schritt-für-Schritt-Koch-Anleitungen, kurze Videos, die etwa auch erklären, wie Salat gewaschen oder Rosenkohl am besten geputzt wird. In den Filmen finden sich keine Intros, Abspänne oder weiß behütete Fernsehköche, die aufwendig in der Küche hantieren. Stattdessen sieht man in kurzen Videos Hände aus der Vogelperspektive, die auf dem Küchenbrett schnibbeln, rühren oder kneten. Diese Art der Inhalte wurde anfangs gern belächelt. Warum so kurz? Wer schaut so was? Die Tatsache, dass heute die Weitergabe selbst rudimentärer Kochfertigkeiten innerhalb von Familien nicht mehr so wie früher funktioniert und die Zubereitung von Mahlzeiten oder die Kenntnis von Lebensmitteln weder in der Familie noch in der Schule vermittelt werden, Kochen als Alltagsbeschäftigung aber wieder an Popularität gewinnt, hat dazu geführt, dass Videos der Sorte »How to cook …« und andere zu den Top-10-Suchbegriffen auf YouTube gehören. Die mit 107 Jahren älteste YouTuberin der Welt war eine indische Dorfköchin namens Mastanamma, die ihr Wissen mithilfe eines filmenden Enkels weitergab. Ihr »How to …«-Video eines in der Wassermelone gegarten Hühnchens erreichte über 15 Millionen Aufrufe. Wer wie eine Million anderer Nutzer dem Kanal Kdeb Cooking folgt, kann einem thailändischen Kind dabei zuschauen, wie es in ländlicher Umgebung Entenherzen, knusprige Okra-Schoten oder Shrimps authentisch im Wok zubereitet. Google, zu dem die Videoplattform seit 2006 gehört, fand heraus, dass fast die Hälfte aller Erwachsenen heute Kochvideos auf YouTube schaut. Bei Jüngeren zwischen 18 bis 34 Jahren lag der Anteil im Vergleich sogar um 30 Prozent höher. Der smarte Videobildschirm gehört als «lebendiges« Kochbuch in vielen Küchen bereits zur Ausstattung. Mit zunehmender Smartphone-Nutzung und Küchengeräten, die mit immer mehr Bildschirmen und App-Anbindungen vernetzt sind, steigt die Nachfrage nach solchen Inhalten stetig.
Was vielen Herstellern von Öfen und Kühlschränken heute allerdings fehlt, sind hochwertige eigene Inhalte. Kochplattformen wie Chefkoch.de und der kulinarische Teil von YouTube mögen Millionen von Rezepten bieten, doch sind sie auch gut? Funktionieren sie auch in meinem Ofen? Und wie beginne ich, wenn ich vorher noch nie eine Sellerieknolle in der Hand hatte?
Das zuvor erwähnte Startup Kitchen Stories löst dieses Problem praktisch und schnell verständlich in Zeiten von immer geringer werdenden Aufmerksamkeitsspannen. Selbst Apple-Chef Tim Cook begeistert der Erfolg der Software aus Kreuzberg, die auch im App-Store zu finden ist. Bei seiner Europatour 2017 stand Cook freudestrahlend in der Berliner Küche von Kitchen Stories und lernte das Pfannkuchenwenden.
Mehr als 16 Millionen Mal wurde die Koch-App von Kitchen Stories nach Unternehmensangaben auf der ganzen Welt bereits heruntergeladen. 35 Prozent der Downloads, etwa 5,5 Millionen, kamen dabei aus China, verrieten die Gründerinnen dem Portal Gründerszene. Dort stieg beim Corona-Lockdown Anfang 2020 die Nutzung von Koch-Apps deutlich an. »Die Menschen kochen mehr denn je«, stellte Verena Hubertz im Corona-Fragebogen der Gründerszene im Juli 2020 fest. »Seit Februar dieses Jahres haben wir mehr als eine Million monat liche User organisch hinzugewonnen. Mittlerweile nutzen mehr als vier Millionen Menschen pro Monat aktiv unsere Koch-Plattform über die Webseite und unsere App.« Kooperationen mit anderen Firmen wollen sie weiter ausbauen. »Kochen ist für die Digitalisierung sehr gut geeignet, weil es ein alltagsrelevantes sowie sehr emotionales und positives Thema ist«, sagt Hubertz. Es scheint, als seien sie weltweit zunehmend auf Erfolgskurs.
Die Pod-People und ihre Do-it-yourself-Machines
Das Werkeln in der Küche, das Ausprobieren von Rezepten, inspiriert von einer weltweit vernetzen Koch-Community, hat Konjunktur. Dazu gehören neben dem klassischen Braten und Kochen auch immer mehr Do-it-yourself-Techniken wie Brotbacken, Bierbrauen oder der eigene Gemüseanbau im Minigewächshaus. Das Digitale ermöglicht dabei immer mehr Präzision und eine automatische Fernsteuerung, die Anwendung von Techniken in der häuslichen Küche möglich macht, die vorher der Lebensmittelindustrie, Profiköchen, dem spezialisierten Handwerk oder dem Profigärtner im Gewächshaus vorbehalten waren.
Eine dieser Techniken, die man noch vor wenigen Jahren nur in der gehobenen Gastronomie sehen konnte, ist das Garen von Gemüse oder Fleisch bei niedrigen Temperaturen im Wasserbad, eingeschweißt in einen Beutel. 2014 riefen die Gründer Stephen Svajian, Jeff Wu und Natalie Vaughn Foodies dazu auf, sie bei ihrer Idee eines neuen Präzisionskochers auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter zu unterstützen. Ihr Ziel war es, mithilfe von Technologie jedem diese Art der Zubereitung mit einfachsten Mitteln möglich zu machen. Der Name ihres Start-ups: Anova. Heraus kam ein mit Heizfunktion und Pumpe ausgestattetes, stabähnliches Gerät, das wie ein Tauchsieder in ein Wasserbad gehängt wird. Dort sorgt es dann für konstante Temperatur über viele Stunden oder Tage. Zum Konzept gehörte von Anfang an die Vernetzung des Gerätes mit einer Smartphone-App. Ambitionierte Hobbyköche können so den Kochvorgang, der bei diesen niedrigen Temperaturen oft sehr lange dauern kann, aus der Ferne starten, steuern und timen. Alles, was dazu notwendig ist: ein Smartphone und eine Internetverbindung. Wie bei vielen Apps können Nutzer ihre Sous-vide-Rezepte teilen oder sich von anderen inspirieren lassen. Gründer Stephen Svajian bezeichnet diese Art zu kochen als »Cloud Cooking«. Die Anova-Algorithmen registrierten bislang über 100 Millionen Kochvorgänge von Nutzern des Geräts. Der smarte Heizstab entwickelte sich zum Bestseller, und die Gründer verkauften ihr Startup Anfang 2017 für 250 Millionen Dollar an den schwedischen Küchengerätehersteller Electrolux.
Nicht nur neue ausgefeilte Kochtechniken der Sterneküche, sondern auch komplexe Fermentationstechniken können dank digitaler Steuerung in die Küche einziehen. Der Deutschen liebste Fermenta tionstechnik, das Brauen von Bier, gehört ebenfalls dazu.
Auf der Internationalen Funkausstellung 2019 in Berlin stellten die Koreaner von LG Electronics ihre Zukunftsvision des Bierbrauens für zu Hause vor. Mit dem »HomeBrew«-System sollen alle Schritte möglich werden, angefangen bei der Fermentation des Gerstenmalzes über die Kohlensäurebildung bis hin zur Reifung des Bieres in kompakter Form auf dem Küchenschrank. Temperatur, Zeit und Druck werden dabei durch den »LG-Algorithmus« kontrolliert und gesteuert. Das System, das am Ende des Brauvorgangs fünf Liter Bier zum Zapfen produziert, ist seit Sommer 2020 erhältlich und kostet 1.660 US-Dollar.
Ein ähnlicher Brauautomat ist schon mehrere Jahre am Markt: Der Picobrew, entwickelt von dem Startup des Ex-Vizepräsidenten von Microsoft, Bill Mitchell, hat das Format eines kleinen Backofens. Aus der Seite ragen zwei Schläuche, die mit einem kleinen Fass neben dem Hauptgerät verbunden sind. Um mit dem Bierbrauen zu starten, muss man den Pico, ähnlich wie das geplante LG-Electronics-Gerät, mit Startersets füttern, ganz so, wie man es von den Kapseln einer Espressomaschine kennt – nur größer. Die Packs enthalten vorgefertigte Mischungen aus Biermalz und Hopfen, die jeweils mit einem RFID-Chip auf der Oberseite versehen sind. Den Chip nutzt die Maschine, um das passende Braurezept aus dem PicoBrew-Katalog herunterzuladen und die richtigen Schritte des Brauvorgangs einzuleiten. Ein paar Tage später kann nach Hefezugabe und Reifung bereits das fertige Bier getrunken werden. Wer eigene Bierstile kreieren will, sein Bier etwas bitterer, dunkler oder anders gehopft haben möchte, kann sich auf der Homepage des Startups von Bill Mitchell eigene Starterpacks mit einfachen Reglern konfigurieren. Zum System gehört, wie bei vielen neuen Küchengeräten, eine Online-Community-Plattform, auf der sich die Heimbrauer vernetzen und Rezepturen austauschen können. An die 20.000 Hektoliter braute die Pico-Community bis jetzt. Das ist immerhin so viel, wie eine kleine deutsche Brauerei pro Jahr herstellt.
Systeme wie Pico und vergleichbare Produkte wie der BeerDroid oder Brewbot muten an wie digitale Enkel der in den Neunzigern aufgekommenen Brotbackautomaten. Neben Bier mischen diese vernetzten Geräte heute auch Drinks oder Smoothies aus fertig gelieferten Zutaten. Neu ist, dass die Hersteller ihre Geräte direkt mit einem Online-Lieferabo verknüpfen und die Kunden damit in ein praktisches, aber auch abhängig machendes System bringen. Beobachter der Szene sprechen bereits von »Pod People« in der Küche, also Menschen, die nur noch Nachfülldosen für ihre Geräte bestellen. Im Fall von PicoBrew begann im April 2020 das Zittern vieler Kunden mit der Ankündigung der Insolvenz der Firma und dem Verkauf an einen neuen Inhaber. Wer sorgt jetzt für die nächsten Updates von App und Gerät? Wird die digitale Plattform weitergeführt? Was stelle ich mit einem Gerät an, für das ich in Zukunft vielleicht keine Kapseln mehr bekomme?
Wie groß und begeisternd der Traum vom eigenen Butler in der Küche sein kann, zeigt das Beispiel einer Kaffeemaschine, die sich 2015 in Facebook-Anzeigen als »Orenda – your personal Barista« präsentiert. Das glänzend-silberne Gerät versprach, ein voll programmierbarer Teil des IoT (Internet der Dinge) zu sein, eine eigene App für verschiedene Rezepte direkt vom Kaffeeröster zu besitzen sowie eine eingebaute Kaffeemühle. Mit jeweils 424 US-Dollar sollten Inter essenten das Projekt damals auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter unterstützen, um am Ende eine der fertigen Maschinen ihr Eigen nennen zu können.
Das machte der Programmierer Peter Naulls und erhielt nach endlosen Verschiebungen des Produktionsstarts und Verzögerungen bei der Auslieferung schließlich ein Gerät, aus dem nach Inbetriebnahme ein halber Becher unappetitlicher, brauner und lauwarmer Brühe tropfte. Die zum Gerät gehörige App stellte sich als praktisch unbrauchbar heraus, obwohl sie zur Steuerung des Gerätes notwendig war – einen An- und Ausschalter am Gerät gab es nicht. Nutzer eines Android-Smartphones konnten noch nicht einmal lauwarmen Kaffee produzieren. Für ihr Betriebssystem funktionierte die App und damit die gesamte Kaffeemaschine nicht.
Naulls berichtet auf seinem Blog von der abenteuerlichen Geschichte, die dann folgte. Nachdem Reklamation und Rücksendungen fehlschlugen, begann Peter Naulls das Gerät schließlich auf zuschrauben und Kabel, Pumpen und Computerchip-Wirrwarr zu begutachten. Als Programmierer konnte er auf zwanzig Jahre Erfahrung in Sachen Firmware zurückgreifen. Am Ende gelang es ihm durch Anzapfen und Hacking des fehlerhaften Betriebssystems, immerhin heißes Wasser von der Maschine produzieren zu lassen. Es schmeckte allerdings nach Gummi. Die von ihm offengelegte und überarbeitete Software stellte er anschließend in ein Onlineforum zum freien Download.
Am Ende fand Naulls heraus, dass nicht nur die Likes auf der Facebook-Seite des Startups offensichtlich gekauft waren und negative Bewertungen bewusst verborgen wurden, sondern dass auch die gesamte Gründergeschichte hinter dem vielversprechenden Projekt mehr als fadenscheinig war. Schlussendlich begrub er seine Hoffnungen vom digitalen Barista in seiner Küche und kaufte sich eine Kaffeemaschine ohne WLAN im nächstgelegenen Supermarkt. »Ja, sie kann eine Sauerei machen, wenn man den Deckel nicht richtig aufgesetzt hat«, schreibt er, »aber sie macht extrem schnell Kaffee. Und habe ich erwähnt, dass sie 20 Dollar gekostet hat?«
Dieses Beispiel mag extrem sein, aber es zeigt, dass zur Hausarbeit der Zukunft auch das Aufräumen und Pflegen »des Digitalen« gehören könnten. Habe ich schon das neue Update für den Backofen her untergeladen? Ist der Küchenmixer richtig mit meiner Liefer-App verbunden? Das sind mögliche Fragen, die das »digitale housekeeping« der Zukunft beantworten muss. Wir sollten also wachsam sein, um später nicht vor unliebsamen Herausforderungen durch digitale Störungen zu stehen, die den Spaß am Kochen, Brühen oder Brauen vermiesen.
Künstliche kulinarische Intelligenz
Es ist eine riesige Zahl: 6,1 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr aus deutschen Küchen im Mülleimer. Pro Kopf sind es rund 75 Kilogramm, fanden die Forscher am Thünen-Institut Ende 2019 im Auftrag des Bundesernährungsministeriums heraus.
Mit einer groß angelegten Kampagne »Zu gut für die Tonne« versucht Ernährungsministerin Julia Klöckner daher, die Bürger zu »leckeren Restegerichten« aus übrig gebliebenen Lebensmitteln zu inspirieren, unter anderem mit einer »Beste Reste-App« fürs Smart-phone, die mit Klassikern wie »Arme Ritter« und »neuen Kreationen und pfiffigen Beilagen aus wenigen Zutaten« aufwartet. 661 Rezepte finden sich in der App, unter anderem von prominenten Kochpaten wie Sarah Wiener, Johann Lafer oder dem Schauspieler Daniel Brühl.
Doch was tun mit einem halben Brokkoli und einer Pastinake, die noch im dunklen Kühlschrank vor sich hin dämmern? Die Reste-App der Ministerin bietet für dieses Problem genau 0 Rezeptvorschläge. Bei der Eingabe von übrig gebliebenen Bohnen gelangt man immerhin zu einem Rezept von Sternekoch Harald Wohlfahrt. Eine »Gemüseterrine mit Ziegenquark und Pesto« schlägt er vor. Dazu benötigt man neben den 150 g Bohnen 15 weitere Zutaten, darunter »5 EL Creme Double«, Mangoldblätter und »150 g Spargel«. Das ist keine Lösung der akuten Restelage in der Küche.
Für die lernenden Algorithmen, die ein junges Team rund um den dänischen Gründer Michael Haase in Kopenhagen entwickelt, wäre diese Situation dagegen ein gefundenes Fressen. Haase und sein Team haben mit ihrer App Plantjammer das Prinzip eines Kochbuchs quasi auf den Kopf gestellt. Nach der Eingabe übrig gebliebener Zutaten schlägt die App zunächst mehrere Basisrezepte vor. Die künstliche kulinarische Intelligenz aus Dänemark macht anschließend Vorschläge, wie man die vorhandene Gemüsekombination interessanter machen kann. Soll es knuspriger, würziger oder süßer werden? Erst nachdem die Vorlieben und Wünsche eingegeben sind, generiert der Algorithmus das passende Rezept aus der individuellen Kombination, inklusive aller nötigen Zutaten, der passenden Kochanleitung und einer Einkaufsliste. Alles jederzeit frei modulier- und anpassbar. Wer mit der finalen Einkaufsliste in den Supermarkt geht, um noch ergänzende Zutaten zu kaufen, bekommt von der App Sonderangebote von bald ablaufenden Lebensmitteln angezeigt. Um all das zu können, wurden die Algorithmen mit zahllosen Aromaprofilen von Zutaten, Rezepten und passenden Geschmackskombinationen trainiert. Das Ziel von Haase ist es, zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Dass dabei Ressourcen gespart und Lebensmittelabfälle reduziert werden, sind erfreuliche Mitnahmeeffekte. Seit 2018 ist der deutsche Küchenhersteller Miele an diesem Startup beteiligt.
Von künstlicher Intelligenz generierte Rezeptvorschläge aus bereits vorhandenen Zutaten macht auch die App Wellio. Als Basis dienen ihr dabei nicht nur Vorlieben und Gesundheitsziele der Nutzer, sondern gleich die gesamte Vorratskammer, die von der App digital mit Check-ins und Check-outs von gekauften oder gegessenen Lebensmitteln geführt wird. Wellio ist darüber hinaus direkt an einen Lieferservice angeschlossen, der – wenn etwas fehlen sollte – in zwei Stunden die entsprechenden Zutaten liefert. Wer danach Hilfe beim Zubereiten der Speisen braucht, findet in der App ein Assistenzsystem, das mit nützlichen Tipps und Videos weiterhilft. »Unsere Mission ist die Decodierung, wie Mahlzeiten zu Hause zubereitet und genossen werden«, heißt es auf der Webseite des Startups von Gründer Tjarko Leifer, der vor der Gründung von Wellio die globale Strategie der Monsanto-Tochter »The Climate Cooperation« verantwortete. 2018 schluckte der drittgrößte Lebensmittelhersteller der USA Kraft Heinz die Wellio-App und integrierte das Team anschließend in den eigenen Digital Hub in San Francisco.
Genau zu wissen, was in den Schränken der Kunden lagert – ob gekühlt oder nicht –, wird besonders für Küchengerätehersteller immer interessanter. Das gilt insbesondere, wenn sich diese private Lagerhaltung mit dem Online-Lebensmittelhandel und den Geräten zur Zubereitung verknüpfen lässt. Chefling ist ein weiterer digitaler Küchenassistent aus dem Silicon Valley, der Lebensmittelvorräte verwaltet und personalisierte Rezeptvorschläge liefert und seit 2019 zu einem Drittel der Bosch-Tochter BSH-Hausgeräte gehört.
Die Kühlschränke der Zukunft sind auf diese neue Welt und entsprechende Datenströme bereits bestens vorbereitet. Der Hersteller Whirlpool meldete schon 2018 ein Patent für ein »System zur Erkennung und Analyse von Interaktionen« in Kühlschränken an. Auf den zum Antrag gehörenden Skizzen sind Kameras zu sehen, die automatisch erkennen, welche Lebensmittel in den Kühlschrank gelegt oder entnommen werden. Auf der Elektronikmesse CES 2020 in Las Vegas präsentierte Samsung die neueste Generation ihres Family Hubs: einen Kühlschrank, ausgestattet mit großem Touchscreen und Kameras im Inneren, die mithilfe von KI Lebensmittel erkennen und »verbesserte, durchdachtere Essensplanung und Rezeptvorschläge« machen sollen, »die auf persönliche Vorlieben zugeschnitten sind«. Dabei soll die gesamte Planung der Mahlzeiten vom Supermarkt bis zur häuslichen Küche dank Samsung rationalisiert werden. Um die Lieferungen zu koordinieren und Mahlzeiten zu planen, bieten Samsung-Kühlschränke eine Anbindung an Googles Kalenderfunktion. 2015 gelang es den Cybersecurity-Experten Pen Test Partners, einen Vorgänger des Family Hubs, den RF28HMELBSR Smart Fridge, zu hacken und so an die Log-in-Daten der Google-Konten zu kommen. Samsung musste zähneknirschend bei der Datensicherheit nach bessern.
Um aus seinen Kühlschränken Einkaufszentren in der Küche zu machen, sucht Samsung den Austausch mit etablierten Firmen, aber auch mit Startups. 2016 verkündete der Konzern eine Partnerschaft mit Nestlé. 2019 kaufte man das Startup Whisk des 32-jährigen Gründers Nick Holzherr aus Birmingham. Seine App Whisk kann aus Rezepten praktisch jeder beliebigen Webseite automatisch Einkaufslisten generieren und diese inklusive der passenden Kochanleitungen speichern. Der Algorithmus von Whisk kennt Zutaten, ihre Verfalls daten und auch die Verbindung zum passenden Händler, der die Zutaten liefern könnte. Mit Kooperationspartnern wie Mondelez, Kellog’s, Uni lever, AmazonFresh, Tesco und Walmart sieht sich Whisk inzwischen als Knotenpunkt der größten Player im Lebensmittelökosystem. »Wir arbeiten mit den weltweit führenden Marken, Lebensmitteleinzelhändlern, Verlagen, Gesundheitsunternehmen und Geräteherstellern zusammen, um alle Berührungspunkte der Reise entlang der Leben smittelkette zu verbinden und so Erlebnisse zu schaffen, die für alle ansprechender, einfacher und besser sind«, verkündet man inter essierten Businesskunden. Partner der App profitieren von angeblich 500 Millionen »Food-Interactions« pro Monat, 16 Millionen am Tag.