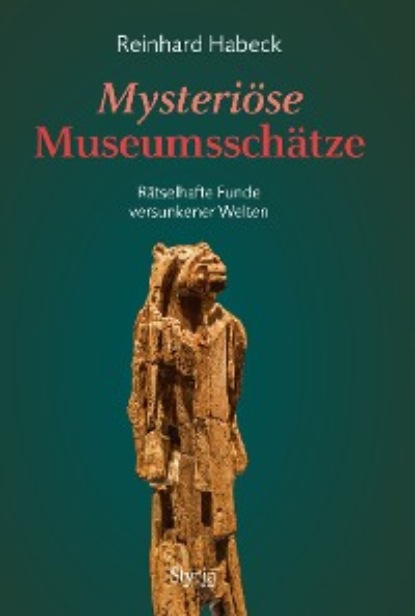- -
- 100%
- +
Ihr Alter wird seit den 1950er-Jahren mit 25.000 Jahren angeführt, doch das Prachtweib ist älter als gedacht. Das bestätigten neue Analysen der Forscher Philip Nigst von der Universität Cambridge und Bence Viola vom Max-Planck-Institut für Anthropologie in Leipzig. Demnach ist die „Venus von Willendorf“ bereits vor 29.500 Jahren hergestellt worden. In diesem Zusammenhang interessant: Es existieren etwa 25.000 Jahre alte russische Venusfigurinen aus Awdejewo, Kostjonki und Gagarino, die in Größe, Alter und Aussehen der Willendorfer Frauenfigur verblüffend ähneln. Exemplare entdeckt man im Kunstmuseum Eremitage in St. Petersburg oder als Replik in westeuropäischen naturkundlichen Sammlungen.
Wesentlich älter ist die 1988 in Stratzing bei Krems entdeckte „Venus vom Galgenberg“, auch „Fanny von Stratzing“ genannt. Ihr Fundort im Waldviertel liegt nur 25 Kilometer von Willendorf entfernt. Die 7,2 cm große Reliefplastik wurde vor 36.000 Jahren aus türkis-glänzendem Schiefer gefertigt. Sie ist damit das älteste bekannte Kunstobjekt Österreichs. Ihre Körperhaltung ist außergewöhnlich: Ein Arm ist nach oben gerichtet und der Oberkörper scheint eine leichte Pirouette anzudeuten. So wird der Eindruck einer dynamischen Bewegung vermittelt, weshalb ihr das Grabungsteam den Kosenamen „Fanny“ verlieh. Nicht zufällig: Die bekannteste österreichische Tänzerin des 19. Jahrhunderts hieß Fanny Elßler (1810 – 1884). Ob die Statuette aber wirklich weiblich ist, kommt auf die Sichtweise des Betrachters an. Es gibt Prähistoriker, die in der „Venus“ eher einen Jäger mit Keule erkennen.
Weniger bekannt ist, dass am selben Ort noch zwei andere, möglicherweise unvollendete Frauenstatuetten entdeckt wurden. Beide sind aus dem Stoßzahn eines Mammuts gefertigt. Die eine plumpe Figur hat eine Höhe von 22,5 cm, die andere misst 9 cm. Sie werden als „Venus II“ und „Venus III“ bezeichnet. Ihr Zuhause teilen sie mit der „Galgenberg-Fanny“ und der „Venus von Willendorf“ im Naturhistorischen Museum in Wien.
Wenn wir nach der Urmutter aller Mütter fragen, landen wir wieder in den Höhlen der Schwäbischen Alb mit den bisher ältesten entdeckten Kunstwerken der Menschheit. Am 9. September 2008 machte der erfolgsverwöhnte Grabungsleiter Nicholas J. Conard eine neue spektakuläre Entdeckung im Hohle Fels. Der Urzeitforscher stieß mit seinem Team auf künstlerisch vollendete Tierplastiken und auf eine kleine Menschenfigur aus Mammutelfenbein. Sie sorgt seither als „Venus vom Hohle Fels“ für Aufsehen, denn sie ist dem Jahrgang des Löwenmenschen zuzuordnen. Mit 40.000 Jahren ist sie ein echtes „Golden Girl“, auch wenn ihre Größe von 6 Zentimetern im Vergleich zum Löwenmenschen bescheiden wirkt. Ihre zur Schau gestellte Weiblichkeit mit überdimensionierten Brüsten und stark vergrößerter Vulva ist eindeutig zweideutig. Details im Brustbereich und oberhalb des Bauches erstaunen: eingravierte konzentrische Linien. Ob Tätowierungen, Bänder, Kleidungsstück oder eine Art eiszeitlicher Büstenhalter, bleibt der Fantasie überlassen. Was noch überrascht: Der Kopf fehlt. Stattdessen gibt es im Halsbereich eine Öse, die vermuten lässt, dass die Figurine als Amulett getragen wurde. Oder, was freilich eine noch größere Sensation wäre: Es gab ein bewegliches Kopfstück, das am Hals der Figur befestigt war. 2015 wurde ein neues Fundstück aus dem Hohle Fels präsentiert. Es ist wiederum der Torso einer weiblichen Figurine.
Der Zweck dieser und all der anderen Frauenplastiken ist ungeklärt. Die Deutungsversuche reichen von Fruchtbarkeitssymbol über Lebensspenderin und Muttergottheit bis hin zu Ahnendarstellung. Waren die Venusfiguren Abbildungen realer Frauen der Altsteinzeit? Der Inbegriff einer früheren matriarchalischen Gesellschaftsstruktur? Oder urzeitliche Pin-ups als Ausdruck männlicher Wünsche und Sehnsüchte? Fragen, die bis heute unter Fachgelehrten kontrovers diskutiert werden.
Das wirklich Erstaunliche: Die Huldigung der Muttergottheiten lässt sich bis in jüngere Epochen der Vorzeit und der Antike zurückverfolgen. Der Mutterkult schließt auch Mythen über Himmels-, Erd- und Fruchtbarkeitsgöttinnen mit ein. Im Alpenraum weit verbreitet sind Quellheiligtümer, die mit prähistorischen Göttinnen wie Raetia und Noreia verbunden werden. Viele christliche Gotteshäuser sind über oder in unmittelbarer Nähe prähistorischer Heiligtümer errichtet worden, dort, wo einst weibliche Gottheiten verehrt wurden. Besonders auffällig ist das in der Nähe von Leibnitz auf dem Frauenberg (Nomen est omen) in der Südsteiermark, wo neben der Wallfahrtskirche die Fundamente eines Isis-Noreia-Tempels freigelegt wurden. Und wo bleibt die sprichwörtliche Männlichkeit?
Im eiszeitlichen Weiler der Region Donau-Schwäbisch-Alb genossen offenbar beide Urzeitgeschlechter gleichberechtigte Verehrung. Der Mann in Gestalt des anmutigen großgewachsenen Löwenmenschen vom Hohlenstein-Stadel und einen Katzensprung entfernt die Frau in Form der kleinen dicken Venus vom Hohle Fels. Ein Bild für Götter – wie im biblischen Garten Eden mit dem ersten Menschenpaar Adam und Eva. Über 40 Jahrtausende trotzten sie gemeinsam allen Weltkatastrophen, gingen quasi durch dick und dünn und retteten sich hinüber ins Cyberspace-Zeitalter. Das verdient Bewunderung, Respekt und Anerkennung. Die gibt es seit 9. Juli 2017 ganz offiziell: Der Löwenmensch, die „Hohle-Fels-Venus“ und ihr Gefolge aus sechs schwäbischen „Höhlen der ältesten Eiszeitkunst“ wurden in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen!
Das Vermächtnis vergangener Welten zu bewahren und zu schützen, ist für den Fortbestand unserer Zivilisation entscheidend. Das wusste auch der deutsche Gelehrte Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835): „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft!“

Ausgrabungen in der Hohlensteinhöhle im Lonetal

Stadtwappen von Vöcklabruck
Der Wolfsegger Eisenklotz
„Die Zeit frisst Stahl und Eisen.“
Deutsches Sprichwort
Bezeichnung: „Salzburger Stahlwürfel“ oder „Eisenwürfel von Wolfsegg“; beides sind irreführende Begriffe, da es sich weder um einen Würfel handelt, noch das Fundstück aus Salzburg stammt.
Besonderheit: Bearbeitetes Eisenartefakt in der Größe von 65 x 60 x 50 mm und einem Gewicht von 730 Gramm. Das Objekt soll aus einer viele Millionen Jahre alten Kohleplatte herausgefallen sein.
Geschichte: Als Fundort wird die Schöndorfer Eisengießerei „Isidor Braun“ in der Stadtgemeinde Vöcklabruck in Oberösterreich genannt. Berichtet wird, dass im Herbst 1885 zum Heizen der Schmelzöfen große Braunkohleplatten aus dem zwölf Kilometer entfernten Wolfsegger Bergbau (1995 stillgelegt, heute ein Industriedenkmal) angeliefert worden sind. Beim Zerschlagen der Platten entdeckte ein Arbeiter namens Riedl den sonderbaren Klumpen, der aus der Kohlemasse herausgefallen sein soll. Seither erlangte der „Wunderwürfel“ zweifelhaften Ruhm in vielen Publikationen der Grenzwissenschaften. Die Erklärungshypothesen reichen von „plumper Fälschung“ über „seltener Meteorit“ bis hin zu „Überbleibsel einer Vor-Zivilisation“ oder „Hinterlassenschaft außerirdischer Erdenbesucher“. Die Fantasie wurde dadurch beflügelt, dass kaum einer der Autoren das „Beweisstück“ jemals selbst zu Gesicht bekommen hatte. Lange Zeit galt der legendäre Metallklotz als verschollen und geriet in Vergessenheit. 2017 wurde er aus dem dunklen Museumsdepot wieder ans Licht gebracht.
Alter: unbekannt
Aufbewahrung: Heimathaus-Stadtmuseum Vöcklabruck in Oberösterreich
Am falschen Ort zur falschen Zeit

Geologisches „Problematikum“
Wie kommt der versteinerte Abdruck einer Reifenspur in die geologische Schicht der Dinosaurierära? Erinnerungen an Familie Feuerstein? Mit diesem Rätsel werden Besucher des Thonetschlössls in Mödling bei Wien konfrontiert. Das historische Gebäude beherbergt einen Teil der Sammlung des städtischen Bezirksmuseums. In der geologischen Abteilung liegen in einer Vitrine Gesteinsbrocken aus der heimischen Kreidezeit, die irritieren. Sie zeigen regelmäßige, wabenähnliche Gittermuster, die verblüffend an Reifenspuren heutiger Mopeds oder Autos erinnern. Daneben ist ein Cartoon mit einem Motorrad abgebildet, mit dem Text: „Entstand diese Lebensspur damals auf ähnliche Weise?“
Was scherzhaft gemeint ist, erklärt aber nicht den Ursprung der Abdrücke. Geologen nennen diese Spuren Paleodictyon. 1850 wurden sie erstmals entdeckt und beschrieben. Als Erklärung wird angeboten, dass die versteinerten Strukturen durch unbekannte Urzeitorganismen, Aktivitäten einzelliger Spurenfossilien oder durch tatsächliche Skelettabdrücke von Körperfossilien entstanden sind. Ebenso werden chemische Umweltfaktoren ins Spiel gebracht. Eine natürliche Erklärung ist die vernünftigste, kurios sind die urzeitlichen „Reifenspuren“ allemal.

Welches Fossil der Urzeit hinterlässt „Reifenspuren“?
Ungeklärte urgeschichtliche und archäologische Funde, die völlig aus der Reihe tanzen, schaffen es immer wieder, die Gemüter der Gelehrtenwelt zu erhitzen. Die Fachwelt bezeichnet diese „regelwidrigen“ Entdeckungen als OOPArt, eine Abkürzung für Out-of-Place Artifact („Artefakte am falschen Platz“).
Der US-Kryptozoologe Ivan Terence Sanderson (1911 – 1973) prägte diesen Begriff für historische, archäologische und paläontologische Funde, die nicht ins vertraute Schema passen. Zu diesen Grenzfällen der Archäologie gehören handwerkliche Gegenstände wie Eisennägel, Schrauben, Gefäße, Schmuck oder menschliche Knochen, die angeblich bei ihrer Auffindung komplett von Gestein umschlossen waren. Aus dem Zeitalter der industriellen Kohlewirtschaft ab dem 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts liegen besonders viele Protokolle vor.
Eine OOPArt-Entdeckung führt in die USA ins Jahr 1880. Damals baute ein Ranger in den Bergen von Colorado Kohle ab. Das Material stammte aus einem Schacht, welcher 90 Meter in die Tiefe führte. Jeden Tag nahm er davon eine Fuhre mit nach Hause. Daheim stellte er fest, dass die Kohlestücke zu groß zum Verbrennen waren. Er zerkleinerte einige davon – und heraus fiel ein eiserner Fingerhut. Das Fragment wurde in der näheren Umgebung bald als „Evas Fingerhut“ berühmt, blieb aber nicht lange erhalten. Das Metall erwies sich als sehr bröckelig. Schließlich ging das Relikt verloren. Die Kohle, in dem der Gegenstand angeblich eingebettet war, war Ende der Kreidezeit vor 65 Millionen Jahren entstanden.
Zweifel am Wahrheitsgehalt solcher Meldungen sind berechtigt. Schon deshalb, weil nur wenige Beweisstücke für Untersuchungen erhalten sind. Zu den bekanntesten Gegenständen aus der Galerie skurriler erdgeschichtlicher Funde zählt ein „fossiler Hammer“, der 1934 bei London in Texas entdeckt wurde. In der Literatur kennt man ihn als „The London Artifact“. Während einer Wanderung im Juni 1934 stieß die 32-jährige Emma Hahn mit ihrer Familie auf das eigentümliche Überbleibsel. Aus einem Felsbrocken ragte ein Stück Holz hervor. Neugierig begutachtete man das Mysterium und versuchte es freizulegen. Dann das Unbegreifliche: Das Holz entpuppte sich als Holzstiel eines Hammers! Staunen und ungläubiges Kopfschütteln überkam die arglosen Wanderer. So etwas konnte es doch nicht geben! Denn das Gestein, in dem der Hammer eingeschlossen war, musste ein Alter von vielen Millionen Jahren aufweisen. Eine urzeitliche Epoche, in der – unserem Weltbild zufolge – kein menschliches Leben existiert haben kann. Wer aber sollte sonst dieses Werkzeug angefertigt und liegen gelassen haben, wenn nicht ein Mensch? Heute wird der Hammer von militanten Verfechtern der Schöpfungslehre als Indiz gegen Darwins Evolutionslehre ins Feld geführt. Skeptiker hingegen halten es für viel wahrscheinlicher, dass ein Bergarbeiter im 19. Jahrhundert das Werkzeug verloren hat. Später sei es dann vom Sedimentgestein umschlossen worden.
Ein anderer bizarrer Fund, der die Geschichte überdauert hat, ist ein Eisenbecher, der, so wird behauptet, 1912 in Arkansas beim Aufschlagen eines Kohlebrockens zum Vorschein kam. Es gibt dazu eine eidesstattliche Erklärung, aus der hervorgeht, dass der Behälter bei seiner Entdeckung in einen Klumpen Kohlegestein eingebettet war. In dem beglaubigten Dokument vom 27. November 1948, das von Finder Frank Kennard aus Sulphur Springs im US-Bundesstaat Arkansas stammt, wird der ungewöhnliche Vorfall bezeugt: „Während ich 1912 für die Municipal Electric Plant (Anm.: Städtisches Elektrizitätswerk) in Thomas, Oklahoma, arbeitete, stieß ich auf einen soliden Brocken aus Kohle, der zu groß war, um ihn weiter zu verwenden. Ich brach ihn mit einem Vorschlaghammer auseinander. Dabei fiel dieser eiserne Topf aus dem Inneren des Brockens und hinterließ seinen Formabdruck in einem Stück aus Kohle. Jim Stull (Anm.: ein Angestellter der Firma) war Augenzeuge in dem Moment, als das Gestein aufgebrochen wurde, und sah ebenfalls den Topf herausfallen. Ich versuchte, den Ursprung der Kohle herauszufinden, und stellte fest, dass sie aus der Oklahoma Mine in Wilburton stammt. Sign. Frank Kennard.“ (C. E. Baugh, „Dinosaur“)
Der Eisenbecher und der Hammer sind Musterbeispiele für kuriose Unikate. Sie waren 2001 in der vom Kulturmanager Klaus Dona realisierten und von mir mitinitiierten Ausstellung „Unsolved Mysteries – Die Welt des Unerklärlichen“ im Wiener Schottenstift zu sehen. Hier wurden Hunderte archäologische Rätselfunde aus aller Welt erstmals im Original präsentiert und zur Diskussion gestellt. 2004 wanderte die Schau weiter in die Schweiz nach Interlaken in den „Jungfrau-Park“, der damals noch „Mystery-Park“ hieß.
Ein großes Sammelsurium solcher OOPArt hortet der US-amerikanische Kreationist Carl Baugh in seinem 1984 gegründeten „Creation Evidence Museum“ in Texas. Vordergründig wohl aus religiöser Überzeugung. Neben dem „fossilen Hammer“, dem „eisernen Becher“ und der Kopie der eidesstattlichen Urkunde des Finders gibt es dort noch jede Menge weitere „Evolutionsfallen“ zu sehen, die am gesunden Menschenverstand zweifeln lassen. Ein versteinerter Schuhabdruck mit einem zertretenen Urzeitkrebs aus dem Erdmittelalter gehört genauso dazu wie ein menschlicher Riesenfinger und Steinplatten mit Hand- und Fußabdrücken, die angeblich aus der Saurierepoche stammen.
Wenn die Fundstücke echt sind und immer wahrheitsgetreu berichtet wurde, die erdgeschichtlichen Zeittafeln stimmen und die Relikte tatsächlich so alt sind wie das Gestein, in dem sie aufgefunden wurden, haben wir ein Problem. Dann wären sie nämlich Abermillionen Jahre vor dem Auftauchen der ersten nachweisbaren menschlichen Vorfahren entstanden. Wie kann das sein? Könnten die Hinterlassenschaften von einer unbekannten Hochkultur stammen, die lange vor unserer Zeit existierte? Damit wäre unser vertrautes Weltbild auf den Kopf gestellt. Geologen und Paläontologen sind skeptisch. Sie halten eine neuzeitliche Herkunft vieler Spielarten von OOPArt für wahrscheinlicher. Aber wie können Objekte innerhalb von nur wenigen Jahrhunderten oder gar Jahrzehnten von Gesteinsmassen völlig umschlossen werden? Eine Theorie der Geowissenschaft besagt, dass ein chemisch-geologischer Prozess der Natur damit zu tun hat, der als Konkretion bezeichnet wird. Wenn mineralreiches Wasser verdampft, hinterlässt es feinkörnige Rückstände, die rasch anwachsen können, bis sie einen Gegenstand umschließen. Ein natürlicher Vorgang, der keine Millionen Jahre überbrücken muss, versichern Geologen.
Das Dilemma bei der wissenschaftlichen Überprüfung: Es gibt keine Vergleichsanalysen der Gesteinsarten am Fundort, in denen die entdeckten Artefakte wie behauptet eingeschlossen waren. Gleiches gilt für fehlende Kohlebrocken mit den hinterlassenen Formabdrücken der fraglichen Gegenstände. Wir müssen dennoch nicht gleich an Schwindel und Scherze denken, aber eine Unsicherheit schwingt bei der Beurteilung archäologischer „Verrücktheiten“ immer mit: die überlieferten Fundumstände. Wie zuverlässig sind sie? Und: Ziehen wir aus den vorhandenen Daten immer die folgerichtigen Schlüsse?
OOPArt aus Vöcklabruck

Charles Fort
Die Frage nach der Zuverlässigkeit alter Quellen stellt sich auch beim eingangs erwähnten legendären OOPArt-Fall aus Österreich. Es betrifft einen angeblichen „Würfel aus Stahl“, der historischen Aufsätzen zufolge im Inneren einer Kohleplatte steckte. Der Amerikaner Charles Fort (1874 – 1932), ein emsiger Sammler von Zeitungsberichten über unerklärliche Phänomene, erwähnte den Fall bereits 1919 in seinem „The Book of the Damned“. Die deutsche Übersetzung erschien 1995 unter dem Titel „Das Buch der Verdammten“. Fort schreibt von der Entdeckung eines „Metallwürfels“ und führt mehrere Quellen aus dem 19. Jahrhundert an, darunter Reportagen in den Wissenschaftsjournalen „Nature“ und „L’Astronomie“. Seither wird in Mystery-Kreisen darüber spekuliert, ob das Unikat ein Überbleibsel einer versunkenen Vor-Zivilisation ist.
Vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren brachte es der geheimnisumwitterte „Salzburger Eisenwürfel“ zu bemerkenswerter Berühmtheit. Dafür sorgten viele bekannte Mitstreiter alternativer Theorien von Robert Charroux bis Johannes von Buttlar. Sie berichteten darüber in ihren Werken und hatten dabei leider alte Artikel oder Kommentare von Kollegen ungeprüft übernommen. Keiner der grenzwissenschaftlichen Autoren hatte das Corpus Delicti jemals persönlich in Augenschein genommen. Was die Nachforschungen damals erschwerte: Das Artefakt galt zwischenzeitlich als verschollen.
Als Freund fantastischer Ideen muss ich mich selber an der Nase nehmen. In meinem Sachbuch „Geheimnisvolles Österreich“ schrieb ich im Jahre 2006: „Skeptiker halten den ‚Salzburger Würfel‘ eher für eine ‚Laune der Natur‘ oder einen gewöhnlichen Eisenklumpen von einer Industriemaschine. Ein Pech, dass dieses Beweisstück für Untersuchungszwecke nicht mehr zur Verfügung steht. 1886 bis 1910 war es in einem Salzburger Museum ausgestellt. Mit Ende des Zweiten Weltkrieges verlieren sich die Spuren. Jahrzehnte später soll das Relikt im Oberösterreichischen Landesmuseum Linz und danach im Heimatmuseum von Vöcklabruck aufbewahrt worden sein. Seit einigen Jahrzehnten ist das anormale Ding erneut unauffindbar.“
In Wahrheit befand sich das Metallstück seit 1958 im Heimathaus von Vöcklabruck in Oberösterreich. Was ich damals verabsäumte, holte ich im März 2017 mit einer Anfrage im Museum nach. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Kurator Helmut Kasbauer bestätigte, dass sich „der Wolfsegger Eisenfund nach wie vor im Museum befindet, allerdings nicht als Ausstellungsstück, sondern im Depot“. Bei einem persönlichen Treffen, so Helmut Kasbauer ermutigend, könne ich den „Stein des Anstoßes“ selbst unter die Lupe nehmen. Ein Lockruf, dem jeder Sonntagsforscher gerne folgt.
Der älteste Report
Die Odyssee um den deklarierten „Salzburger Stahlwürfel“ ist eine tollkühne Geschichte. Sie ist es wert erzählt zu werden, weil sie uns vor Augen führt, wie leicht die Verzerrung alter Berichte, missverstandene Übersetzungen, falsche Ortsangaben, aber auch ausufernde Fantasie in die Sackgasse führen können. Es ist wie beim Kinderspiel „Stille Post“, bei dem die Nachricht einer Person ins Ohr des Nachbarn geflüstert wird. Dieser gibt dann das Halbverstandene auf die gleiche Weise an andere Teilnehmer weiter. Am Ende der Fahnenstange kommt etwas Irrwitziges heraus, das mit der ursprünglichen Information nur mehr wenig zu tun hat.

Protokoll zum „Salzburger Eisenwürfel“ aus dem Jahr 1886
Um die Spreu vom Weizen zu trennen, ist es wichtig, die Urquelle zu kennen. Sie führt zum Bauingenieur Dr. Adolf Gurlt, der sich als Geologe für das seltsame Eisenrelikt interessierte und dazu am 7. Juni 1886 vor der „Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde“ in Bonn referierte. Das Dokument zum Sitzungsbericht des Vereins befindet sich im Archiv der Universität Erlangen. Es ist der älteste Report zum kuriosen Eisenklotz und zugleich Quelle für alle weiteren Berichterstattungen. Das Protokoll ist relevant und hilft bei der Wahrheitsfindung.
„Dr. Gurlt legte einen merkwürdigen Eisenmeteorit, sogenannten Holosiderit, vor, welcher sich in tertiäre Braunkohle eingeschlossen vorfand. Derselbe ist Eigenthum des städtischen Museums Carolino-Augusteum in Salzburg und wurde an dasselbe von Herren Isidor Braun Söhne zu Schöndorf bei Vöcklabruck in Oberösterreich geschenkt. Er wurde um die Zeit von Allerheiligen 1885 in der Gussstahl- und Feilenfabrik dieser Firma von einem Arbeiter zufällig entdeckt, als derselbe einen Block fester Braunkohle, die aus dem Bergwerke zu Wolfsegg, der Wolfsegg-Traunthaler Bergwerksgesellschaft gehörig, stammte, der bequemeren Heizung wegen zerschlug.“
Weiters erfahren wir aus der Akte, dass der Eisenklotz mehreren Sachverständigen zur Begutachtung vorgelegt wurde. Doch deren Expertisen fielen unterschiedlich aus. Einige Gelehrte hielten den Fund für ein „Kunstprodukt“ aus „Meteoriteneisen“, das nachträglich durch Menschenhand bearbeitet wurde. Dafür spräche die „sehr regelmäßige Gestalt“ des Eisenstückes, heißt es. Andere Experten bezweifelten diesen Verdacht und stützten sich auf eine nähere Untersuchung, aus der angeblich deutlich hervorginge, „dass man es hier mit einem nicht bearbeiteten Eisenmeteorit oder einem Holosiderit zu thun hat, der keine steinartige Meteormasse enthält“.
Was besonders interessant ist: In dem Protokoll wird die Form des ominösen Gegenstandes erstmals als „Würfel“ beschrieben: „Der Holosiderit hat einen fast quadratischen Querschnitt und entspricht einem Würfel, an dem zwei gegenüberliegende Flächen, kissenartig, stark abgerundet sind, während die übrigen vier Flächen durch diese Abrundungen viel schmäler geworden und in der ganzen Länge mit einer tiefen Furche versehen sind. Sämmtliche Flächen und Furchen sind mit den für Meteoreisen so sehr charakteristischen Näpfchen oder Aussprengungen bedeckt, daher eine nachträgliche Bearbeitung durch Menschenhand ausgeschlossen ist.“
Irdisch oder außerirdisch? In dem Gutachten werden Größe, Gewicht und Beschaffenheit erstmals genannt, die die These stützen sollten, wonach das Relikt angeblich aus den Tiefen des Alls stamme. „Das Eisen ist mit einer dünnen Haut von magnetischem Eisenoxydoxydul überzogen, welche eine feine Runzelung zeigt. Der Holosiderit hat 67 mm grösste Höhe, 62 mm grösste Breite und 47 mm grösste Dicke; er wiegt 785 gr, hat 7,7566 specifisches Gewicht, die Härte des Stahls und enthält ausser chemisch gebundenem Kohlenstoff eine geringe Menge Nickel, ist aber bisher nicht quantitativ analysirt worden. Eine kleine Schliff-Fläche, welche mit Salpetersäure angeätzt wurde, lässt die bei Meteoreisen sonst gewöhnlichen Widmannstätten’schen Figuren nicht erkennen, wohl aber zwei verschiedene Metalllegierungen. Hierdurch, sowie durch seine kubische Spaltbarkeit, welche auch die Ursache der regelmäßigen Form ist, kommt er den berühmten Meteoreisen von Braunau in Böhmen und Santa Catarina in Brasilien sehr nahe.“
Wie aber sollte ein Meteorit in einer Kohlegrube gelandet sein? Der Bericht zu Adolf Gurlts Studie glaubt die Antwort zu kennen. Sie mutet für heutige Verhältnisse recht skurril an:
„Die Braunkohle, in welcher der Holosiderit gefunden wurde, wird zu Wolfsegg unterirdisch abgebaut; derselbe kann also nur während ihrer Bildung in der Tertiärzeit in dieselbe hineingefallen sein und somit gehört er zu einem der seltensten Funde von Meteoriten aus einer älteren geologischen Epoche.