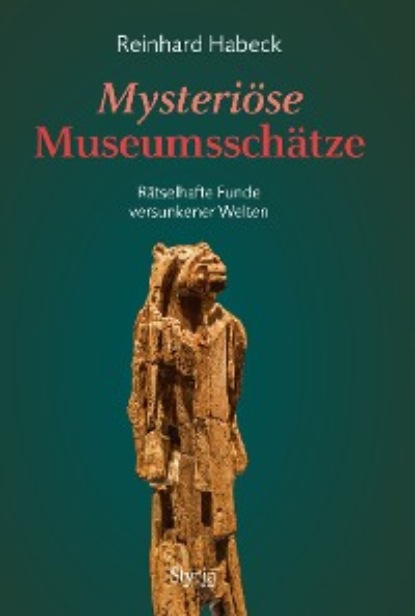- -
- 100%
- +
Die langen Furchen auf den schmalen Flächen hatten besonders an eine nachträgliche künstliche Bearbeitung denken lassen; doch kommen solche rinnenartige Ausfurchtungen neben den Näpfchen bei den meisten Eisenmeteoriten vor. Die ganze äußere Erscheinung lässt sich durch die Annahme leicht erklären, dass der abgesprengte Eisenwürfel bei seinem Fluge durch die Atmosphäre, mit über 30 Kilometer Geschwindigkeit in der Sekunde, eine Rotation besaß, deren Axe rechtwinklig durch die Mitte seiner beiden Seitenflächen ging, daher diese nur an den Kanten abgesprengt wurde, während die ihn der Rotationsperipherie liegenden vier Flächen die tiefen Ausfurchtungen erhielten.“ War damit alles wissenschaftlich geklärt? Mitnichten. Ab diesem Bericht ging die Kontroverse um den „Eisenwürfel“ erst richtig los.
Falsche Fährten
Der Sitzungsbericht über Adolf Gurlts Expertise zum angeblichen Geschoss aus dem All enthält viele Mängel. Sie sind „hausgemacht“, weil der Gelehrte seinen Kollegen nicht das originale Beweisstück vorlegte, so wie das im Auftakt des Protokolls behauptet wird. Es waren lediglich Fotografien, die für eine Prüfung zur Verfügung standen. Ob Gurlt das Eisenrelikt überhaupt jemals selbst in der Hand gehalten hat, ist fraglich. Das geht aus den Recherchen von Hubert Malthaner und Adolf Schneider hervor. Die beiden Ingenieure besuchten 1973 das Heimathaus in Vöcklabruck und gehören zu den wenigen Autoren, die den ominösen Metallklotz tatsächlich im Original gesehen haben. Ihre Reportage über „Das Geheimnis des Salzburger Würfels“ wurde 1974 in der Mai-Ausgabe der Zeitschrift „Esotera“ veröffentlicht.

Der „Eisenwürfel“ 1974 als Coverstory im Magazin „esotera“
Schon damals war bekannt, dass etliche Angaben von Adolf Gurlt nicht stimmen. Das Eisenrelikt sieht zwar wie ein geometrischer Körper aus, ist aber kein Würfel. Es entspricht vielmehr einer Trapezplatte mit aufgewölbten Seitenflächen, die etwa 50 dellenförmige Vertiefungen bedecken. Die vier schmalen Seitenflächen rund um das Objekt zeigen eine einheitliche Rinne von etwa 10 mm. Diese Eigenart im Gestein stiftete viel Verwirrung. Besonders nach der Veröffentlichung eines Artikels im französischen Wissenschaftsmagazin „Science & Vie“. In Ausgabe Nr. 516 vom September 1960 beschreibt der Autor Georges Ketman das Eisenrelikt mit den Worten „parallélépipède parfaitement régulier“ (ein „vollkommen regelmäßiger Quader“).
Etwas wirklich Regelmäßiges, quasi ohne Makel, gibt es an dem Fragment nicht. Mit der falschen Übersetzung aus dem Französischen wurde die Verwirrung weiter gesteigert. „Parallélépipède“ mutierte zu „parallel pipes“. Bald darauf erfuhren erstaunte Leser in Zeitschriften aus aller Welt, dass ein russischer Archäologe beabsichtige „nach Salzburg zu reisen, um dort parallel liegende Röhren aus poliertem Stahl zu analysieren, die tief in den Adern eines Kohlebergwerkes eingebettet liegen und auf ein Alter von 30.000 Jahren datiert sind“. Ein Musterbeispiel dafür, dass Fake News kein Phänomen des Internetzeitalters sind.
Was noch auffällt: Je nach Publikation weichen die Größenangaben des Wolfsegger Eisenstücks voneinander geringfügig ab. Das kann man innerhalb der Toleranzgrenze gelten lassen. Was aber hat es mit der immer wieder genannten Ortsangabe „Salzburg“ auf sich? Gemäß der Urquelle von Adolf Gurlt befand sich der Eisenfund im Besitz des Museums Carolino-Augusteum in der Stadt Salzburg. Das Museum existiert bis heute und wurde bis 2007 so genannt, heute heißt es „Salzburg Museum“, aber das Relikt aus Wolfsegg war dort vermutlich nie zu Gast.

Sorgte 1960 für Verwirrung: „Fake News“ im Fachmagazin „Science & Vie“
Die „Phänomene-Detektive“ Malthaner und Schneider glauben an eine Verwechslung der ähnlich klingenden Museumsnamen „Carolino“ und „Carolinum“. Belegt ist, dass das Original gemeinsam mit einer Replik aus Gips in den Jahren 1950 bis 1958 im „Museum Francisco-Carolinum“ zu Linz verwahrt wurde. Lag das Fundstück dort kurzfristig schon in früherer Zeit? Verwunderlich wäre das nicht. Im Carolinum-Palais, heute Sitz der Landesgalerie Linz, waren viele Jahrzehnte lang die naturhistorischen Schätze der Region untergebracht. In den 1960er-Jahren wurden die einzelnen Abteilungen in die „Oberösterreichischen Landesmuseen“ ausgelagert. Der Großteil der Sammlungen übersiedelte publikumswirksam ins Linzer Schloss.
Der Meteoritenirrtum
In der geowissenschaftlichen Sammlung des Schlossmuseums hätte der Wolfsegger Eisenfund eines der Prachtstücke sein können. Dann nämlich, wenn sich Adolf Gurlts Analyse über die kosmische Herkunft des Findlings bestätigen ließe. Bis heute wird auch im Internet das Gerücht verbreitet, der Wolfsegger Eisenklotz sei ein Meteorit. Mit absoluter Sicherheit ist er genau das nicht. Das wurde bereits im Jahre 1950 erkannt, als der Stein im Linzer Museum Francisco-Carolinum von Geologen genauer begutachtet wurde. Die Bestätigung gelang 1966 durch Wissenschaftler im Naturhistorischen Museum und der geologischen Bundesanstalt in Wien. Dabei wurde eine Probe aus dem Stück herausgeschnitten und mit der Mikrosonde eines Elektronenmikroskops analysiert.

1967 wurde ein Stück des Eisenbrockens für Untersuchungen herausgeschnitten.
Am 10. Jänner 1967 teilte der Leiter der Untersuchung, Dr. Grill, das Ergebnis mit: „Eisen mit wenig Mangan und Mangansulfiden, kein Nickel, kein Chrom, kein Kobalt, daher mit Sicherheit kein Meteorit.“ Der Befund lautet ernüchternd: „Reines Gusseisen!“ Der Wolfsegger Eisenklotz ist also ein gegossenes Kunstprodukt. Das bedeutet, es muss dazu das Modell einer Gießform aus weichem Material existiert haben, in Handarbeit hergestellt aus Ton oder Wachs. Derlei wurde nirgendwo entdeckt. Da der Eisenklotz aber in einer Gießerei gefunden wurde, liegt der Verdacht nahe, dass er dort erst im 19. Jahrhundert geformt wurde. Doch wozu?
Eine andere These lautet: Der Klumpen sei mit ähnlichen Brocken im Bergbau als Ballast bei einfachen Förder- und Bohrmaschinen zum Einsatz gekommen. Dabei sei er zufällig zwischen die Kohleplatten geraten. Wäre möglich. Was indes stutzig macht: Wenn das gusseiserne Gewicht lediglich ein unbedeutender Gegenstand war, der alltäglich im Bergbau genutzt wurde, warum hat ihn der Finder, ein Arbeiter namens Riedl, und auch sonst niemand als solchen erkannt? Und ist es nicht ebenso verwunderlich, dass das Wolfsegger Eisenrelikt weltweit das einzige erhaltene Unikat dieser Art ist? Wo sind die vielen Vergleichsgewichte aus den Kohlegruben geblieben?
Die Analyse zum Wolfsegger Eisenfund liegt ein halbes Jahrhundert hinter uns. Wir wissen heute, es ist kein Stahlwürfel und kein Meteorit, sondern ein künstlich angefertigtes Gebilde. Die Fundumstände und die Motive der Herstellung liegen weiter im Dunkeln. Mittlerweile gibt es fortschrittlichere Untersuchungsmethoden der modernen Forensik. Könnte ihre Anwendung neue Erkenntnisse bringen? Glück auf!
Lokalaugenschein im Heimathaus
Freitag, 7. Juli 2017: Ich folge der netten Einladung von Kustos Helmut Kasbauer und mache mich mit der Bahn auf den Weg nach Vöcklabruck. Auf der Weststrecke ist das „Tor zum Salzkammergut“ von Wien aus in weniger als drei Stunden erreicht.
Das Heimathaus liegt gleich neben der Stadtpfarrkirche im Zentrum der lieblichen Altstadt. Es ist ein 500 Jahre altes Gebäude, das einst eine Priesterunterkunft war. Im Jahr 1937 wurde es als Vöcklabrucker Stadtmuseum adaptiert und beherbergt seither erlesene Schätze aus der näheren Umgebung. Der Obmann Helmut Kasbauer erwartet mich bereits. Er nimmt sich viel Zeit und führt mich durch die Schauräume des Heimathauses. Bei der Besichtigung springen mir ein paar außergewöhnliche Exponate ins Auge, die es nur hier zu sehen gibt: Dazu gehört der originale Tragsessel des oberösterreichischen Komponisten Anton Bruckner (1824 – 1896), eine 1702 gebaute Holzräderuhr mit nur einem Stundenzeiger und geschnitztem Räderwerk, eine um 1520 entstandene untypische Heiligenstatue des christlichen Märtyrers Sebastian sowie Raritäten aus den frühesten Pfahlbau-Siedlungen am Attersee und am Mondsee, die bis in die spätere Jungsteinzeit um 4000 v. Chr. zurückreichen.

Heimathaus-Stadtmuseum Vöcklabruck
Und wo versteckt sich das Wolfsegger Eisenrelikt? „Wir haben es nicht ausgestellt, weil eindeutig feststeht, dass es kein Meteorit ist“, erklärt Helmut Kasbauer. Das lange Zeit verschollen geglaubte Stück wurde für mich aus dem Depot geholt und liegt in einer roten Schatulle verheißungsvoll am Tisch der Bauernstube. Ich nehme es in die Hand und beäuge die auffälligen dellenförmigen Einbuchtungen genau. Als Laie könnte man meinen, es handle sich tatsächlich um einen einst auf der Erde eingeschlagenen Weltraumvagabunden. Der Kurator versichert: „Es ist nur ein Klumpen Eisen, der in der Bergwerksindustrie vermutlich als Gewicht oder Teil einer Maschine gedient hat.“ Der Museumsleiter räumt aber ein: „Wir wissen von keinem ähnlichen Fund.“ Dann könnte man ihn doch als Unikat mit genau diesen Hinweisen im Stadtmuseum ausstellen? Helmut Kasbauer bleibt skeptisch: „Ohne überprüfbare Fakten zur Herkunft macht das wenig Sinn.“

Der Autor mit Kustos Helmut Kasbauer
Es könnte aber sein, prophezeie ich behutsam, dass es nach Erscheinen meines Buches wieder vermehrt Interesse zum Eisenfund geben wird. Der Direktor winkt schmunzelnd ab: „Das war das letzte Mal, dass ich dazu eine Anfrage beantwortet habe.“
Ich fühle mich als Glücksritter. Eine letzte Frage hätte ich aber noch: Lagern im Kellerarchiv des Heimathauses weitere Seltsamkeiten, die Museumsbesuchern verborgen bleiben? „Nur Gerümpel!“, zeigt sich Helmut Kasbauer amüsiert, legt sogleich den Eisenklotz wieder ins rote Kästchen und bringt es zurück ins Lager. Schade, denn der legendäre Wolfsegger Eisenfund hat seinen Anteil an der Vöcklabrucker Geschichte. Als heimische Kuriosität hätte sich der „Klumpen“ einen Vitrinenplatz verdient.

2017 wiederentdeckt: der legendäre „Wolfsegger Eisenfund“

Menhir aus dem Val Camonica
Die letzten Alpenrätsel
„Botschaften werden vom Auge weitergegeben, manchmal ganz ohne Worte.“
Anaïs Nin (1903 – 1977)
französische Schriftstellerin
Bezeichnung: Alpine Felszeichnungen und Steindenkmäler der Vorzeit
Besonderheit: Es sind die letzten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte: Hunderttausende in Stein gravierte Botschaften, die von Steinzeitkünstlern hinterlassen worden sind. Besonders fleißig waren unsere Urahnen im norditalienischen Val Camonica: An dessen Berghängen sind rund 350.000 Graffiti zu bestaunen. Wozu wurden sie angefertigt? Was bedeuten die Zauberzeichen?
Geschichte: Zeugnisse künstlerischer Kreativität sind im Alpenraum seit der Altsteinzeit belegt. Die ersten Graffiti wurden 1909 in Capo di Ponte entdeckt. Zu den berühmtesten Fundplätzen zählen neben Val Camonica der Monte Bego in den Alpes Maritimes (Seealpen) bei Saint Dalmes-de-Tende in Südfrankreich nahe der Grenze zu Italien, Gebiete in den Schweizer Kantonen Graubünden und Wallis und die norditalienische Region Trentino-Südtirol.
Alter: In der Kupfer-, Bronze- und Eisenzeit entfalteten keltisch-alpine Graffitigenies des Camuni-Volks ihre kreativste Phase. Es ist der Zeitabschnitt um 5000 v. Chr. bis Christi Geburt.
Aufbewahrung: Der Großteil der Felszeichnungen kann in mehreren Freiluftmuseen beziehungsweise Archäologieparks entlang des Camonica-Tals erkundet werden. Anders bei den prähistorischen Steinstelen. Sie befinden sich größtenteils nicht mehr an ihren ursprünglichen Standorten. Die interessantesten Exponate werden in archäologischen Museen der Lombardei aufbewahrt, darunter im Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, Museo Didattico d’Arte e Vita Preistorica, Centro camuno di studi preistorici. Alle befinden sich in Capo di Ponte, Gemeinde Brescia. Weitere Schaustücke und Vergleichsobjekte findet man unter anderem im Musée des Merveilles in Tende in Frankreich, im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck und im Südtiroler Archäologiemuseum Bozen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.