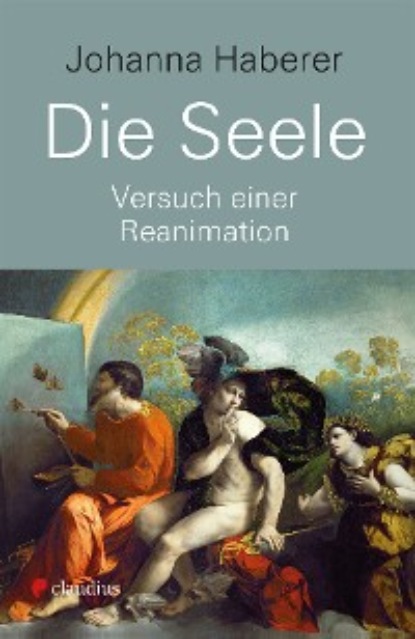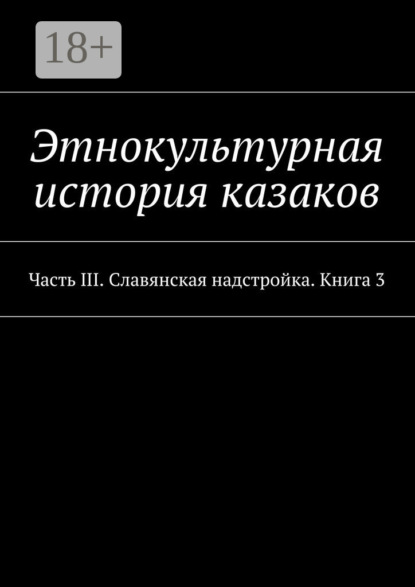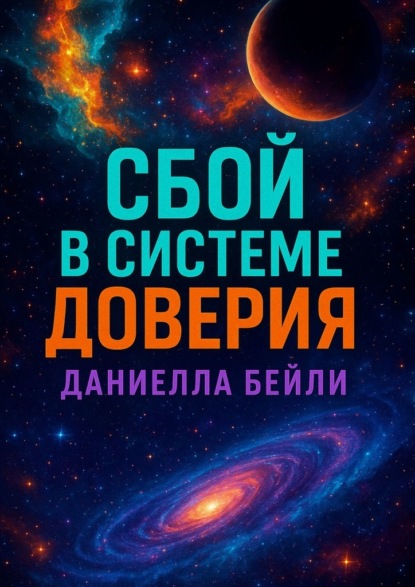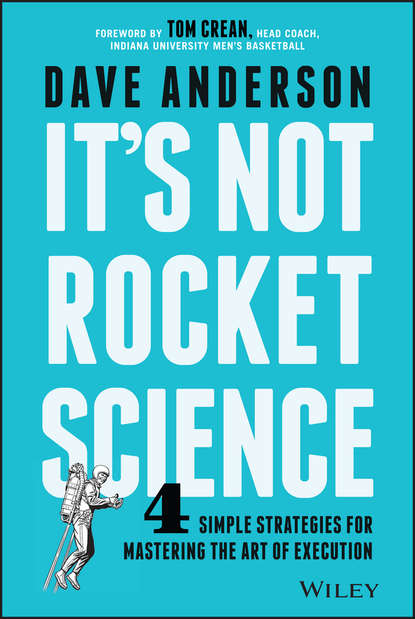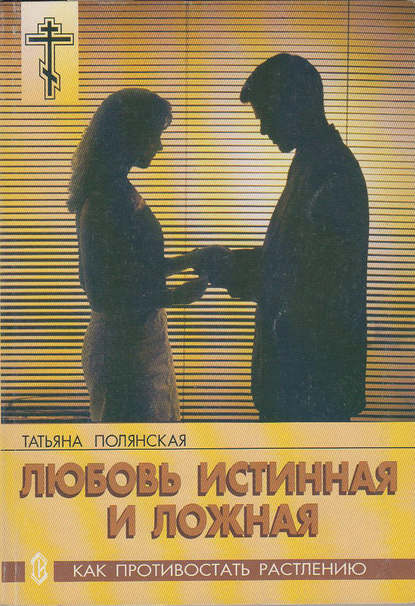- -
- 100%
- +
Doch Nichtseiendes Nutzen9
Wie von etwas reden, das es nicht gibt, und das dennoch intuitiv erfahren wird als „Nichts, ohne das alles nichts wäre“? Entsprechend metaphorisch ist die Rede von der Seele in ihren kulturellen Zusammenhängen. Sie wird symbolisiert im Schmetterling, der aus der Raupenhülle kriechend seine Gestalt ändert, sie nimmt Gestalt an als Brücke und Pfeil, als Vogel, als Feuer, Luft und Atem, als Sprache und Musik. Sie steht für das Unbewusste, die Sprache des Traums und der Passagen des menschlichen Geistes in innere Welten.
Ja, man könnte das Wort „Seele“ selbst als Metapher beschreiben für das Leben in seinen inneren Zusammenhängen, als die Bewegung des Menschen in das Andere hinein.
Der Religionswissenschaftler Kocku von Stuckrad hat in seinem Buch die „Die Seele im 20. Jahrhundert“ von 2019 gezeigt, wie sich im 19. und 20. Jahrhundert die Seelendiskurse neu organisierten – vorbei an der „Wissenschaft von der Seele“, der Psychologie. In deren Wörterbüchern, Lehrbüchern und Datenbanken ist das Wort „Seele“ oder „Soul“ nicht mehr zu finden. Die Seele wird in die semantischen Landschaften der Religion verwiesen. Dabei wäre möglicherweise gerade der Seelenbegriff geeignet, den Riss zwischen den empirischen Lebenswissenschaften und den Geisteswissenschaften, insbesondere der Philosophie und der Theologie, zu überbrücken. Die Neuro- und Kognitionswissenschaften, die einem naturwissenschaftlichempirischen Paradigma folgen, müssten sich nicht mehr in einer seelenlosen Echokammer bewegen. Und die Seele wäre ein Schlüsselbegriff, unter dem sich die unterschiedlichen Denkansätze der Lebens- und der Geisteswissenschaft treffen könnten.10 Der Verlust des Seelenbegriffs hat in den letzten hundert Jahren nämlich dazu geführt, dass sich die esoterischen Diskurse und Denkfiguren weitab von der naturwissenschaftlichen Erkenntnis trotzig behauptet haben. Manchmal mit absurden Auswüchsen.
Ob man sich mit okkultischen Bewegungen befasst oder den Schamanismus neu entdeckt, ob man die religiösen Perspektiven der Punk-, Gothic- oder Hare-Krishna-Bewegungen in den Blick nimmt oder in der Religionsforschung Phänomene wie Rausch, Ekstase und Tanz behandelt – bei all diesen Bewegungen steht die Frage nach dem Ganzen und dessen Vergänglichkeit im Zentrum. Auch spirituelle Bewegungen, die die Heiligkeit der Natur wiederentdecken, vom Naturschutz bis zum Bäume-Umarmen, haben global Anhänger gewonnen, die – siehe die Aktivisten von Greenpeace oder Sea Shepherd – auch einen politischen Flügel entwickeln.
Aber auch bei der Entdeckung systemischer Zusammenhänge der belebten Natur in den ökologischen Bewegungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts liegt die Frage nach der Sakralisierung der Natur ganz vorne. Die sogenannte „grüne Religion“ verbindet geisteswissenschaftliche und auch theologische Aspekte mit den neueren Naturwissenschaften, die in interdisziplinären Zugängen versuchen, die Dynamiken des Lebens und ihrer inneren Zusammenhänge zu erfassen. Insofern könnte es die konkurrierenden Weltanschauungen versöhnen, wenn man sich des Begriffs der Seele neu entsänne – nicht als physikalisch messbare Entität, nicht als innermenschlicher Herrschaftsraum der Bischöfe und Päpste, sondern als Begriff für das System der Lebendigkeit. Ein Begriff der Seele, der im Inneren die Welt nach einem dynamischen Prinzip der Resonanz zusammenhält.
Die Spur der Worte
Der Begriff „Seele“ mag zwar aus den naturwissenschaftlichen und auch den wissenschaftlichtheologischen Sprachräumen ausgewandert sein, doch ist er in der Alltagssprache der Menschen unverändert vital. Wir sprechen, wenn wir von „Seele“ sprechen, immer von etwas anderem als dem Körper. Seele meint etwas, das über unsere körperliche Befindlichkeit hinausgeht.
Seele ist nunmehr ein Dach- oder Schirmbegriff, der nicht eine eigene Entität beschreibt, sondern unbestimmte, aber nachvollziehbare Dimensionen des Fühlens und des impliziten Wissens. Seele beschreibt also Dimensionen der Innerlichkeit, der Unkörperlichkeit, der Wesentlichkeit, möglicherweise der Unsterblichkeit und sicher der Unfassbarkeit.
Nach wie vor sprechen wir davon, dass zwei Menschen „ein Herz und eine Seele“ sind, sich „seelenverwandt“ fühlen, ein Gebäude „seelenlos“ wirkt oder mir jemand „aus der Seele“ spricht. Da ist einer mit „Leib und Seele“ dabei, und wieder ein anderer redet sich eine Last „von der Seele“. Gutes Essen und ein guter Trunk indessen halten „Leib und Seele“ zusammen.
Man kann sich die „Seele aus dem Leib“ schreien oder jemandem die „Seele aus dem Leib“ prügeln und man stimmt einem Redner „aus tiefster Seele“ zu. Eine „Seele von Mensch“, ist jemand, der sich um andere kümmert, eine „alte“ Seele bezeichnet einen weisen Menschen, eine „schwarze“ Seele einen bösen. Man kann seine Seele sogar verkaufen, das wissen viele Märchen. Das geht aber nie gut aus.
Bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden 2021 wurde wohl kein Wort häufiger verwendet als die „Seele“. Fast alle Redner sprachen davon, dass die „Seele Amerikas“ zerrissen sei und nun geheilt werden müsse. Jeder Zuschauer und jede Zuhörerin – und es waren Milliarden – wusste, was gemeint war und doch wären alle ins Stammeln geraten, hätte man sie gefragt, was genau so eine Seele denn sei. Eine nationale Identität vielleicht, die sich speist aus gemeinsamen Kämpfen und Erinnerungen, der Überwindung von Sklaverei und Krieg, aus Kunst, Kultur und der Frage, wie es für alle weitergeht. Oder was meint Woody Guthries Lied sonst?
This land is your land and this land is my land
From California to the New York Island
From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters
This land was made for you and me …11
Genau kann man es nicht sagen, man kann es bloß spüren. Seele ist ein Wort, das Wesentliches beschreibt, ohne dass man es definieren könnte.
Selbstgespräche
Allein die Existenz reflexiver Verben in fast allen Sprachen der Welt zeigt, dass wir Menschen uns im Denken als Subjekt und Objekt zugleich verstehen können: Wenn ein Subjekt etwas macht, das sich auf das Subjekt selbst bezieht, dann muss das Subjekt zugleich auch das Objekt der Aktion sein.
So können wir uns nicht nur selbst die Zähne putzen oder die Haare föhnen, sondern wir sprechen auch davon, uns selbst zu trösten. Wir können uns selbst betrügen und belügen, wir können uns ängstigen und uns beklagen, wir können uns informieren und uns interessieren, wir können es uns gut gehen lassen und uns ausruhen, wir können uns ärgern und uns entscheiden, wir können uns wohlfühlen und verirren, wir können uns verlieben und – wir können uns sogar ändern. In jedem Fall existiert in unserer Sprache das Selbst als eine Instanz, die mit sich selbst kommunizieren kann. Dieses Reflexionsfeld, diesen Resonanzraum nennen wir „Selbstbewusstsein“.
Die Kluft zwischen der naturwissenschaftlichen und technischen Abbildung menschlicher Denk- und Gefühlsprozesse und der Wirklichkeit der Sprache könnte tiefer nicht sein. Sprache schafft Evidenzen, die von der naturwissenschaftlichen Logik nicht erfasst werden können. Die Philosophen Paul Ricoeur und Hans Blumenberg nähern sich diesem Phänomen auf unterschiedliche Weise. Für beide aber ist der Begriff der Metapher erkenntnisleitend.
Eine Metapher beschreibt bekanntlich Phänomene in Bildern und verdeutlicht Gemeintes, indem Bilder aus anderen Kontexten zur Beschreibung herangezogen werden. Es entsteht also in der zwischenmenschlichen Kommunikation eine Bildsprache, die Unsagbares sagbar macht und gerade durch Überraschung und assoziative Freiheit die Wahrnehmung der Menschen erweitert und Begriffe von Scheuklappen befreit.
Blumenberg sagt: Die Sprache schafft Bilder für die Wahrnehmung, die eine „unmittelbar einleuchtende Bedeutung eröffnen, die sich anders als metaphorisch nicht, oder (noch) nicht aussagen lässt.12
Eine Metapher für das Selbst-Sein des Menschen, seine Individualität und seine Offenheit gegenüber der Welt und Gott scheint der Begriff „Seele“ zu sein.
„In der Philosophie nennt man einen ‚Begriff‘, was man in der Dichtung ‚Metapher‘ nennt. Das Denken schöpft aus dem Sichtbaren seine Begriffe, um das Unsichtbare zu bezeichnen“, schrieb die Philosophin Hannah Arendt13, und der französische Philosoph Paul Ricoeur bezeichnete die Metapher als „Instrument der Welterfassung“ und als einen Weg, „Denkprozesse zu beginnen und zu befördern“.14 Metaphern sind also Begriffe, die einen Denkprozess anstoßen, der niemals zum Abschluss kommt.
Für dieses Offenhalten des Denkens durch Sprache wäre eine Re-Animation des Seelenbegriffs auch in Philosophie und Theologie ein Zugeständnis, das Geheimnis des Lebendigen zu schätzen und sich nicht ausschließlich mit der Wortwelt der empirischen Psychologie, der Bio- und der Neurowissenschaften zu begnügen.
Viele Sprachschöpfungen, die das biblische Erbe in der theologischen, kirchlichen und liturgischen Sprache übermitteln, haben einen metaphorischen Charakter und wirken im anerkannten akademischen Wortschatz bedeutungslos und veraltet. Trotzdem gehen mit ihnen zugleich ganze Welten der Empfindungen und Denkhorizonte unter.
Ist in der jüdisch-christlichen Tradition von Vergebung die Rede, von Erlösung, Sünde und Trost, ja von Gott und der Seele – so sind diese Begriffe in dem Sinne metaphorisch, als sie keinem beschriebenen Objekt entsprechen, sondern unbeschreibliche Erfahrungen umfassen. Begriffe, die dem Einzelnen die Möglichkeit geben, eigentlich unbeschreibliche und ureigene Erfahrungen zu benennen. Sie bezeichnen die Wirklichkeiten des Inneren.
Der Begriff der Seele hat möglicherweise deshalb wieder eine vorsichtige Konjunktur, weil er das Geheimnis des Lebendigen vor der vollständigen Vermessung des Menschen in Daten zu retten verspricht. Seele wird zur Parole des Widerstands gegen ein Denken, das den Menschen auf Handlungs- und Entscheidungsdimensionen reduzieren möchte. Gab es im Zeitalter der Industrialisierung jenen Aufschrei des wahnsinnigen Ingenieurs („Die Seele, die Seele ist tot!“), so gilt es jetzt Begriffe für das zu finden, was stirbt, wenn wir mit unserem Denken und Empfinden in den Netzwelten untergehen. Wenn unsere Innenwelt in einer Art digitalem Vampirismus verwertet und verbraucht wird.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.