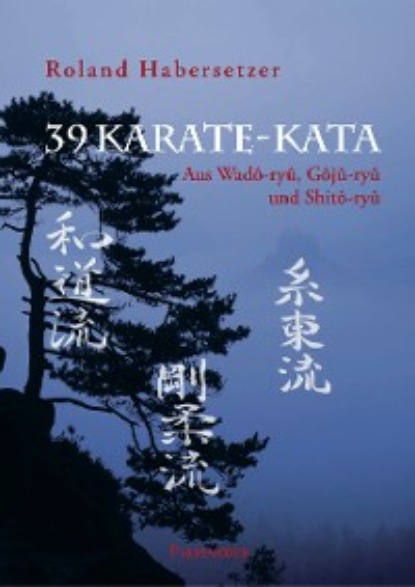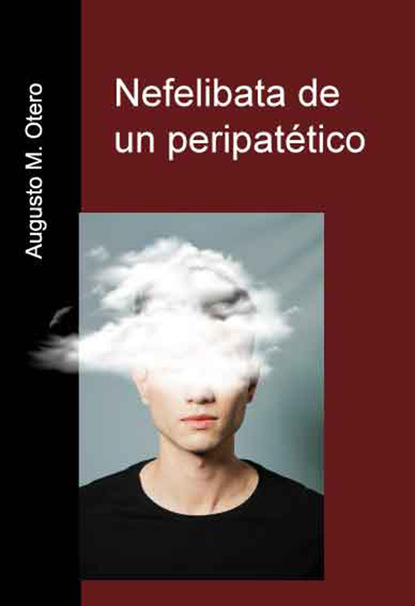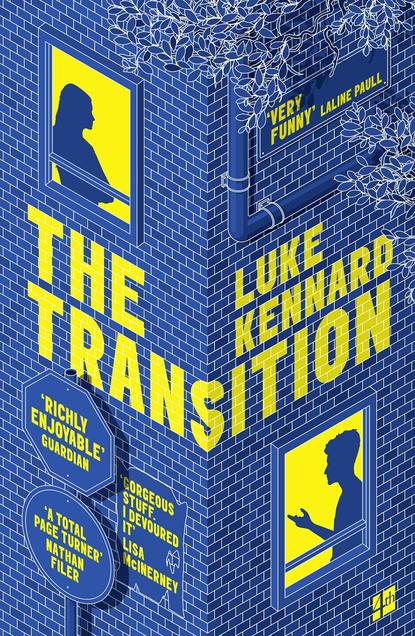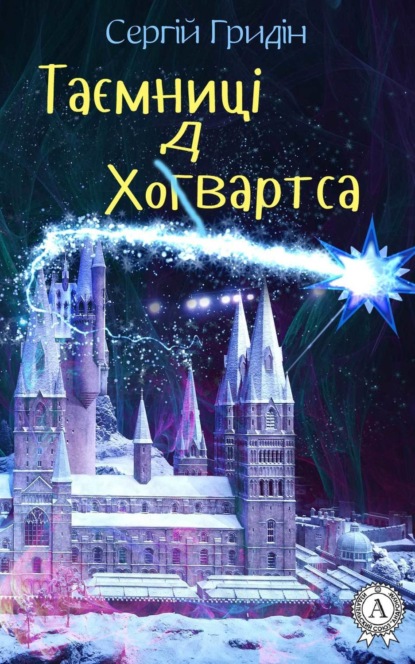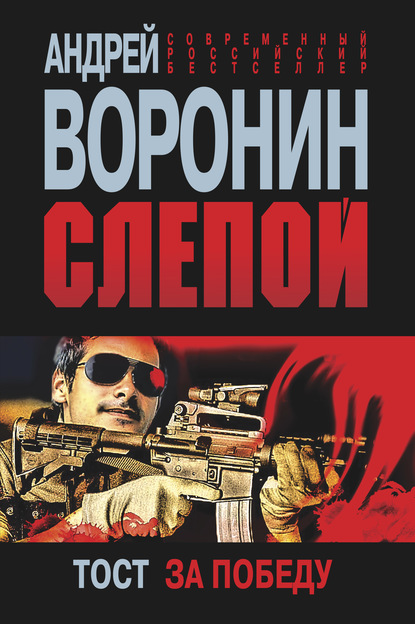- -
- 100%
- +
Früher bezeichnete man die Kata als »unendliche Schätze« oder als »ungeschriebene Tradition«. Die Kata sind uns zusammen mit ihren Geheimnissen überliefert worden, welche die alten Meister der Kunst nicht immer klar anhand der Techniken erklären konnten oder wollten.7 Es ist wichtig, diese Geheimnisse selbst zu entdecken. Dies ist eine Frage des Trainings, des Willens und der Zuversicht.
Die Ausübung des Stils
Viele alte Kata haben ihren ursprünglichen Sinn verloren. Genauer gesagt, hat man ihn verloren, wie man eine Spur verliert: mangels Aufmerksamkeit oder mangels Verständnis. Meistens ist nur die äußere »Form«8 geblieben, die »Prägeform«, die zu nichts anderem dienen sollte, als dem Wesentlichen Gestalt zu verleihen. Dies ist der Grund, weshalb man auf keinen Fall zulassen darf, daß auch noch die Form verändert wird. Andernfalls wäre alles unrettbar verloren. Die Kata wäre dann nichts weiter als eine Art Gymnastik. Wenigstens die Form muß bleiben. Hartnäckig an der Ausführung der Kata festzuhalten, wie sie in einer Stilrichtung überliefert wurde, bedeutet, sich die Möglichkeit einer Rückkehr zur ursprünglichen Bedeutung offenzuhalten. Die Tür, die dies vielleicht eines Tages ermöglicht, darf sich nicht schließen. In einer Kata kann sich das kleinste Detail – insofern es ursprünglich ist – als wesentlich entpuppen. Als Teil des hinterlassenen Erbes kann es helfen, das Ganze zu verstehen. Es zu vernachlässigen, oder schlimmer noch, zu verändern, bedeutet, die Kata als Ganzes zu treffen. Die Stilrichtung ist so etwas wie ein Führer zu der Idee, die am Anfang der Kata stand. Es ist wahr, daß, selbst im Rahmen einer bestimmten Schule, der Stil sich mit der Zeit und in Abhängigkeit von den jeweiligen Experten entwickelt. Daß ein Experte eine Kata abwandelt, kann u. a. an seinem Körperbau, an bestimmten Vorlieben oder persönlichen Forschungen liegen. Mitunter entstehen auf diese Weise kuriose Mischformen, bei denen es schwierig ist, das Richtige wiederzufinden.
Immer jedoch wird die Kata zumindest ein physisches Training mit offensichtlichem Nutzen sein. Der Karateka lernt, seinen Körper zu beherrschen, bestimmte Rhythmen zu entdecken, die Atmung richtig einzusetzen, in jedem Augenblick das Gleichgewicht zu bewahren, Schnelligkeit, Kraft und Harmonie in den Bewegungen zu entwickeln. All dies geschieht auf Grundlage des Gedankenguts, das dem Stil zu eigen ist, dem die Kata zugehört. Man muß immer versuchen, bei der Ausführung so genau wie möglich an den Vorgaben der jeweiligen grundlegenden Stilrichtung zu bleiben, selbst wenn das schon bald zu physischen Schwierigkeiten oder mentalen Blockaden führen sollte. Die technische Perfektion ist die Bedingung für die Effektivität. Der Wille, bei seinem Stil zu bleiben, ist etwas Grundsätzliches, vor allem in den Anfangsjahren der Karatepraxis. Dennoch ist das nicht alles, und wenn man sich in dieser Hinsicht sein ganzes Leben lang einschränkt, so ist man dazu verurteilt, niemals zum Wesen der Kunst vordringen zu können.9
Der Geist der Kata
Ein Buch kann mehr oder weniger gut Techniken darstellen, es kann jedoch nicht dazu verhelfen, die tiefen Empfindungen zu entdecken, die für das echte Verständnis einer Kata notwendig sind. Dazu reicht es nicht aus, wie beim Kihon die Bewegungen zu lernen, sondern man gelangt dahin über den Rhythmus einer Kata. Die Kata ist eine Art Bewegungsalchemie, die für denjenigen, der sie exakt ausführt, das innere »gewisse Etwas« wiederentstehen läßt, das jemand eines Tages in einem bestimmten Moment empfunden und für hinreichend wichtig gehalten hat, daß er versuchte, es weiterzugeben. Die Kata ist auch ein Ritus, ein Tanz, über den versucht wird, ein Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Doch damit diese Magie funktioniert, bedarf es mehr als nur der äußeren Form, selbst, wenn diese exakt reproduziert wird. Man jenes »gewisse Etwas« nur selbst entdecken, es muß »erlebt« werden. Es würde nichts nutzen, darüber zu sprechen, zumal diese innere Empfindung eine Frage des Alters sowie des technischen und geistigen Niveaus des Karateka ist. In dieser Hinsicht ähnelt die Kata den Taolu des Wushu und generell der Orientierung aller »inneren Stile«.
Die Kata erinnert daran, daß zwischen den Dingen, zwischen der Erscheinung und der Wirklichkeit, ein unsichtbares Band existiert. Suchen muß man es selbst. Es gibt die offenkundige Bewegung, und es gibt ihren verborgenen Sinn. Es ist möglich, an der Ausführung der Bewegung zu erkennen, zu welchem Grad des Verstehens der Praktizierende vorgedrungen ist. Die Kata kann, je nach Niveau des Ausführenden, stereotype, leblose Gymnastik sein oder eine fortwährende, lebendige Schöpfung. Sie erinnert all jene, die zu »sehen« in der Lage sind, daran, daß das Karatedô in erster Linie eine Suche nach der so komplizierten Verbindung zwischen dem Menschen und dem Universum ist, eine Hymne an die universelle Harmonie und den Frieden. Letzteres ist im übrigen auch der Grund dafür, weshalb die erste Bewegung jeglicher Kata generell eine Abwehr ist. Dies bedeutet, daß man sich auf den Kampf nur dann einläßt, wenn dies vollkommen unumgänglich ist. Funakoshi Gichin brachte diesen Gedanken mit den folgenden Sätzen zum Ausdruck: »Im Karate entsteht keinerlei Vorteil durch einen ersten Angriff«. »Im Karate gibt es keinen ersten Angriff« (»Karate ni sente nashi«).
Das Panorama der Kata
Die Entwicklung des Karate und die Vervielfältigung der Stilrichtungen hat zur Entstehung von mehr und mehr Kata geführt – ein Zustand, der den Anfänger leicht verwirren kann. Doch von all den Kata sind nur etwa 30 als ursprünglich anzusehen, d. h., daß sie spätestens im 19. Jahrhundert entstanden sind und oft eine chinesische Form zum Ursprung haben. Von diesen wiederum sind ca. 20 von grundlegender Bedeutung. Alle anderen Kata resultieren entweder aus Zerstückelungen alter Kata, aus Verallgemeinerungen von Techniken, oder sie sind das Ergebnis von mehr oder weniger starken (und mehr oder weniger gerechtfertigten) Veränderungen ursprünglicher Kata. Etliche wurden auch von zeitgenössischen Experten neu geschaffen.
Zu der Zeit, als das Karate noch ausschließlich auf der Insel Okinawa zu finden war – man nannte es damals Okinawa-te, die okinawanische Hand, oder Tô-de, die kontinentale Hand, was sich auf Festland-China bezog –, gab es noch keine Stilrichtungen im heutigen Sinne. Vielmehr existierten zwei wesentliche Strömungen, das Naha-te, für das Meister wie Higashionna und später Miyagi stehen, und das Shuri-te, vertreten durch Meister wie Matsumura, Itosu, Azato, Niigaki und später Funakoshi. Das Tomari-te Meister Matsumora Kôsakus war nur eine kleinere Nebenströmung, die zudem dem Shuri-te sehr nahe war und demzufolge diesem oft gleichgesetzt wird. Die Besonderheiten der zwei Hauptströmungen des Okinawate, der Mutterformen sämtlicher Karatestile, die heute weltweit existieren, fanden sich deutlich erkennbar in ihren Kata wieder. So lag im Naha-te die Betonung auf Kraft, Stabilität, geringen Ortsveränderungen und auf der Atmung, während im Shuri-te größere und geschmeidigere Ortsveränderungen, Ausweichtechniken und schnelle Techniken dominierten.
Man weiß, daß Funakoshi Gichin als erster dem Begriff Kara-te seinen heutigen Sinn, »leere Hand«, verliehen hat. Mit anderen Schriftzeichen geschrieben, kann Kara-te auch als »chinesische Hand« interpretiert werden; diese Interpretation war vor Funakoshis Neuinterpretation die übliche. Der Geniestreich des Meisters bestand darin, daß er mit einem Wort sowohl den Kampf mit der bloßen Hand ausdrückte, als auch den Begriff der »Leere« ins Spiel brachte, was als Abwesenheit jeglicher schlechter Absicht aufgefaßt werden kann – dies ist der philosophische Sinn des Karate. Zugleich ließ er dabei den chinesischen Einfluß vergessen. Dies war wichtig, da man in Japan in der Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert allem Chinesischen gegenüber sehr mißtrauisch war – China galt als »Erbfeind«. Funakoshi ging jedoch noch weiter: Um es den Japanern zu erleichtern, eine fremde Technik zu akzeptieren und ihre Empfindlichkeiten zu schonen, veränderte er die Namen der traditionellen Kata, die er aus Okinawa mitgebracht hatte und die zuvor fast allesamt vom chinesischen Einfluß gezeugt hatten. Dies führt heute mitunter zu Verwirrung, zumal sich teilweise auch technische Einzelheiten geändert haben: Die Übernahme der Kata durch die Japaner brachte technische Veränderungen oder gar Abwandlungen des Gesamtkonzepts der Kata mit sich. Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den modernen japanischen Formen und den alten okinawanischen Kata sind mehr oder weniger ausgeprägt. Manche sind einander noch sehr ähnlich, bei anderen hat man sich größere Freiheiten genommen, und die ursprüngliche Grundgestalt ist nur noch schwierig zu erkennen. Die modernen Kata, d. h., Formen, die nach den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden, sollen hier nicht behandelt werden. Ihr Nutzen ist vergleichsweise vernachlässigbar gegenüber jenem, den man aus den alten Kata ziehen kann.10
Die folgenden Kata sind die wichtigsten der aus den beiden Hauptströmungen des Okinawa-te überlieferten. Die heutigen japanischen Namen stehen in Klammern.
Aus dem Naha-te (später Shôrei-ryû), der Schule Meister Higashionnas, stammen die Kata Seishan (Hangetsu), Seienchin (Saipa), Sanchin, Sanseru, Sûpârinpai (Sûpârimpai), Kururunfa, Shisôchin, Sôchin, Jitte (Jutte), Jion und Naihanchi (Tekki). Die Kata Tenshô und Gekisai wurden erst später durch Miyagi Chôjun geschaffen.
Aus dem Shuri-te (später Shôrin-ryû) stammen die Kata Pinan (Heian), Kûshankû (Kankû), Wanshu (Enpi), Chintô (Gankaku), Passai (Bassai), Useishi (Gojûshiho), Rôhai (Meikyô), Chinte, Jiin und Wankan aus der Schule von Meister Itosu, und die Kata Niseishi (Nijûshiho) und Unsu (Unsui) aus der Schule von Meister Niigaki.
Die fünf Pinan-Kata wurden 1907 durch Itosu Ankô geschaffen, in der Absicht, sie für die Ausbildung im okinawanischen Schulwesen zu verwenden, wo Karate als Körperertüchtigung im Lehrplan stand. Als Grundlage hierfür verwendete er die Kata Kûshankû und Bassai. Funakoshi Gichin übernahm sie später in seinen Shôtôkan-Stil, wobei er sie in Heian umbenannte und einige Modifikationen vornahm. Nach 1930 trennte Ôtsuka Hironori sich von Meister Funakoshi, bei dem er Karate studiert hatte, und gründete den Stil des Wadô-ryû. Er gab den fünf Kata wieder ihren ursprünglichen Namen und kehrte auch hinsichtlich der Techniken teilweise zu den alten Formen der Pinan zurück.
Um 1940 entwickelte Nagamine Shôshin zusammen mit Miyagi Chôjun, dem Gründer des Gôjû-ryû, die Kata Fukyu shôdan und Fukyu nidan.11 Diese Formen waren für Anfänger gedacht, auf die die Schwierigkeiten der Pinan-Kata allzu abschreckend wirkten. Die Shôdan-Form ähnelt im übrigen stark der Taikyoku shôdan, aber die Positionen sind wesentlich höher. In der gleichen Absicht wurden im Shôrin-ryû die Kata Gekisai, Gekiha und Kakuha entwickelt.
Nach der großen Auswanderungswelle der Experten in verschiedene Länder und dem Ende des »feudalen« Karate, das durch den direkten Unterricht des Schülers durch den Meister charakterisiert war, kam es natürlich zu Veränderungen der ursprünglichen Stile. Dies war unausweichlich bei einer Lehre, die allein auf mündlicher Weitergabe beruht. Eine wichtige Rolle spielten in diesem Zusammenhang Unterschiede in den Auffassungen und nicht zuletzt auch im Körperbau der Experten. Doch die audiovisuellen Techniken mit ihren Vergleichsmöglichkeiten haben die zerbrechlichen Schranken zwischen den Stilen zu Fall gebracht, und somit ist heute die »Stunde der Wahrheit« für die Kata gekommen. Der beste Garant für Qualität sind alte Kata, die die Zeiten überdauert haben und die durch Meister mit starker Persönlichkeit bewahrt, weitergegeben und verteidigt wurden. Es ist angeraten, modernen Kata und allen persönlichen Interpretationen gegenüber mißtrauisch zu sein, zumindest, wenn sie von sehr jungen Experten stammen.
Früher wurden die Kata entsprechend ihrer Zielsetzung klassifiziert. So gab es Kata für die Muskelentwicklung, für die Entspannung, Atmemkata, Kata, durch die Schnelligkeit trainiert wurde, Kata mit dem Schwerpunkt auf Blocktechniken usw. Seit es in den Karateklubs jedoch um die »Weiterentwicklung« nach Plan geht, werden sie entsprechend ihrem Schwierigkeitsgrad eingeordnet. Dies führt zu verschiedenen Irrungen: So vernachlässigen oftmals Träger des 1. und selbst schon des 2. Kyû willentlich die fünf Pinan-Kata, die als »geringer« eingeschätzt werden, um sich die »interessanteren« und ihrem Rang angemessener erscheinenden Kata Kankû oder Bassai anzueignen, ohne sich der diesen Kata innewohnenden Fehler bewußt zu sein.
Shitei kata
Als Funakoshi Gichin 1922 nach Japan kam, brachte er lediglich 15 Kata mit sich: die fünf Heian, die drei Tekki, Bassai dai, Kankû dai, Jion, Jutte, Enpi, Hangetsu und Gankaku. Die anderen heute im Shôtôkan-ryû praktizierten Kata wurden später hinzugefügt. Manche davon wurden anderen Stilrichtungen entnommen, die heute die Herkunft für sich reklamieren. Das führt nicht selten zu Konflikten hinsichtlich der »Orthodoxie« der Kata.
Um in dieser Hinsicht mehr Klarheit zu gewinnen und um gemeinsame Nenner für die vielen »Katameisterschaften« zu finden, schuf man im Jahre 1986 das System der Shitei kata: Jeder der vier Hauptstile sollte seine beiden repräsentativsten und bekanntesten Kata auswählen, die als Grundlage für Meisterschaften dienen sollten und darüber hinaus auch für die offiziellen Lehrsysteme der Stile und die entsprechenden Gürtelprüfungen. Die folgenden Kata wurden ausgewählt:
Für den Shotokan-ryû die Kata Jion und Kankû dai, für den Wadô-ryû die Kata Seishan und Chintô, für den Shitô-ryû die Kata Seienchin und Bassai und für den Gôjû-ryû die Kata Seipai und Saifa.
Bunkai
Jede Bewegung einer Kata hat ihren Sinn, ihre Interpretation: das Bunkai. Mitunter ist das Bunkai offensichtlich, manchmal schwer zu erkennen, mitunter sogar trügerisch. Die jeweilige Vorläufer- und Nachfolgetechnik kann helfen, es aus dem Ablauf heraus zu verstehen, aber auch das Niveau des Praktizierenden – vor allem das geistige, weniger das physische – ist für das Verständnis von Bedeutung. Jeder Karateka, der hinreichend lange trainiert, wird erkennen, daß seine Möglichkeiten, die Bunkai zu begreifen, sich mit der Zeit verändern. Zunächst unverständliche Sequenzen in den Kata werden nach einigen Jahren der Praxis und des Nachdenkens immer klarer. Zu Beginn muß man sich mit dem vorgegebenen Schema zufriedengeben. Dieses erscheint einem schon bald als unvollständig, und doch muß man sich lange Zeit gründlich damit befassen, sich genau danach richten. Später wird einem das Schema der Bunkai als eine Möglichkeit von mehreren erscheinen, und eines Tages hat man sein persönliches Bunkai gefunden – doch ohne auch nur das mindeste an den Techniken selbst zu ändern! Man darf nicht vergessen, daß die Kata auch eine Art Rätsel ist, damit, auch wenn man sie unermüdlich wieder und wieder übt, der Geist niemals einschlummert. Es gibt sogar echte Fallen, die den Praktizierenden von wirklichem Verständnis abhalten, doch auch diese erkennt man erst mit der Zeit. Dies ist Teil der fernöstlichen Lehrprinzipien und kann unserer westlichen Geisteshaltung als übertrieben erscheinen. Doch solche Dinge selbst zu entdecken, allen Widrigkeiten zum Trotz, ist ein unvergleichlicher Lohn.
Man sollte niemals eine Bewegung einer Kata ausführen, ohne dabei das entsprechende Bunkai im Sinn zu haben, und dies wiederum entsprechend dem erreichten Niveau. Es ist aber wichtig, immer weiter zu forschen. Mit der Zeit wird das Bunkai sich ändern. Es ist auch von Vorteil, von Zeit zu Zeit Bunkai kumite zu üben, bei dem zusammen mit einem Partner bestimmte Kata-Passagen praktiziert werden. Dabei sollte man so nah wie möglich an der Kata bleiben. Ist einem das nicht möglich, so sollte man lieber ein anderes Bunkai auswählen. Niemals sollte man sich jedoch berechtigt fühlen, die Kata zu verändern! Es gibt keine zwei Arten Karate, eine für den Kampf und eine der Kata. Tatsächlich existiert für jede Technik eine praktische und realistische Anwendung. Doch vor allem darf nie vergessen werden, auch das zu suchen, was sich hinter der Technik verbirgt.
Hito kata san nen
Dieser im Budô gebräuchliche Ausdruck bedeutet »eine Kata in drei Jahren«. Sein Sinn ist klar: Man studierte eine Kata mindestens drei Jahre lang, bevor man sich der nächsten zuwandte. Auch im chinesischen Boxen gibt es einen alten Sinnspruch, der besagt, daß man drei Jahre braucht, um die Position zu erlernen, drei weitere Jahre, um sich die eigentliche Technik anzueignen und schließlich noch drei Jahre, um ein Gefühl für die Bewegung zu entwickeln. Solche Formulierungen stellen zwar bewußte Übertreibungen dar, aber sie sollen verdeutlichen, daß die oberflächliche Annäherung an eine Kata nutzlos ist. Früher war es üblich, daß große Experten nicht mehr als drei oder vier Kata in ihrem Leben kennenlernten. Dies war mehr als ausreichend, um alles zu finden, was es darin zu entdecken gab. Es kann interessant sein, eine Vielzahl Kata zu kennen, da durch den Vergleich manches klarer werden kann und sie einander ergänzen können, aber tiefgründig sollte man sich nur mit einigen wenigen befassen, und dies das ganze Leben hindurch. Diese bevorzugten Kata sind die Tokui kata, die Lieblingskata des Karateka. Es geht nicht darum, alles über alle Kata zu erfahren – was zudem eine unmöglich zu lösende Aufgabe wäre. Es ist schon eine große Herausforderung und ehrgeizig genug, über eine einzige wichtige Sache alles herausfinden zu wollen. Je enger eine Tür erscheint, desto mehr wird man sich mühen, einzudringen.
Praktische Ratschläge
Meister Mabuni Kenwa, der Gründer des Shitô-ryû, schrieb, daß es drei wesentliche Punkte bei einer Kata gibt: die vollendete Art der Ausführung, die beständige Kontrolle der Atmung und die Beherrschung des Schwerpunktes – zu all diesem sollte das innere Empfinden hinzukommen.
Atmung und Rhythmus
Auf jeden Fall muß man den Atem und die Bewegung miteinander in Einklang bringen. Eine schlechte Koordination führt schnell zu wachsender Erschöpfung, man wird schwächer, langsamer und verliert schließlich die Kontrolle über die Gefühle, die einen bei einem Kampf überkommen können – Angst, Wut, instinktive Reaktionen – und die, indem sie sich auf den Herzrhythmus auswirken, die eigene Handlung stören. Die Atmung ist offensichtlich mit dem der Kata innewohnenden Rhythmus verbunden, oder sie richtet sich nach persönlichen Auslegungen. Darüber in einem Buch zu sprechen ist schwierig, aber dennoch sollen hier einige Ratschläge mit Bezug auf bestimmte Atemphasen erteilt werden, doch diese sind keineswegs immer zwingend. Vieles ist möglich, doch alles hängt dabei vom Niveau des Praktizierenden ab.
Die erste Stufe besteht darin, daß jedesmal, wenn man eine Technik ausführt, kurz ausgeatmet wird, sei es bei der Verteidigung oder beim Angriff (Kime12). Dabei verharrt man kurz, was die Muskelkontraktion erleichtert. Am Beginn der Bewegung atmet man hingegen ein, was Entspannung und Schnelligkeit befördert. Doch auf einer fortgeschritteneren Stufe kann es interessant sein, genau das Gegenteil davon zu tun. Dies ist jedoch Bestandteil jener »Schlüssel für das Verständnis«, von denen weiter oben die Rede war. Eine leichter zu bewältigende Zwischenstufe kann darin bestehen, daß man bei einer Blocktechnik einatmet, so daß man sich dabei gewissermaßen ausdehnt, und bei einer Angriffstechnik ausatmet, wodurch man die Fokussierung der Kräfte begünstigt. Dennoch muß man zunächst mehrere Jahre lang auf der ersten Stufe verweilen, da diese den Vorteil hat, daß jede Bewegung durch den Atem verstärkt wird, indem das Kime erleichtert wird. Je nach dem Rhythmus und dem Umfang einer Technik gibt es fünf grundlegende Arten zu atmen:
a) Bei normalem Atem, ohne Unterbrechungen ( Jusoku )
1) Langes Einatmen – langes Ausatmen
2) Langes Einatmen – kurzes Ausatmen
3) Kurzes Einatmen – langes Ausatmen
4) Kurzes Einatmen – kurzes Ausatmen
b) Atmung mit Luftanhalten ( Taisoku )
5) Einatmen – Luft anhalten (Kontraktion) – Ausatmen; oder: Ausatmen – Luft anhalten (Kontraktion) – Einatmen
Es ist auch möglich, an verschiedenen Stellen der Kata »stoßweise« ein- oder auszuatmen. Man atmet stets durch die Nase ein, wobei der Mund geschlossen ist, und durch den halb offenen Mund aus. Die Atmung muß eine tiefe, aus dem Hara13 kommende Bauchatmung sein.
Manche Kata können von Shigin begleitet werden, d. h., man rezitiert japanische Gedichte oder singt sie – letzteres vor allem bei den Atemkata des Gôjû-ryû, wie z. B. Sanchin oder Tenshô. Das hat keine künstlerische Bedeutung sondern soll bestimmte Muskelkontraktionen erleichtern, indem man auf diese Weise besser die Atmung kontrolliert. Der Kiai14 muß auf sehr natürliche Weise erfolgen, wenn die Atmung richtig ist.
Ortsveränderungen
Jede Kata wird entlang bestimmter Grundlinien ausgeführt, Embusen genannt. Zudem hat sie einen zentralen Punkt, das Kiten. Genau genommen sollte jede Kata mit dem Gesicht nach Norden beginnen und enden, was auch für die Taolu des Wushu oder für das Taijiquan gilt. Doch dies wird heute nur noch sehr selten berücksichtigt, bzw. ist sogar in Vergessenheit geraten. Die Verbindung der Kata mit den vier Himmelsrichtungen und damit dem Universum erinnert an die ursprüngliche Absicht, die Bewegungen in Zusammenhang mit einem Regenerationszyklus kosmischer Kräfte zu bringen. Der Ursprung dieser Herangehensweise stammt aus China. Im modernen Karate ist man sich dessen nicht mehr bewußt.
Generell ist auch der Anfangsort der Kata derselbe, an dem die Kata endet. Man berücksichtige, daß der Karateka hier mit Blick zum Shômen steht. Hierauf werden sich auch die Beschreibungen der Bewegungsabläufe auf den folgenden Seiten beziehen.
Inneres Empfinden
Es geht darum, beim Ausüben einer Kata unaufhörlich das Gefühl zu haben, sich im Kampf zu befinden. Man muß versuchen, jeden Abschnitt der Kata zu verstehen. Es gibt eine ständige Wechselbeziehung zwischen dem inneren Verstehen einer Kata und der Meisterung ihrer äußeren Form. Jede Bewegung, jeder Rhythmuswechsel, jeder Stop erklärt sich aus dem Gesamtzusammenhang und tritt genau im richtigen Moment auf. Man muß den Rhythmus der Kata suchen und respektieren, sei er langsam oder schnell. Dies gestattet einem, den »Augenblick am Schopf zu fassen«, den Gegner zu übertrumpfen. Es gibt keine Stillstandzeiten. Selbst, wenn einem die Kata einen Augenblick des Innehaltens auferlegt, muß man dabei einen wachen und aufmerksamen Geist (Zanshin15) bewahren. Hinter jedem ausgeführten Schlag steht immer der Geist, der ihn beabsichtigt. Man sagt, daß sich der Geist zu Beginn »in allen vier Ecken« befindet – unfokussiert, aber bereit, in jeder Richtung einzugreifen. Doch mit der ersten Bewegung der Kata richtet er sich durch den ersten Gegner hindurch aus, ohne aber vollständig die Aufmerksamkeit aus den anderen Richtungen abzuziehen. Am Ende der Kata verweilt der Geist noch ein wenig beim letzten, besiegten Gegner, bevor er sich entspannt. Die Bewegungsfolgen müssen von ein und derselben Empfindung durchdrungen sein: Angreifen, kontern, blocken – alles erfolgt mit dem Gefühl, den Gegner zu umwickeln, sich an ihn zu heften, bis zum Ende, und ihn allein durch den Geist zu besiegen. Zumindest sollte man nicht an die Technik, die man gerade ausführt, denken, sondern an jene, die folgen (könnten). Durchlebt man eine Kata auf diese Weise, geht es in erster Linie um den Kampfgeist und erst in zweiter Linie um die Einzelheiten der Positionen. Der Blick ist scharf, flink und entschlossen und in Richtung der Handlung ausgerichtet. Er begleitet die Aktionen unaufhörlich, nimmt sie oftmals voraus und wird niemals gesenkt, auch nicht, während man sich umwendet. Das Gesichtsfeld muß so weit wie möglich sein. Dies erreicht man, indem man keinen bestimmten Punkt fixiert. Der Blick ist sozusagen »auf ein weit entferntes Gebirge« gerichtet; man sieht durch den Gegner »hindurch« (Enzan no metsuke)16 .