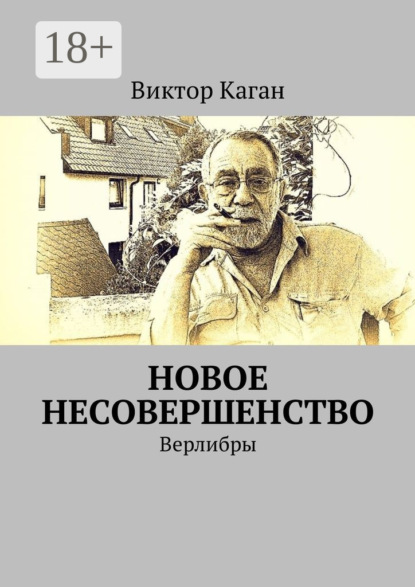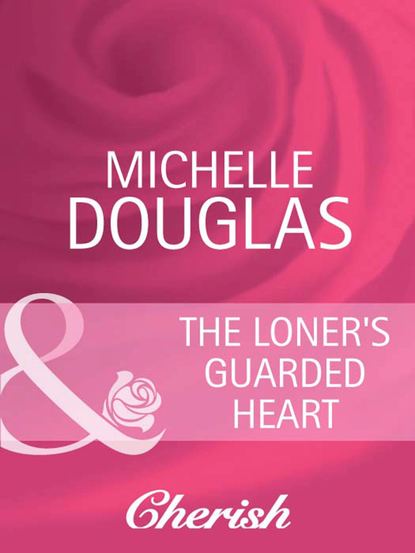- -
- 100%
- +
„Auf Afrika“, sagte er.
„Auf Afrika.“
Ich versuchte, sein Alter zu schätzen. Irgendwas zwischen fünfundzwanzig und dreißig. Die Baseballkappe bedeckte den oberen Teil seines Gesichts und da er kleiner war als ich, musste ich mich dauernd hinabbeugen, um ihm in die Augen zu sehen. Er war meist im Aufbruch begriffen, von Stockholm nach Stuttgart nach Potsdam gezogen und nun in Berlin gelandet. Berlin gefalle ihm am besten.
„Sogar in Berlin sehne ich mich nach Berlin“, erklärte er mir an diesem Tag. Er war nur noch theoretisch Student, nicht mehr immatrikuliert, was mit den Studiengebühren zu tun und Auswirkungen auf seinen Aufenthaltsstatus hatte oder demnächst haben würde, weshalb er mit einigen Freunden die alte Kirche in Kreuzberg besetzt hatte. Für ein Taschengeld jobbte er gelegentlich für crew.com, einer Organisation für arbeitslose Schauspieler und Filmtechniker. Aber sein letzter Einsatz dort war schon länger her. Das alles erzählte er mir nicht damals in der Bar der Galerie, sondern später, auf mehrere Treffen verteilt. Er sah recht heruntergekommen aus, fast verwildert, seine schwarzen Converse waren dreckig und verschlissen, aber die von ihm ausgehende Lässigkeit zog mich an.
Als ich nach meinem zweiten, seinem dritten Bier meinte, ich müsse jetzt los, schlug er vor: „Komm, ich stell dich meinen Freunden vor, wir wohnen gleich um die Ecke.“
Ich folgte ihm hinaus in die Nacht. Mark schritt selbstbewusst voraus, einmal schlängelte er sich zwischen den Autos auf die andere Straßenseite durch, hob dabei matadorgleich die Hand, um einen Wagen zum Stehen zu bringen, der ihn fast umgefahren hätte. Unberührt vom lauten Fluchen der angetrunkenen Fahrer blieb er auf dem gegenüberliegenden Gehweg stehen und winkte mich ungeduldig herüber. Ich wartete, bis die Ampel auf Grün schaltete, und war nicht sicher, ob ich seine halsbrecherische Selbstsicherheit beeindruckend oder erschreckend finden sollte.
„Das ist ja eine Kirche“, entfuhr es mir halb fragend, halb konstatierend, als er das Törchen öffnete und mich hereinwinkte.
„Ja, hier leben wir momentan. Vorübergehend.“
Alle drei Mitbewohner waren anwesend. Eric, Stan und Uta. Ich nickte ihnen zu und setzte mich neben Mark. Auf Marks Bemerkung, ich sei ebenfalls Afrikaner, erzählte mir Uta sofort, ihre Mutter stamme aus Kamerun, ihr Vater sei Deutscher. Sie lag auf dem Sofa, die Beine in Stans Schoß, Stan neben ihr saß halb, lag halb und seine langen Dreadlocks fielen über seine Schultern und die Sofalehne. Wir befanden uns im sogenannten Wohnzimmer, das im Keller lag und wo früher die Sonntagsschule abgehalten worden war. An einer Wand hing eine Tafel, davor stand ein hölzernes Lesepult. Auf einem zerkratzten Kieferntisch, in dessen Maserung sich Schmutz abgelagert hatte, standen Bierflaschen. Mark machte mir eine auf. Eric hielt in der einen Hand einen Joint, mit der anderen surfte er mit einem Laptop im Internet.
„Was machst du so?“, fragte Uta in ihrem stockenden Englisch.
„Daheim in den USA unterrichte ich. Hier auch.“ Einmal die Woche gab ich den Zimmer-Fellows, die kein Englisch sprachen, Englischunterricht. Uta studierte an der Freien Universität und schrieb gerade an einem Roman.
„Einem Roman?“
„Der Roman ist tot“, verkündete Mark. „Das Kino ist die Gegenwart und die Zukunft.“
„Ist das dein Ernst?“
„Ein Film ist wie ein Roman, bloß ohne die langweiligen Stellen.“
Ich zog am Joint, der irgendwie in meine Hand gewandert war. Mir wurde schwindlig.
Das Gespräch mäanderte dahin, versiegte in nachdenklichem, nie bedrückendem Schweigen, ehe es wieder aufgenommen wurde und in eine völlig andere Richtung floss. Eric erzählte von der letzten Demonstration, an der sie teilgenommen hatten. Sie waren in Davos und bei verschiedenen G20-Treffen überall auf der Welt gewesen.
„Gegen was demonstriert ihr?“, wollte ich wissen.
Überrascht starrten sie mich an.
„Mann, gegen alles natürlich“, sagte Stan.
„Gegen alles?“
„Wir sind der Meinung, dass es eine Alternative zu der Art und Weise geben sollte, wie die Welt momentan regiert wird“, sagte Eric.
„Eine Minorität, die über die Majorität des Geldes verfügt“, ergänzte Uta.
„In Asien müssen Millionen unter menschenverachtenden Bedingungen schuften. In vielen Ländern Afrikas herrscht Krieg“, sagte Stan.
„Im 21. Jahrhundert sollte kein Kind mehr verhungern oder durch Krankheit sterben müssen“, sagte Uta.
Ich nickte. Ich hatte schon andere junge Leute wie sie in Berlin getroffen, bei Lesungen, in der S-Bahn, Männer und Frauen in ausgefransten Pullovern und abgerissenen Jeans, die meistens in einer Kommune in leerstehenden Gebäuden wohnten, eine alternative Lebensweise vertraten, sich oft nicht einig waren, wie nun diese Alternative genau aussehen sollte, eben eine Alternative zum Istzustand, sonst wäre die Sache ja sinnlos. Ich trank und rauchte, hörte zu. Auf einmal stellte sich Mark hinter den Altar und las eine Bibelstelle vor. Sein Vater war Pfarrer und er machte sich über dessen Predigtstil lustig. Mit erhobenen Händen stand er da, verdrehte die Augen und donnerte: „Der Sommer ist dahin, die Ernte ist vergangen, und uns ist keine Hilfe gekommen …“
Die anderen klatschten. Ich war mir nicht sicher, ob in Marks Stimme Selbstironie mitschwang, oder ob sich in seinem Gesicht nicht sogar echter Schmerz abzeichnete, als er sich zum Applaus verbeugte, bevor er sich wieder hinsetzte. Sie erzählten, wie er, als er vor einem Monat hier eingezogen sei, die Kirche entwidmet habe. „Ein Ort, der heimgesucht war. Ich konnte die Geister überall spüren“, erklärte er.
„Wie entwidmet man eine Kirche?“, wollte ich wissen.
„Mit Alkohol. Man gießt Alkohol in die Ecken und liest bestimmte Stellen, von deren Wirkung nur Eingeweihte wissen, laut aus der Bibel vor.“
Selbst in meinem angesäuselten und angekifften Zustand spürte ich, wie vergänglich diese Phase war. Wie lange noch, bis sie die Welt so sahen, wie sie wirklich war: niederträchtig, grausam, gleichgültig und nicht zu verändern? Wie lange würde es dauern, bis sie aus ihrem bröckelnden Elfenbeinturm auszogen und sich der restlichen Menschheit anschlossen, die, wie Flaubert sagt, in einem Meer von Scheiße schwimmt, das erbarmungslos an die Mauern jedes jemals erbauten Elfenbeinturms schlägt. Eines Tages würden sie sich rasieren und Banker werden oder zum mittleren Management gehören, BMW und Mercedes fahren; sie würden eine Familie gründen und sich mit leeren Machtsymbolen umgeben, genau jenen Dingen, die sie jetzt verhöhnten. Aber jetzt, jetzt in diesem Moment waren sie frei und rein wie der Morgentau auf einem Blütenblatt und ich fühlte den Drang, mich vorzubeugen und den Duft dieser Blume einzuatmen.
Deshalb ging ich immer wieder nach Kreuzberg zu dieser heruntergekommenen Kirche mit der verdrehten Spitze. Ich ging sogar auch dann noch hin, als ich herausfand, dass ihre Bewohner überhaupt nicht zum geknechteten Proletariat gehörten, mit dem sie sich so sehr identifizierten: Utas Eltern waren Ärzte aus dem ehemaligen Ost-Berlin, Stan bastelte an der Humboldt-Uni an seiner Dissertation, er war im Senegal aufgewachsen, wo sein Vater für einen internationalen Lebensmittelkonzern arbeitete, seine Mutter war Malerin. Auch waren sie nicht so jung wie sie wirkten. Keiner von ihnen war unter dreißig, Mark war mit genau dreißig der Jüngste, Uta einunddreißig, auch wenn sie wie zwanzig aussah, Stan zweiunddreißig, Eric fünfunddreißig und verheiratet, lebte allerdings getrennt von seiner Frau, die mit der gemeinsamen Tochter in Mannheim wohnte.
4
Dann wurde es Mai. Mark und seine Freunde luden mich zur Mai-Demonstration ein. „Das wird dir gefallen“, sagte Mark. Die Proteste am 1. Mai seien eine Tradition, die ich einmal miterleben müsse, meinten sie. Junge Leute, die Ladengeschäfte und Regierungsgebäude stürmten, Autos umwarfen und sie gelegentlich auch anzündeten, um den Status quo anzuprangern.
An diesem Tag ging die Kreuzberger Polizei frühzeitig auf Streife, schwärmte vom Hermannplatz bis zum Moritzplatz aus. Sie trug Schutzausrüstung samt kugelsicheren Westen, riegelte mit Streifen- und Mannschaftswagen einige Straßen ab, zu denen nur noch Anwohner mit Ausweis freien Zugang hatten. Um diese Absperrungen zu vermeiden, traf ich rechtzeitig vor Demonstrationsbeginn bei der Kirche ein. Alle standen schon in Stiefeln und Jeans abmarschbereit an der Tür. Mark unterhielt sich mit einer jungen Frau, die ich noch nie gesehen hatte, seiner Freundin Lorelle. Ich musste mich zusammenreißen, um die Nadeln und Ringe, die sie in Lippen, Nasenflügeln, Wangen und Augenbrauen trug und ihr Gesicht wie ein Nadelkissen aussehen ließen, und ihr Zungenpiercing nicht offen anzustarren. Das musste doch wehtun. Bestimmt verbargen sich unter ihrem ausgebeulten Sweatshirt noch weitere Piercings. Auf ihrer linken Wange prangte ein Mandala-Tattoo, dessen Rosa- und Blautöne ihr Gesicht wie ein Neonlicht erleuchteten. Ihr Haar, auf einer Seite vollständig abrasiert, war über den blonden Ansätzen ebenfalls ein Mix aus rosa und blau. Ich gab ihr die Hand.
„Nett, dich kennenzulernen“, sagte sie. „Mark hat mir viel von dir erzählt.“
Ihr Händedruck war fest. Ihre Stimme entsprach so gar nicht ihrem Äußeren, warm und leise, mit starkem amerikanischem Akzent. Sie war Amerikanerin, jedoch in Heidelberg geboren. Ihre Eltern waren bei den US-Streitkräften, mittlerweile zurück in die Staaten versetzt, sie war hiergeblieben, weil ihr das Leben in Deutschland besser gefiel. Wie Mark studierte sie Film.
Wir gingen durch Parks und Nebenstraßen, wichen den herumfahrenden Mannschaftswagen und größeren Menschenansammlungen aus. Unser Ziel war ein türkisches Café, dessen Inhaber Schwarzen keinen Zutritt gewährte, weil er der Meinung war, es seien alle Illegale und Drogendealer. Eine erstaunlich große Menge hatte sich bereits davor versammelt. Junge Leute in Jeans, Stiefeln oder Turnschuhen, manche hielten Transparente hoch, andere ihre Handys, weil sie die Demo aufnehmen wollten, taten das auch während sie in die Sprechgesänge einstimmten. Wir schlossen uns an, warfen Steine auf die Polizisten, die sich schützend vor das Café gestellt hatten, dessen Inhaber hinter der Theke kauerte. Wir marschierten um den Block, immer wieder, brachten den Verkehr zum Erliegen. Gegen Mittag war ich müde, hungrig und allmählich gelangweilt. Drüben schwenkten Mark und Uta, die in ihrer abgeschnittenen Jeans und dem feuerroten Halstuch sehr hübsch aussah, nebeneinander ihre Plakate wie Köder in Richtung Polizei. Ich beschloss, eine Auszeit zu nehmen, ging über die Straße und bestellte in einer Bäckerei ein belegtes Brötchen und einen Kaffee. Gina hatte zweimal versucht, mich zu erreichen. Als ich das Haus um sechs Uhr verlassen hatte, hatte sie immer noch in ihrem Atelier gemalt und ich hatte ihr nicht gesagt, wohin ich ging. Ich rief sie an, doch sie nahm nicht ab – wahrscheinlich schlief sie. Draußen hatte sich in der kurzen Zeit, die ich in der Bäckerei gewesen war, die Demonstrantenmenge beinahe verdoppelt und die Anspannung ringsum stieg spürbar. Zeit, heimzugehen. Auf der Suche nach Mark, um ihm mitzuteilen, dass ich mich ausklinken würde, geriet ich plötzlich in eine Woge aus Körpern mit direktem Kurs auf die Polizisten, die in Reih und Glied mit erhobenen Schlagstöcken hinter ihren Schutzschilden standen. Steine, Flaschen und Dosen zischten über unsere Köpfe hinweg gegen die Schilde. Jemand rammte mir seine Schulter in den Rücken und ich stürzte. Als ich aufstehen wollte, stießen mir Knie ins Gesicht, traten mir Füße auf die Hände. Alles rannte, verfolgt von der Polizei. Mehrmals versuchte ich, mich aufzurichten, kam aber gegen die endlose Welle aus Knien und Beinen nicht an, die über mich hinwegrollte. Ich blieb am Boden, hypnotisiert von einem matt schimmerndem, im Gehweg eingelassenen Messingquadrat – einem der sogenannten Stolpersteine. Die waren mir schon öfter aufgefallen, ganze Lebensgeschichten standen darauf, Name, Lebensdaten, Tag der Deportation, Todesort. Vier Namen, die Hartmanns: Elisabeth, Markus, Lydia und Eduard. Alle kamen nach Sobibor, alle starben am selben Tag, am 5. Dezember 1944. Ich war geblendet vom Messingglanz, schockiert von der brutalen Gleichgültigkeit der Geschichte, hatte Tränen vom Tränengas in den Augen und konnte mich vor Erschöpfung nicht rühren. Jemand zerrte mich hoch und kurz wehrte ich mich, im Glauben es wäre ein Polizist, aber es war Mark. Er lächelte euphorisch. „Alles okay?“, fragte er. Ich stand auf. Meine Handflächen waren zerschunden und brannten, meine Hose hatte an den Knien Löcher.
„Alles gut.“
Aber schon war er wieder weg, schleuderte einen Stein auf die Polizeikette. Neben mir landete ein Tränengaskanister, der sofort von einem strubbelhaarigen Jugendlichen Richtung Polizei zurückgeworfen wurde, der Rauchbogen hing wie eine Gewitterwolke in der Luft. Rechts von mir rannte Lorelle direkt auf eine schildbewehrte Reihe Polizisten zu, nutzte ihr beträchtliches Gewicht als Rammbock. Natürlich wurde sie niedergeschlagen und zu einem Polizeibus geschleift, während sie kreischend um sich trat. Vom Tränengas benebelt, stand ich da, mir liefen Augen und Nase. Ich war allein auf einer winzigen Insel und um mich herum wütete und tobte das Meer in unbändiger Wut.
„Ich muss los“, erklärte ich Mark.
„Nein, jetzt noch nicht. Er ist da. Das ist unser historischer Moment“, sagte Mark und wedelte dabei mit den Armen. „Das ist unser Sharpeville, unser Agincourt.“
Fast hätte ich über seine Übertreibung gelacht. Welcher Moment, hätte ich gern gefragt, wird das hier tatsächlich die sogenannten Kapitalisten und Rassisten umstimmen und ewigwährende Liebe und Harmonie in die Welt bringen? Und trotzdem war ich wider Willen beeindruckt. „Mit deinem abgelaufenen Visum willst du nicht verhaftet werden. Komm, wir gehen“, sagte ich.
„Wo sind die anderen?“, fragte er.
„Ich weiß nicht. Lorelle haben sie abgeführt, das habe ich mitbekommen. Los jetzt.“
Wir entfernten uns, bogen aufs Geratewohl um diese Ecke, in jene Straße, bis Sirenen und Sprechgesang ein fernes Flüstern im Wind waren. Wir setzten uns in eine Kneipe und bestellten jeder ein Bier. Mein Handy klingelte, es war Gina, doch ich war zu müde und zu durcheinander, um ranzugehen. Wir tranken unser Bier aus, aber Mark war noch nicht in Aufbruchstimmung. Er bestellte ein zweites Bier.
„So muss es sein“, sagte er und schlug auf den Tisch. „Widerstand gegen das System.“ Wir tranken aus und bestellten noch eine Runde. Allmählich spürte ich, wie ich runterkam. Draußen gingen im Dämmerlicht die rauchgelben Straßenlaternen an. Der Tag war beinahe zu Ende. Ein Streifenwagen heulte vorbei, sein blitzendes Blaulicht vermischte sich mit dem Straßenlampengelb.
„Ich sollte nach Hause.“
„Ach, komm“, sagte Mark, der bereits betrunken wirkte, „ich geb noch eine Runde aus.“ Er bestellte einen doppelten Whisky.
„Für mich nicht. Beeil dich. Ich bring dich heim, dann bin ich weg.“
Auf dem Heimweg blieb Mark an einer Currywurstbude stehen. Ein junger Typ mit alkoholgerötetem Gesicht ließ sich, obwohl seine Freundin ihn am Arm weiterziehen wollte, neben uns auf die Bank fallen. Das Gesicht in den Händen beugte er sich vor. „Scheiße“, murmelte er unentwegt vor sich hin. Das Mädchen trug ein Cosplay-Outfit und viel Make-up, hatte ihre Augen mit Kajal auf mandelförmig geschminkt. Auf der anderen Straßenseite stand in einem düsteren Zugang ein Mann mit Hoodie, der die Vorübergehenden leise „Alles gut?“, fragte, ihnen dabei aber nie richtig in die Augen sah.
„Auf nach Hause, Mark.“
Da er nicht mehr gerade gehen konnte, legte ich seinen Arm über meine Schulter, musste mich dabei komisch verbiegen, weil er viel kleiner war als ich. So schwankten wir zur S-Bahn-Station. Als wir zur verlassenen Kirche kamen, war die Tür aus den Angeln gerissen und lag im Eingangsbereich. Die Lampen brannten. Die Stühle waren umgeworfen, Papiere auf Tischen und Boden verstreut.
„Verdammte Scheiße!“
„Was ist denn da passiert?“
„Keine Ahnung. Sieht aus wie eine Razzia.“
Mark ging von Raum zu Raum, stellte Stühle wieder hin und hob Bücher auf. Sein Zimmer lag am Ende des Flurs neben der Küche. Seine dünne Matratze war zerfetzt und beinahe durchgeschnitten. Sein Rucksack, der seine wenigen Habseligkeiten enthielt, lag geöffnet mitten im Zimmer.
„Was für Arschlöcher! Das war die Polizei, die hat uns schon seit einiger Zeit im Visier.“
„Wo sind die anderen?“
Achselzuckend sah er mich an. „Ich habe keine Ahnung.“
„Was willst du jetzt machen, wo willst du schlafen?“
„Ich komm schon klar.“ Besonders überzeugend klang das nicht.
„Warum gehst du nicht zu deiner Freundin?“
„Lorelle? Das geht nicht. Sie hat eine Mitbewohnerin. Aber he, mach dir keine Sorgen. Ich komm woanders unter. Ich komm klar.“
Ich wandte mich zum Gehen. Schwankend, den leeren Rucksack in der Hand, versicherte er mir, er komme schon klar, und dann fiel mir ein, dass er sowieso nicht bei Lorelle hätte unterschlüpfen können, weil sie festgenommen worden war. Ich war müde und zerschlagen, wollte nur noch heim, unter die Dusche und ins Bett.
5
Von Marks Verhaftung erfuhr ich erst eine Woche später, als ich bei der Kirche vorbeischaute. Sie wirkte anders als sonst, die Tür war wieder eingehängt und der Garten sah aus, als wäre jemand mit dem Rechen darüber gegangen. Unter einem Baum war sorgfältig Müll zusammengetragen worden, der nur noch in Abfalltüten gestopft werden musste. Auf mein Klopfen öffnete niemand. Ich drückte die Tür auf. Die schäbigen Sofas und Lampen waren verschwunden. Das Lesepult war noch vorhanden und mir fiel ein, wie Mark dahintergestanden und aus der Bibel vorgelesen, sich über seinen Vater, den Pfarrer, lustig gemacht hatte. Ich war traurig und auch ein wenig verletzt – sie waren ausgezogen, ohne mich zu informieren. Sie hatten meine Handynummer, zumindest Mark, er hätte mich ruhig anrufen können. Aber ihr Leben war ein einziges Provisorium, wahrscheinlich waren sie von der Polizei verjagt worden und hatten mittlerweile ein anderes Gebäude besetzt; vielleicht meldeten sie sich in ein, zwei Wochen, wenn sie sich dort eingerichtet hatten. Zumindest Mark. Mir ging auf, dass sie mir fehlten; mir fehlte es, abends, wenn Gina arbeitete, in der Kirche vorbeizuschauen und ihren Gesprächen zu lauschen, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigten, vom Klimawandel über abgefeimte Politiker bis hin zu Flüchtlingen, auch wenn ich die vier arroganterweise insgeheim naiv und hoffnungslos idealistisch fand. Jetzt musste ich mir eingestehen, dass sie sich zumindest über Andere Gedanken machten, nicht nur über sich selbst, willens waren, die Polizei mit Steinen zu bewerfen und für ihre Ideale sogar ins Gefängnis zu gehen – wie viele Leute waren dazu fähig? Ganz bestimmt nicht meine egoistischen, hyperehrgeizigen Kommilitonen von früher und definitiv nicht Ginas hypersensible, geradezu narzisstische Künstlerkollegen des Zimmer-Stipendienprogramms, die wir regelmäßig bei Abendessen, Vernissagen und Lesungen trafen. Die ganze Woche über wartete ich auf Marks Anruf. Hatte er überhaupt ein Handy? Ich konnte mich nicht daran erinnern. Schließlich rief mich Lorelle an. Am Tag nach der Demo war sie aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. „Wo sind denn alle abgeblieben?“, fragte ich. „Ich war bei der Kirche, aber da war keiner.“
Marks Grüppchen habe sich aufgelöst, erklärte sie. Stan sei zurück nach Mannheim, Eric nach Frankreich und Uta zu ihren Eltern. Das Gap-Year vom Leben, die Suche nach einer Alternative vorbei, dachte ich, die Revolution verloren. Enttäuschung durchfuhr mich.
„Und Mark?“, fragte ich. Mark sei verhaftet worden, deshalb rufe sie an. Ob wir uns treffen könnten? Lorelle wartete in einem Café gegenüber dem U-Bahnhof Neukölln auf mich. Sie bestellte einen Chai, ich einen Kaffee. Sie war anders, zurückhaltender, als hätte sie nicht geschlafen. Sogar das Mandala auf ihrer Wange wirkte weniger fluoreszierend, die Farben in ihrem Haar waren weniger festlich.
„Als ich dich letztes Mal gesehen habe“, übertönte ich mit lauter Stimme den Straßenlärm, „schlugst du gerade kreischend um dich, während du von der Polizei davongeschleift wurdest.“
„O Gott, an dem Tag war ich dermaßen high. Am nächsten Morgen haben sie mich freigelassen. Das ist Routine. Man könnte sagen, das macht den Kampf so spannend.“
„Was ist jetzt mit Mark?“
Ein junger Mann mit schulterlangem Haar und länglichem Trauerkloßgesicht kam an unseren Tisch, beugte sich zu Lorelle und flüsterte ihr schüchtern etwas ins Ohr. Er roch nach Kot, Urin und abgestandenem Schweiß. Seine dicken, ausgelatschten Stiefel standen vor Dreck. Sie schüttelte den Kopf. „Ich habe keins.“ Er wandte sich an mich. Ich sah weg und er schlurfte zum nächsten Tisch.
Offenbar war Mark an dem Tag, als ich ihn zur Kirche begleitete, nochmals losgezogen und hatte noch mehr getrunken, war dann zurück in die Kirche, wo er laut Musik laufen ließ, die eine Polizeistreife anlockte. Man fragte ihn, weshalb er sich dort aufhalte und wo sein Wohnsitz sei, und als er anfing, die Polizisten zu beschimpfen, nahmen sie ihn mit. Die Lage verschärfte sich, als sich herausstellte, dass sein Visum abgelaufen war. Jetzt war er ein Fall für die Einwanderungsbehörde.
„Und wo ist er jetzt?“
„Sitzt in Abschiebehaft. Ich habe ihn gestern besucht und er meinte, ich solle dich anrufen. Er hat sonst niemanden. Er braucht Hilfe. Die wollen ihn zurück nach Malawi schicken – was Schlimmeres kann ihm gar nicht passieren. Er kann nicht zurück.“
Wie entschieden sie klang: Er kann nicht nach Malawi zurück. Wie meinte sie das?
„Was … was kann ich denn tun?“, fragte ich.
„Er braucht einen Anwalt.“
„Was ist mit diesen Menschenrechts-NGOs – Amnesty International, können die ihm nicht helfen?“
„Mit denen habe ich schon gesprochen, aber das fällt nicht direkt in deren Gebiet. Immerhin haben sie mir die Adresse eines Anwalts gegeben. Der gehört einer anderen Organisation an, die haben sich auf solche Fälle spezialisiert und sie arbeiten unentgeltlich.“
„Hast du ihn schon angerufen?“
„Ja, und er hilft gern, aber er braucht Geld für Aktenzugang, Kopien und so weiter.“
„Wie viel?“
„Ungefähr zweihundert Euro. So viel habe ich leider nicht …“
„Klar, kein Problem.“ Ich war erleichtert, dass es nur zweihundert waren. Ich hätte Gina nur äußerst ungern um die Summe gebeten. Die Kanzlei des Anwalts lag in Mitte, zwanzig Minuten S-Bahn-Fahrt von dem Gebäude entfernt, in dem Mark inhaftiert war. Es war eine kleine Kanzlei mit zwei Schreibtischen, einer für den Anwalt, der andere für die Rechtsanwaltsgehilfin, eine steife, sauertöpfisch dreinschauende Frau. Ihr schwarzer Rock reichte bis zur Wadenmitte, ihre himmelblaue Bluse war bis oben zugeknöpft, die Spitzenrüschen um den Hals hielten ihren Kopf wie eine Klammer aufrecht; auf der Brust trug sie ein Namensschild: Frau Grosse. Es gab nur einen Besucherstuhl, daher blieb ich stehen. Der Anwalt hieß Julius Maier, „aber sagen Sie einfach Julius“, meinte er und erhob sich aus seinem Stuhl, um mir die Hand zu geben. Er war zartgliedrig, geradezu durchsichtig neben der gestreng-gewichtigen und überaus präsenten Frau Grosse. Sein Vater sei aus Burkina Faso, fügte er hinzu, wie um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern, seine Mutter Deutsche. Lorelle gab ihm den Umschlag mit den zweihundert Euro. Er zählte das Geld und reichte es an Frau Grosse weiter, die ebenfalls nachzählte, das Geld in den Umschlag und diesen in eine Schublade steckte. Ich wartete geradezu darauf, dass sich um ihre Taille eine Kette mit dazugehörigem Schlüssel materialisierte, mit dem sie die Schublade zusperren würde. Sie bemerkte meinen Blick und quittierte ihn mit einem Stirnrunzeln; ich wandte mich ab.
„Zuallererst muss Ihr Freund beweisen, dass er nicht illegal hier ist, und dafür muss er den Nachweis erbringen, dass er immer noch Student ist.“
„Er kam als Student her, das ist aktenkundig. Warum glauben die ihm das nicht?“, fragte ich.
„Das ist aktenkundig, stimmt. Aber die Lage ist nicht ganz so einfach. Mittlerweile ist er nicht mehr immatrikuliert und hat daher gegen die Visumsbedingungen verstoßen.“
„Ist das was Ernstes?“