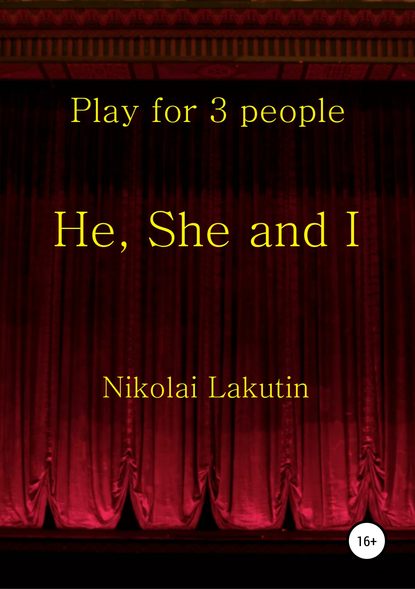- -
- 100%
- +
„Sehr. Ihm droht Abschiebung oder Haft.“ Der Anwalt wartete auf einen Kommentar meinerseits, redete dann weiter. „Am hilfreichsten wäre es, wenn er beweisen kann, dass er eine Visumsverlängerung beantragt hat. Ich habe mit ihm gesprochen und er sagte, das habe er versäumt.“
„Kann er das denn nicht nachträglich tun?“
„Dazu benötigt er ein Schreiben der Hochschule, das bestätigt, dass er immer noch immatrikuliert ist – aber das ist nicht so einfach. Er meinte, er sei im letzten Jahr nicht zur Uni gegangen. Bevor er hierhergekommen ist, hat er eine andere Hochschule in Potsdam besucht. Sein Stipendium läuft aus. Offenbar ist er demnächst mit dem Studium fertig, ihm fehlt nur noch die Abschlussarbeit.“
Eine geradezu kafkaeske Situation – für einen Gerichtsprozess musste er beweisen, dass er eine Visumsverlängerung beantragt hatte (was nicht der Fall war), doch um eine Visumsverlängerung zu beantragen, musste er beweisen, dass er immer noch Student war (was rein theoretisch der Fall war, auch wenn er keine Förderung mehr erhielt und seit einem Jahr das Unigelände nicht betreten hatte und weil er mehrmals die Hochschule gewechselt hatte, waren seine Unterlagen durcheinander, verheddert wie das Haar eines Rastafaris). Trotzdem sah der Anwalt optimistisch aus, Lorelle hingegen skeptisch und ich wahrscheinlich verwirrt.
„Es wäre tatsächlich einfacher, wenn er einen Asylantrag stellt“, erklärte er.
„Wie ein Flüchtling?“
„Genau.“
„Das macht er nie im Leben“, sagte Lorelle.
„Warum nicht, das vereinfacht die Sache …“
„Weil er kein Flüchtling ist, sondern Student.“
Wir fuhren mit der S-Bahn zur Justizvollzugsanstalt, ein Gebäude im Brutalismusstil, geradezu dem nationalsozialistischen Architekturkatalog entsprungen, wo wir etliche Formulare ausfüllen mussten. Julius erledigte das und händigte die Unterlagen einer Beamtin aus, die Frau Grosses Zwillingsschwester hätte sein können. Zeile für Zeile ging sie jedes Blatt durch, fuhr dabei mit ihrem dicken Zeigefinger die Zeilen nach, ehe sie einen Stempel herausholte und ihn unten auf jede Seite donnerte, wobei jedes Mal der Tisch bebte. Dann sah sie uns an und zeigte in Zeitlupe auf eine Stuhlreihe an der Wand. Wir setzten uns. Ich war bereits jetzt schon erschöpft und kam mir vor, als stünde ich vor Gericht, würde gleich in letzter Instanz verurteilt und gehängt. Ich vermied den giftigen Blick der Vorzimmerdame und betrachtete den langen, rechteckigen Raum. Auf einer Seite befand sich hoch oben eine Reihe quadratischer Fenster, an den Eisenstangen davor scheiterte jegliche Hoffnung auf Flucht. An einer der Türen zu unserer Rechten hing ein „Zutritt verboten“-Schild. Ein Mann kam herein und unterhielt sich mit Julius; als er sich an uns wandte, wechselte er ins Englische und forderte uns auf, ihm zu folgen. Wir gingen durch viele Türen, jede von ihnen wurde mit einem anderen der vielen Schlüssel aus dem Bund geöffnet, den er in der Hand hielt, bis wir schließlich in einer Art Vorzimmer gegenüber einer weiteren Tür Platz nehmen sollten. Nach einer Weile ging die Tür auf und Mark kam in Begleitung eines Wachmanns heraus, der sich diskret, aber gut sichtbar an der Tür positionierte. Nach dem festungsähnlichen Eingang, den vielen Türen und der Bürokratie hatte ich erwartet, dass Mark in Ketten hereingeschlurft käme. Er trug wie immer seine rote Jacke, darunter ein T-Shirt. Ohne seine Kopfbedeckung sah er niedergeschlagen, verletzlich und ein wenig verloren aus.
Mark bedankte sich bei mir. „Alles wird gut“, sagte ich.
Lorelle saß angespannt und aufrecht auf ihrem Stuhl, den Blick unverwandt auf Mark gerichtet, als wäre sie am liebsten zu ihm hingerannt und hätte ihn umarmt, aber sie blieb sitzen, lächelte jedes Mal, wenn sich ihre Blicke trafen. Wie sich herausstellte, gab es Grund für Julius’ Optimismus: Zwei Tage später wurde Mark entlassen. Der Anwalt rief mich an und wir trafen uns in seiner Kanzlei. Mark war ebenfalls anwesend, die Baseballkappe wie üblich tief in die Stirn gezogen, er trug wie immer seine rote Jacke über Hemd und T-Shirt, Converse und Hochwasserjeans. Er war vorläufig frei. Die Hochschule hatte bestätigt, dass er weiterhin immatrikuliert war und die Visumsverlängerung war beantragt. Mark hatte man in die Obhut des Anwalts entlassen. Beeindruckt schüttelte ich Julius’ Hand.
„Er muss jederzeit zur Verfügung stehen, wenn ihn eine Behörde kontaktiert. Er darf Berlin nicht verlassen. Die wollten eine Adresse, reine Formalität. Wir haben Ihre angegeben, ist das okay?“
„Natürlich“, versicherte ich, verkniff mir die Frage, wie er an meine Adresse gekommen war. „Aber wo soll er unterkommen?“
„Im Heim“, sagte Julius und ergänzte auf meinen ratlosen Blick hin, „im Flüchtlingsheim.“
Dort wo die Asylsuchenden auf das Ergebnis ihres Antrags warteten. Ich sah Mark an – was dachte er darüber? Er betrachtete einen Ast draußen vorm Fenster.
„Aber er ist doch kein Asylant“, sagte ich.
Julius zuckte die Achseln. „Das ist lediglich eine Übergangslösung.“
„Weißt du was“, meinte ich zu Mark, „komm mit zu mir, da kannst du ein, zwei Tage bleiben, ehe du woanders unterkommst.“
Mark zuckte schweigend mit den Schultern. Ein Dankeschön wäre nett gewesen, andererseits hatte er einiges durchgemacht. Bevor wir gingen, nahm Julius mich beiseite. „Wie gut kennen Sie ihn?“
„Wir kennen uns ungefähr seit zwei Monaten. Warum?“
Er zuckte wieder mit den Achseln. „Sie sollten mit ihm reden.“ Er wirkte, als läge ihm noch etwas auf der Zunge, aber offenbar fand er schweigen ratsamer. Er sah Mark, dann mich an. „Reden Sie einfach mit ihm. Um … um mehr über ihn zu erfahren, Sie verstehen?“
„Okay.“ Ich war verwirrt. Verheimlichte Mark mir etwas? Er würde mir doch bestimmt sagen, wenn es gefährlich wäre, ihn aufzunehmen? Wir gingen erst mal in eine Kneipe und ich gab ein Bier aus, um Marks Freiheit zu feiern. „Mein erstes Bier seit Tagen“, sagte er und schwieg dann die meiste Zeit. Gern hätte ich Julius’ Bemerkung erwähnt, aber wie brachte man so etwas zur Sprache? Ich beschloss, das Thema zum geeigneten Zeitpunkt möglichst taktvoll aufs Tapet zu bringen. Als wir ausgetrunken hatten, sah er auf. „Hoffentlich ist deine Frau nicht sauer, wenn du ein Findelkind anschleppst.“
„Sie wird’s verkraften“, sagte ich, obwohl mir klar war, dass ich mit dieser Aktion zu weit ging, einen nur schwer rückgängig zu machenden Schritt tat. Von nun an war ich für Mark verantwortlich. Was immer er tat, was immer mit ihm geschah, würde direkte Auswirkungen auf Gina und mich haben.
6
Als ich die Wohnungstür aufschloss, hörte ich Stimmen und mir fiel ein, dass wir an diesem Tag Gäste hatten. Gina war mit ihrer Reisenden-Serie fertig und hatte ihre Modelle sowie einige von den Zimmer-Leuten zur privaten Vernissage eingeladen – und ich hätte auf dem Heimweg die Getränke dazu mitbringen sollen. „Scheiße“, entfuhr es mir leise und ich sann fieberhaft nach einer Entschuldigung.
„Alles in Ordnung?“, fragte Mark mit hochgezogenen Augenbrauen. Ich lächelte und winkte ihn herein.
Gina stand, ein Glas in der Hand, im Wohnzimmer und unterhielt sich mit einem Mann, der sein Ralph-Lauren-Hemd ziemlich weit aufgeknöpft trug, damit man seine behaarte Brust bewundern konnte. Sie machte den Mund auf, schloss ihn aber wortlos, als sie Mark sah. Ihre Augenbrauen hoben sich fragend. Ich ging zu ihr und küsste sie auf die Wange. „Hi, Darling“, sagte ich. Auf dem Balkon standen zwei Frauen mit einem Glas Wein in der Hand und rauchten. Ich winkte ihnen zu und schüttelte dem Mann die Hand.
„Du bist Ginas Mann“, konstatierte er. „Ich bin Dante.“ Er war Franzose oder Italiener, womöglich Spanier. Ob er sich wohlfühlte mit so exponierter Brust? Ich nickte und drehte mich zu Mark um. „Das ist Mark, ein Freund.“ Ich wartete, ob Gina sich an ihn erinnerte, wenn ja, ließ sie es sich nicht anmerken.
„Mark, das ist meine Frau, Gina.“
Gina sah von Mark zu mir, immer noch mit fragendem Blick, gab ihm dann die Hand. Mark mit seiner Baseballkappe, seiner gerade einmal bis zu den Knöcheln reichenden Jeans, dem einschultrig getragenen Rucksack, dem Geruch nach Inhaftierung wirkte neben dem elegant aufgeknöpften Dante dermaßen fehl am Platz, dass ich mich für ihn schämte.
„Komm“, sagte ich, nahm seinen Rucksack und zeigte Mark das Badezimmer, damit er sich die Hände waschen konnte; außerdem musste ich kurz allein sein, um mich zu fassen. Am dringendsten brauchte ich jedoch etwas Alkoholisches. In der Küche standen zwei offene Weinflaschen auf der Arbeitsplatte, eine rot, eine weiß. Während ich im Büfett nach einem Glas suchte, kam Gina herein. Sie machte die Tür zu und lehnte sich dagegen.
„Ich habe versucht, dich zu erreichen.“
Ich schenkte mir ein Glas Wein ein und trank es in einem Zug aus. Gina kam zu mir herüber, nahm mir das Glas ab und stellte es behutsam ins Spülbecken. Ich nahm es wieder an mich und schenkte mir erneut ein. Eine Woche nach unserer Heirat waren zwei ihrer Freunde auf dem Weg nach Baltimore durch unsere Stadt gekommen und Gina wollte mich ihnen vorstellen. Sie hatte gekocht und ich hätte auf dem Heimweg von der Bibliothek, wo ich meine Englisch-Studenten unterrichtete, Wein mitbringen sollen, allerdings war mir die gesamte Sache völlig entfallen. Ärgerlicherweise tat ich nichts Wichtiges, sondern hockte lediglich mit einem Roman in der Bibliothek herum und als ich mich wieder erinnerte, war ich drei Stunden zu spät dran. Als ich heimkam, lag sie im Bett und sprach am nächsten Tag kein Wort mit mir.
„Entschuldige, ich hatte vergessen, dass wir heute Gäste haben.“ Sie sehe in ihrem roten Kleid wunderschön aus, fügte ich hinzu.
„Ich habe mehrmals angerufen. Dir auf die Mailbox gesprochen.“
„Ich kann noch schnell Nachschub holen, wenn es nicht zu spät ist …“
„Natürlich ist es zu spät. Dante hat ein paar Flaschen mitgebracht. Und wer ist dieser Typ? Irgendwie kommt er mir bekannt vor.“
„Er heißt Mark. Er war schon mal bei uns.“
„Was macht er hier?“
„Er braucht einen Platz zum Schlafen.“
„Zum Schlafen?“
„Ja. Ich erklär’s dir später.“
„Du kannst es mir jetzt erklären.“
„Zu kompliziert. Später.“
„Trink bitte nicht so viel“, sagte sie und verließ die Küche. Ich leerte das zweite Glas, diesmal langsam. Um mich den Gästen stellen zu können – so ungefähr das Allerletzte, wonach mir war –, benötigte ich einen Stimmungsaufheller und ein frisches Hemd. Als ich durch den Flur zum Schlafzimmer ging, sah ich, dass die Ateliertür offenstand. Auch dort waren Leute, ein Mann und eine Frau, die sich leise unterhielten. Ich blieb im Türrahmen stehen und räusperte mich. Im Dämmerlicht erkannte ich Manu und die Frau, deren Tochter ebenfalls anwesend war. Sie stand im Schatten einer Leinwand.
„Hallo“, sagte ich. Die drei drehten sich um und starrten mich schweigend an, als erwarteten sie einen Anschiss von mir. Die Frau stellte sich neben ihre Tochter.
„Ich wusste nicht, dass Sie hier drinnen sind“, ich hielt weiterhin den Blick auf Manu gerichtet. Alle starrten mich weiterhin schweigend an und als die Situation immer peinlicher wurde, meinte ich: „Ich bin gerade erst gekommen. Ich habe mich mit einem Freund getroffen.“ Sie sagten immer noch nichts und dann nahm die Frau die Tochter bei der Hand und drückte sich mit größtmöglichem Abstand an mir vorbei durch die Tür ins Wohnzimmer. Wieder sah ich Manu an, dann der Frau hinterher. „Ich weiß gar nicht, wie sie heißt.“
„Bernita.“
„Sie redet nicht viel, oder?“
„Sie ist schüchtern“, sagte er.
Ich betrat das Zimmer und stellte mich neben ihm vor eine der Leinwände. Insgesamt waren es sechs, der Größe nach geordnet, die größte, 150 × 130 cm, links und die kleinste, 60 × 50, rechts. Die Gemälde waren so aufgebaut, dass lediglich das Licht einer einzigen Lampe auf sie fiel. Manus Porträt, 150 × 130, erwiderte unseren Blick, nachdenklich, ein wenig müde, aber voller Würde, wie ein besiegter König inmitten seines zerstörten Palastes.
„Gut getroffen“, sagte ich.
Das nächste Porträt zeigte die Frau mit ihrem Kind. Ich sah die fertigen Gemälde zum ersten Mal. Gina verabscheute es, ihre Werke in halbfertigem Zustand zu zeigen, selbst mir. Die Frau saß da, auf ihrem Schoß schlief das Kind.
„Wie eine Pietà“, meinte Manu. Eine Frau, die ihr entkräftetes Kind hielt, trauerte, wie das nur eine Frau kann. Sie trug den voluminösen Wintermantel, betrachtete die in ihren Armen liegende Gestalt, das Licht umstrahlte ihren bedeckten Kopf wie ein Heiligenschein. Auf drei kleineren Leinwänden war das Kind allein skizziert – ich trat näher. Nein, es handelte sich nicht um dasselbe Kind. Es war ein weißes Kind, der Junge aus dem Heim für mutterlose Kinder, der über der Mauer hing und „Schokolade!“ rief. Und doch war es auf dem nächsten Bild nicht derselbe Junge. Es war ein eher exemplarisches Kindergesicht, ein Allerweltskind. Jedermanns Kind. Und das nächste war noch exemplarischer, geschlechtslos, weder schwarz noch weiß; deutlich zu sehen war jedoch ein geradezu anklagender Schmerz in seinen glänzenden Augen. Ich trat zurück und wandte mich an Manu. Was er wohl darüber dachte? Er hatte sich vorgebeugt, sein Gesicht dicht vor der Leinwand.
„So viel Traurigkeit“, sagte er. Als ich schwieg, fuhr er fort: „Aber das ist möglicherweise nur meine Interpretation.“
„Möchten Sie ein Bier? Ich ziehe mir rasch ein anderes Hemd an und dann bin ich bei Ihnen.“
Manu erzählte, er habe eine Tochter. Sie lebten in einem Flüchtlingsheim.
„Warum haben Sie sie nicht mitgebracht?“
„Sie hat heute Deutschunterricht.“
Ich versuchte, seinen Akzent zu erraten. „Kommen Sie aus dem Senegal?“
„Nein, aus Libyen. Mein Vater kam ursprünglich aus Nigeria.“
Mark saß mit einem Glas Wein in der Hand zwischen den zwei Frauen, die auf dem Balkon geraucht hatten, auf dem Sofa. Die eine hieß Ilse, sie war für die PR bei Zimmer verantwortlich, die andere hatte ich noch nie gesehen. Er schilderte den beiden sein Martyrium durch die Einwanderungsbeamten. Dante und Gina rückten näher und mittlerweile war Mark, dem die Aufmerksamkeit sichtlich gefiel, von einer kleinen Gruppe umringt. Er erzählte mit der für ihn typischen Prahlerei, gab der Geschichte einen humoristischen Anstrich, als wäre alles ein großer Spaß gewesen. Mir kam es vor, als hörte ich zum ersten Mal davon, als wäre ich nicht teilweise mit dabei gewesen und unwillkürlich musste ich seine Wandlungsfähigkeit bewundern. Die mir unbekannte Brünette im blauen Kleid, das nur bis zur Mitte der Oberschenkel reichte, lehnte sich zu Mark hinüber. „Also beantragen Sie jetzt Asyl? Das wäre doch das Einfachste für Sie, oder?“
„Mark ist Student“, sagte ich und trat näher.
„Ah so“, sie sah zu mir hoch. Sie wirkte wie Mitte vierzig. Eine Journalistin aus Frankfurt, wie ich später erfuhr. Sie hieß Anna. Wie Gina wohl an sie geraten war? Wahrscheinlich durch Ilse. Zimmer förderte und vernetzte seine Stipendiaten unermüdlich.
„Warum“, Mark wandte sich mit einem schelmischen Funkeln in den Augen an mich, „gehen Weiße immer davon aus, dass jede schwarze Person, die reist, ein Flüchtling ist?“
„Tun sie nicht“, sagte Anna. „Tue ich nicht“, verbesserte sie sich. „Schließlich kann ich nicht für jeden Weißen auf dem Globus sprechen.“
Ich klinkte mich aus und ging in die Küche, um mir Wein nachzuschenken; als ich zurückkam, waren die Frau und ihr Kind gegangen. Mir fiel Manu ins Auge, der mit einem Glas in der Hand etwas abseits in der Nähe der Tür stand. Er starrte die Gruppe an und als ich seinem Blick folgte, stellte ich fest, dass er Gina ansah, die sich mit Dante unterhielt. „Deine Frau ist extrem begabt“, sagte er.
„Komm doch zu uns“, meinte ich, „halt dich nicht so abseits.“
„Ich muss jetzt leider gehen. Es ist schon spät.“
Ich reichte ihm seinen Mantel und als ich mich wieder zu den anderen gesellte, fragte Anna Mark gerade, ob er in Berlin Rassismus erlebt habe, denn bestimmt sei Berlin doch die liberalste und offenste Stadt Europas, in der man die Menschen herzlich willkommen heiße. Mark lächelte unbeeindruckt. „Mir gefällt’s hier. Sogar in Berlin sehne ich mich nach Berlin.“
„Hahaha“, Anna lachte entzückt. Ihr Lachen war erstaunlich laut. „Das gefällt mir. Darf ich Sie zitieren?“
Mark hob die Hand, sein Gesicht war weingerötet. „Bevor Sie mich zitieren, möchte ich noch Folgendes sagen … mir ist auch aufgefallen, dass Frauen, wenn ich in der Nähe bin, unweigerlich ihre Taschen umklammern. Und zwar so.“ Er führte es vor. „Mit beiden Händen. Erst ist mir das gar nicht aufgefallen, aber dann war es so offensichtlich, dass ich es nicht übersehen konnte.“
Anna lachte, wirkte jetzt aber mehr auf der Hut. Gina warf mir einen Blick zu – Mark fiel in meinen Zuständigkeitsbereich. Er sorgte für Unbehagen bei ihren Gästen. Dante versuchte die Situation zu retten. „Aber was Rassismus betrifft, ist die Lage in Europa doch gut. Besser als in Amerika, oder? Ich bin öfter dort für Ausstellungen. Obama wird dort nicht respektiert und bestimmt, weil er schwarz ist.“
„Na ja, es ist nicht ideal, aber so schlimm auch wieder nicht“, sagte Gina. „Wir haben seit den Sechzigern, seit der Bürgerrechtsbewegung große Fortschritte gemacht.“ Sie sah mich an, aber ich hatte dem nichts hinzuzufügen.
„Was für Erfahrungen hast du als Afrikaner in Amerika gemacht?“, fragte Dante mich. Ich betrachtete seine modisch zerrissene Jeans, das blaue Hemd, aus dessen Ausschnitt die Brusthaare lugten und beschloss, ihn unsympathisch zu finden, lächelte aber und erzählte von meiner ersten Reise nach New York. In der Penn Station war ich auf einen Polizisten zugegangen, weil ich ihn nach dem Weg fragen wollte, wie man das überall auf der Welt eben so macht, und als ich näherkam, bemerkte ich, wie sich seine Hand langsam in Richtung der Waffe an seiner Taille bewegte. Ich war stehengeblieben und hatte mich umgesehen, bestimmt war da jemand hinter mir, dessentwegen er nach der Waffe greifen wollte, denn ich konnte ja nicht der Grund sein. Mittlerweile umklammerte er seine Waffe, aber ich fragte ihn trotzdem nach dem Weg, wenn auch mit zitternder Stimme, und er sah mich mit unbewegter Miene an und sagte: „Weitergehen.“ Als ich Gina die Geschichte vor langer Zeit erzählt hatte, war sie ausgerastet. Sie hatte die Polizei als rassistische Schweine beschimpft. Damals war sie hitzköpfig gewesen, in letzter Zeit war sie toleranter geworden, nahm weniger wahr, was um sie herum geschah, ihr Blick galt einzig ihrer Malerei.
7
„Wie lange bleibt er denn?“, fragte mich Gina, als die Gäste gegangen waren und Mark auf dem Wohnzimmersofa schnarchte.
„Ein, zwei Tage.“
„Wie konntest du das nur tun – ihn mitbringen, ohne mich vorher zu fragen? Wenn irgendwas schiefgeht …“
„Was soll denn schiefgehen?“, fragte ich und in dem Moment fiel mir der besorgte Gesichtsausdruck des Anwalts ein, als er mich fragte, ob ich Mark denn gut kennte. Ich verdrängte den Gedanken. „Meinst du, er zündet das Haus an oder bricht bei den Nachbarn ein? Also echt. Er wirkt vielleicht ein bisschen … aus dem Lot, aber er ist in Ordnung. Er braucht einfach einen Platz, wo er sich ein, zwei Tage berappeln kann.“
„Was hat er denn für Probleme?“
„Du hast ihn ja vorhin gehört. Er ist Student und seine Aufenthaltspapiere müssen in Ordnung gebracht werden. Ein Anwalt kümmert sich darum.“
In dieser Nacht bekam ich so gut wie keinen Schlaf, lauschte Ginas leisem Atem. Ich hätte sie gern nach dem Kind gefragt, das sie gemalt hatte, und wofür es stand, aber sie schlief bereits, weit von mir abgerückt, das Gesicht zur Wand gedreht. Schlaflos lag ich da, bis schließlich draußen die Vögel loszwitscherten. Ich machte das Fenster auf, streckte meinen Kopf hinaus und sog tief die Morgenluft ein. Ich bin immer erst richtig wach, wenn ich frische Morgenluft geschnuppert und die Vögel tirilieren höre – selbst im Winter. Das Laub färbte sich allmählich rot. Schon jetzt klang der Sommer aus. Als wir letzten Oktober herkamen, fiel bereits das bunte Laub. Ende Oktober hatte ich am Fenster gestanden und ein einsames Blatt betrachtet, das sich hartnäckig an seinen Ast klammerte, und gedacht, dies müsse das letzte Blatt in der ganzen Straße, der ganzen Stadt, ach was, der ganzen Welt sein, das noch am Baum hing und das genau vor meinem Fenster. Der Herbst ist meine liebste Jahreszeit; ein Augenblick des Dazwischen, weder Winter noch Sommer, und so kurz. Ich beobachtete gern, wie der Wind und die vorbeifahrenden Autos die Blätter wirbeln und kreisen ließen, sie wehten hoch und trudelten hinab, häufelten sich am Gehwegzaun auf. Ich beobachtete gern, wie die Kinder gegenüber mit dem Laub spielten, es zusammenrafften und einander über den Kopf regnen ließen. Sie fassten sich an den Händen und hüpften kreischend durch die rotbraungelben Blätter, beruhigt und aufgestachelt durch das Knirschen und Knacken unter ihren Füßen, und ihr helles Lachen stieg von der Straße hoch in die entlaubten Bäume, erschreckte die Vögel, stieg hoch zu den Balkons und Fenstern, die immer noch offen standen, dem nahenden Winter zum Trotz.
8
Mark war schon wach, saß auf dem Sofa und sah durch die offene Balkontür auf die Wipfel der Pappeln, die die Straße säumten. Er war bis zum Hals in eine Decke gewickelt und wie er so dasaß, ausnahmsweise fast reglos, wirkte er verletzlich, nahezu kindlich. Er hatte auf dem Balkon geraucht und der Geruch war ins Zimmer gewabert. Gina habe zu einer Veranstaltung müssen, teilte ich ihm mit.
„Ja, ich habe mitbekommen, wie sie gegangen ist“, erklärte er.
Sie hatte mir nicht erzählt, wohin sie ging. In letzter Zeit schien sie immer gerade dann zur Wohnungstür hereinzukommen, wenn ich ging oder zu gehen, wenn ich kam; sie wachte auf, wenn ich schlafen ging. Am Vortag hatten wir nebeneinander im Badezimmer gestanden, redeten aber nicht miteinander, weil jeder den Mund voller Zahnpasta hatte, starrten uns nur im Spiegel über dem Waschbecken an, ein kurzer Blickkontakt, dann beugte sie sich vor und spuckte ins Wasser, das schäumend in den Abfluss strudelte. Ich dachte oft an Gina in ihrem Atelier, die den ganzen Tag allein war, mit Farben und Strichen, Angst und Hoffnung kämpfte, dem Pinsel Formen abrang, Gliedmaßen, Gesichter, Haare, Augen, und manchmal zutiefst zweifelte, ob sie die ideale Form im Platon’schen Sinne, die sie vor ihrem geistigen Auge hatte, einfangen konnte. In unserer Berliner Anfangszeit schien sich alles zu fügen, aber jetzt hielt sie sich manchmal nur im Atelier auf, um mir aus dem Weg zu gehen, so wie ich mich meinerseits mit Mark und seinen Freunden traf, um ihr auszuweichen. Manchmal wenn sie aus dem Atelier kam und mich lesend oder fernsehend im Wohnzimmer vorfand, wirkte sie überrascht von meiner Anwesenheit, dass es mich gab und sie gab, Mann und Frau gemeinsam unter einem Dach. Ich hätte nicht sagen können, wann sich dieses Unbehagen eingeschlichen hatte. Ich wollte sie umarmen und schweigend gemeinsam dasitzen, wie wir das vor langer Zeit oft getan hatten, aber dazu wäre eine enorme Energie nötig gewesen und die hatte ich nicht. Stattdessen schlüpfte ich in meine Jacke und streifte durch die einsamen Seitenstraßen von Berlin. Nichts und Niemand ist so einsam, wie ein einsamer Fremder in einer fremden Stadt.
„Wie habt ihr euch kennengelernt?“, wollte Mark wissen.
„Vorher brauche ich einen Tee“, sagte ich. „Willst du auch einen?“
„Lieber Kaffee, wenn du welchen hast.“
„Kein Problem.“
Als ich mit den Tassen kam, hatte er sich aus der Decke geschält und war bereits angezogen. Ich hatte Gina im März 2007 bei einer Wahlkampfveranstaltung Obamas an der American University in Washington kennengelernt. Obama hatte kurz zuvor seine Präsidentschaftskandidatur verkündet und Gina war eine seiner Wahlkampfhelferinnen. Irgendwann stand sie neben mir, umringt von ihren Freunden, die ebenfalls alle in Obamas Wahlkampfteam waren und entsprechende Buttons trugen. Noch nie hatte ich jemanden gesehen, der so schön war. Zweimal trafen sich unsere Blicke und ich spürte, dass auch ich ihr aufgefallen war – ich bekam kaum ein Wort des Kandidaten mit, war viel zu beschäftigt mir eine Strategie auszudenken, wie ich sie ansprechen könnte, aber noch ehe ich meinen Mut zusammenraffen konnte, waren sie weg, wurden dem Kandidaten vorgestellt.