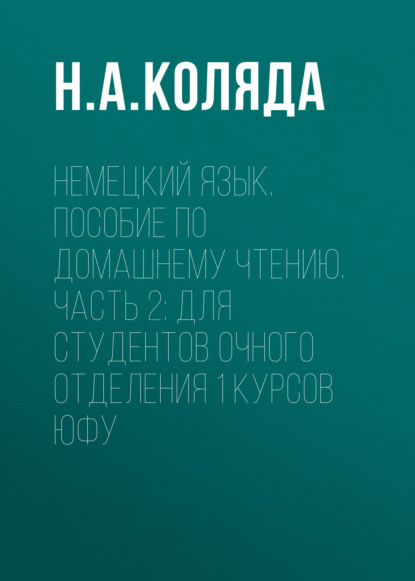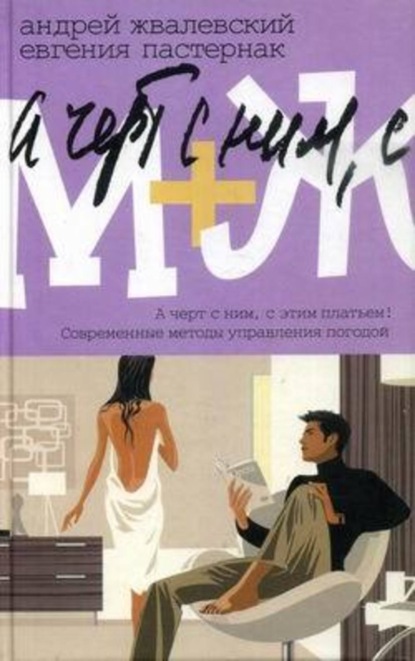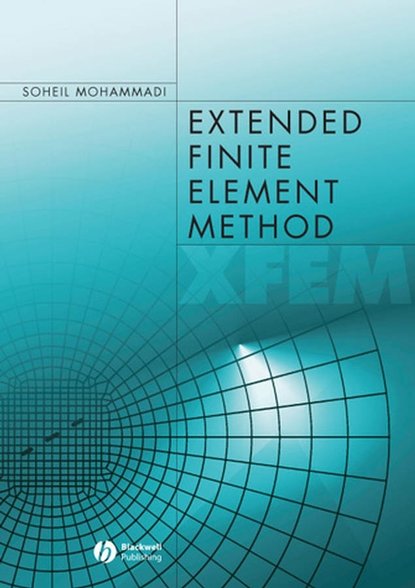- -
- 100%
- +
„Was hast du in den USA gemacht?“
„Ich bin 2006 mit einem Stipendium rüber – ich habe dort meine Dissertation geschrieben. Wie es das Schicksal wollte, studierte sie ebenfalls Geschichte. Eine Woche darauf traf ich sie in der Bibliothek und diesmal gab es kein Halten mehr für mich. Als ich erwähnte, ich sei aus Nigeria, erzählte sie, ihr Vater sei Fulbright-Stipendiat in Nigeria gewesen. Und so fing es an. Jetzt du“, sagte ich.
„Was willst du wissen?“
„Erzähl mir von Malawi. Hast du Geschwister?“
„Ja. Zwei von jeder Sorte, ich bin das Sandwichkind.“ Er klang ernst, der leichtfertige, schwer fassbare Mark war für einen Moment lang verschwunden.
„Erzähl mir von ihnen, von deiner Familie.“
„Ich … mein Vater und ich waren selten einer Meinung. Habe ich schon erwähnt, dass er Pfarrer war?“
„Ja. Welche Glaubensgemeinschaft?“
„Seine Pfarrei gehörte zur Pfingstbewegung, eine der wenigen in Lilongwe. Als ich kleiner war, hat er mich ermuntert, bei der Kirchentheatergruppe mitzumachen. Ich habe es geliebt, hatte schon früh eine Neigung dazu. Wir spielten hauptsächlich biblische Geschichten nach. Ich liebte es, auf der Bühne zu stehen, liebte die Macht, die Gemeinde mit meiner Tollpatschigkeit, mit Worten und Gesten zum Lachen oder zum Weinen zu bringen. Ich spielte immer die Hauptrolle. Einmal war ich der Verlorene Sohn, der ausgestoßen wurde und mit den Schweinen aß und bei der Heimkehr von seinem Vater mit offenen Armen aufgenommen wurde, dann wieder war ich Josef, den seine Brüder in den Brunnen geworfen hatten. Ich kann verstehen, warum Schauspieler manchmal schizophren werden. Man geht so leicht in der Rolle auf und sich davon zu lösen, ist problematisch. Ich war jeweils felsenfest davon überzeugt, dass ich diese Person war. Wahrscheinlich bin ich schon damals vor etwas geflüchtet, wovor, weiß ich nicht. Meine Kindheit, das war nur die Kirche, keinerlei andere Interessen. Während meine Freunde draußen herumstromerten, Sport trieben und andere Hobbys entdeckten, blieb ich in der Kirche, immer unter dem wachsamen Auge meines Vaters. Mehr gab es in meiner Kindheit nicht. Als ich mit der weiterführenden Schule fertig war, wollte ich natürlich Schauspiel studieren, aber das kam für meinen Vater nicht in Frage.“
„Warum?“
Mark zog aus seiner Jackentasche eine Zigarettenschachtel heraus. Wir stellten uns auf den Balkon und rauchten. „Schauspieler in der Kirche zu sein, war okay, aber außerhalb nicht. Schauspieler sein heiße, eine Lüge zu leben, behauptete er. Mit der Vorspiegelung falscher Tatsachen sein Geld zu verdienen. Gottlos, nannte er es. Aber mit Hilfe meiner Mutter gelang es mir doch. Ich lud die gesamte Familie zu meinem ersten Auftritt ein. Ich spielte die Hauptrolle in Sizwe Bansi ist tot von Athol Fugard. Da war ich neunzehn. Ich hatte mich enorm ins Rollenstudium reingekniet, damit ich den passenden Tonfall, die entsprechenden Bewegungen fand. Aber trotzdem konnte ich, sogar von der Bühne aus, die Enttäuschung im Gesicht meines Vaters sehen.“
„Was genau hat ihm denn missfallen?“, fragte ich.
Mark nahm einen tiefen Zug, lehnte sich dann über die Balkonbrüstung und schnipste die Kippe weg. „Er meinte, es bringe Schande über die Kirche. Es sei zu weltlich. Dazu muss man wissen, dass mein Vater für die Kirche, für die Bibel lebte, das war sein gesamter Lebensinhalt. Ich war dermaßen enttäuscht, dass ich nicht mehr nach Hause fuhr. Während der Semesterferien wohnte ich bei Freunden und wir spielten in kleinen Theatern, in Nachtclubs und auf der Straße und verdienten genug für unseren Unterhalt. Es machte Spaß. Meine Mutter besuchte mich und flehte, ich solle heimkommen. Ich weigerte mich. Nach Abschluss des Studiums ging ich zu Onkel Stanley, dem jüngsten Bruder meines Vaters, nach Südafrika. Er unterrichtet an der Uni und ist das genaue Gegenteil meines Vaters. Ich bin nie wieder nach Hause gegangen. Er war derjenige, der vorschlug, ich solle ins Ausland gehen und dort weiterstudieren. Er hat mich mit seinem Freund am Goethe-Institut in Johannesburg verdrahtet. Ich schrieb mich dort für einen Deutschkurs ein und bewarb mich für ein Stipendium, damit ich hier weiterstudieren konnte. Eins ergab einfach das andere.“
„Hast du je daran gedacht, zurückzugehen?“, fragte ich. Er schüttelte den Kopf, zuckte die Achseln. „Hin und wieder. Meine Mutter fehlt mir. Und mein Onkel und seine Frau, deren Kinder, meine Geschwister. Aber ich und Rückkehr – eher nicht. Zumindest nicht in nächster Zeit.“
Ich wollte auf das, was der Anwalt gesagt hatte zu sprechen kommen, doch zu meiner Überraschung sagte Mark, er müsse jetzt gehen.
„Wie, du gehst jetzt?“
„Schau mal, ich bin mir nicht sicher, ob deine Frau es so gut findet, dass ich hier bin. Ich habe das schon letzte Nacht gemerkt. Und heute früh hat sie nicht mal auf mein Guten Morgen reagiert.“
Ich entschuldigte mich. „Aber du musst wirklich nicht gehen. Gina ist momentan einfach nur mit den Gedanken woanders …“
„Schon gut“, sagte er. „Ehrlich. Ich weiß zu schätzen, was du alles für mich getan hast.“
Ich kam mir wie Judas vor, als ich Mark zur Bushaltestelle begleitete, war aber gleichzeitig auch erleichtert, ein Gefühl, das ich zu unterdrücken versuchte. Er meinte, er könne bei Freunden unterkommen und wenn das nicht klappe, gebe es immer noch das Flüchtlingsheim. Ich umarmte ihn, eine Judasumarmung, und sah ihm nach, wie er durch eine Verkehrslücke rannte, wobei der Wind seine alberne Jacke hochwehte. Während der letzten Wochen hatte er abgenommen. Er erwischte den M400-Bus und als dieser losfuhr, sah ich Mark am Fester des Oberdecks winken. Mit bleierner Hand winkte ich zurück und schleppte mich schweren Herzens nach Hause. Alles veränderte sich. Das Laub an den Bäumen, die Kleider in den Schaufenstern. In der Luft lag eine fast kaum wahrnehmbare Kühle. Ich dachte an zu Hause und den Harmattan im November, der mich fast immer krank gemacht hatte, meine Mutter meinte, das sei, weil mein Körper auf den Wechsel der Jahreszeiten reagiere. Unsere Körper wollten, träge wie sie seien, immer am Gewohnten festhalten. Ich hatte mit meiner Mutter schon länger nicht mehr telefoniert. In meiner Anfangszeit in Amerika rief ich sie jeden Sonntag an, verplauderte Fünf-Dollar-Telefonkarten, der Hörer wurde an meinen Vater weitergereicht, an meine Schwester und beide Brüder. Eigentlich sollte ich nach meiner Dissertation heimkehren, doch dann traf ich Gina und aus Tagen wurden Monate, aus Monaten Jahre und dann hörte ich auf, daheim anzurufen. Bei meinem letzten Anruf vor einem Jahr, hörte sich meine Mutter derart distanziert an, als würde sie mit einem Unbekannten übers Wetter reden. Ich reichte den Hörer an Gina weiter, aber meine Mutter hatte Probleme, Ginas amerikanischen Akzent zu verstehen, daher dauerte der Anruf nur wenige Minuten. Ich dachte daran, wie es gewesen war, bevor Gina schwanger wurde. Abends saßen wir oft auf dem Balkon, tranken Weißwein und beobachteten den leeren Parkplatz auf der anderen Straßenseite, die Kinder, die auf ihren Skateboards über den Asphalt tretrollerten, den Gehweg entlangdonnerten, mit den an ihren Schuhsohlen festklebenden Brettern hoch in die Luft sprangen, jedes erfolgreiche Kunststückchen mit einem High-five feierten. Ich war so gedankenversunken, dass ich in eine Frau hineinrannte, die eine Schaufensterauslage betrachtete, kurz darauf in einen Mann. Ich war zum ersten Mal in dieser Straße, kannte weder die Namen der Läden noch eventuelle Sehenswürdigkeiten. Der Mann war hochgewachsen und trug eine modische Lederjacke. Er fasste mich am Ellbogen und rüttelte mich aus meiner Tagträumerei. „He, pass auf!“ Ich nickte und ging weiter.
9
Eine Woche nachdem ich Mark zur Bushaltestelle begleitet hatte, wurden meine Fragen beantwortet. Es war der Tag, an dem Ginas Vernissage in der Zimmer-Galerie stattfand, die irgendwo in der Karl-Marx-Straße lag. Gina hatte sich damals jeglichen Kommentar verkniffen, als sie zurückkam und Mark nicht mehr da war. Unser Leben nahm seinen normalen Rhythmus auf. Wir gingen Abendessen, besuchten Ausstellungseröffnungen, Lesungen und Darbietungen von Ginas Künstlerkollegen. Sie sah glücklich aus, als sie die Besucher von Gemälde zu Gemälde führte, Fragen zu Farbe, Technik und Konzept beantwortete. Im Hintergrund lief getragene Instrumentalmusik, sämtliche Zimmer-Künstlerkollegen waren gekommen. Die Vernissage würde sich über den ganzen Tag erstrecken. Ich stand in einer Ecke, versuchte, mich nützlich zu machen, plauderte mit Julia, der Zimmer-Direktorin, einer großen, schlanken, bescheidenen Frau, mit ihrem Lebensgefährten Klaus, einem Brocken von Mann, der den Riesling hinunterkippte wie Wasser. Ich war seit drei Stunden da, ich war müde und hungrig und überlegte, ob ich irgendwo essen gehen sollte. Ich brauchte etwas Handfesteres als das angebotene Fingerfood und wollte Gina fragen, ob sie mich begleiten würde. Da kam in Begleitung dreier Personen ein Mann herein, der mir bekannt vorkam. Er erkannte mich gleichzeitig, löste sich aus seiner Gruppe und kam herüber. Es dauerte kurz, bis ich ihn einordnen konnte. Es war Julius, der Anwalt. In Jeans und T-Shirt sah er anders aus. Das hier sei die Vernissage meiner Frau, erklärte ich ihm.
Er sah beeindruckt aus. „Meine Lebensgefährtin hat mir von der Ausstellung erzählt.“ Er deutete auf eine der jungen Frauen, die Jeans und Bomberjacke trug. „Übrigens hätte ich Sie morgen angerufen. Ich muss mit Mark reden. Wohnt er noch bei Ihnen?“
„Nein. Alles in Ordnung?“
„Ich muss mit ihm reden. Es geht um seine Visumsverlängerung.“
„Er wohnt schon seit längerem nicht mehr bei uns, aber ich kann es ihm ausrichten. Ich kann ihn finden, wenn es nötig ist.“
Der Anwalt zögerte. „Es ist tatsächlich dringend … ich habe erst heute erfahren, dass sein Visum leider nicht verlängert wurde.“
„Oh, das tut mir leid.“
„Können Sie ihm das bitte ausrichten?“
„Klar.“
Schon im Gehen sagte er: „Eigentlich geht es mich nichts an, aber … Sie wissen, dass sein richtiger Name Mary ist? Das wussten Sie bestimmt schon, Sie sind ja gut befreundet.“
Verdattert starrte ich ihn an. Mary?
„Er ist eine Frau, vielmehr sie ist eine Frau. Mary Chinomba.“
Mark war eine Frau? „Sind Sie sicher?“ Mehr brachte ich nicht heraus.
„Selbstverständlich, schließlich habe ich ihre Papiere gesehen. Sie sehen so erstaunt aus – Sie wussten es also nicht.“
10
Meine Anrufe bei Mark landeten direkt bei einer Stimme, die mir knapp auf Deutsch beschied, ich solle bitte eine Nachricht hinterlassen. Nach einer Weile nahm die Mailbox keine Nachrichten mehr auf. Ich rief Lorelle an, die Mark zwar ebenfalls seit einiger Zeit nicht mehr gesehen, aber gehört hatte, er sei in einem Heim in der Nähe des Görlitzer Bahnhofs untergebracht. Wir trafen uns beim Bahnhof und gingen gemeinsam zum Flüchtlingsheim. Wir kamen an leerstehenden, verfallenen Gebäuden vorbei, deren Fassaden blau-grün-schwarze Graffiti zierten, an Geschäften, deren Rollladentüren dauerhaft geschlossen waren; wir gingen an dubiosen Eckläden vorbei, aus deren schmalen Türen Betrunkene mit Six-Packs unterm Arm heraustaumelten, die Bierbäuche hingen ihnen über den Hosenbund, an schnurrbärtigen Türken, die unter Sonnenschirmen Shisha rauchten und landeten in einer komplett verwaisten Straße, an deren Ende sich ein Zaun befand, an dem das Gras hochwucherte.
„Warst du schon mal hier?“, fragte ich Lorelle. Sie schüttelte den Kopf. Wir bogen um die Ecke in die nächste Straße, die bis auf zwei Männer ebenfalls leer war, mit geröteten, schmuddeligen Gesichtern saßen sie mit dem Rücken an eine Hauswand gelehnt da, die Beine auf dem Gehweg ausgestreckt, ganz im Bann der Chemie, die durch ihre Adern rauschte. Während sie gierig aus ihren Bierdosen schlürften, folgten uns ihre Blicke, bis wir um die nächste Ecke verschwanden. Das Flüchtlingsheim war eine ehemalige Schule, den meisten Fenstern fehlten die Scheiben und im vermüllten Hof wucherte das Gras. Vom geöffneten Tor führte ein breiter Weg zu einem großen, grauen Betonklotz. Auf einer Seite der Einfahrt stand ein weiteres, kleineres Gebäude, wohl ein ehemaliges Wachoder Dienstgebäude, jetzt waren die Fenster mit Sperrholz vernagelt, das sich durch Regen und Sonne schwarz verfärbt hatte und abblätterte. Vor der Tür standen vier Männer, drei Schwarze und ein Asiate, und unterhielten sich leise. Sie starrten lange auf Lorelles Haar und Piercings, musterten dann mich. Einer von ihnen, der über den Dreadlocks ein rot-gelb-grün-schwarzes Rasta-Beanie trug, nickte mir zu und ich nickte zurück. Vor dem Eingang des Hauptgebäudes stritt sich ein Haufen Männer; sie waren unrasiert, schmutzig und eindeutig betrunken. Bei unserem Anblick sahen sie auf und einer von ihnen, der einzige Schwarze, entfernte sich. Der Gestank erschlug uns, noch bevor wir das Gebäude betraten: durchdringend, feucht und ekelerregend. Flüchtlingsheim. Einen weniger heimeligen Ort hatte ich noch nie gesehen.
„Sind wir hier richtig?“, fragte ich Lorelle. Das Gebäude hatte vier Stockwerke, aus den Fenstern oben drangen Stimmen und leise Musik.
„Wir sind hier richtig.“
Auf dem ersten Treppenabsatz befand sich ein Waschraum, dessen Eingang teilweise durch einen Müllhaufen blockiert war, der aus einem Abfalleimer quoll und diesen fast unter sich begraben hatte. Ein Mann mit hagerem Oberkörper und einem Handtuch um die Hüften, das Haar noch nass, kam heraus und stieg vorsichtig über den Unrat.
„Hi“, sagte ich. „We are looking for a friend. Mark Chinomba.“ Sein Blick wanderte von Lorelle zu mir. Er schüttelte den Kopf. „Where he come from?“
„Malawi“, antwortete Lorelle und fragte, weil sein Englisch so holprig war, ob er Deutsch spreche. Er zuckte die hageren Schultern. „Check upstairs.“
Überall an den Wänden im Treppenhaus hingen Flugblätter mit schreienden Parolen Nein zu Grenzen!, No to Illegal Detention! Asyl ist Menschenrecht, Veranstaltungshinweisen auf Englisch und Französisch, die meisten jedoch auf Deutsch: Termine für Theatergruppen, religiöse Zusammenkünfte, Sozialarbeitersprechstunden. Auf dem zweiten Stock begegnete uns niemand, wir bogen nach rechts ab und gingen durch eine Doppeltür in einen langen, dunklen Korridor, der als Rumpelkammer für alte Fahrräder, kaputte Tische und Stühle und anderen Müll diente. Wir standen einer Reihe von Türen gegenüber, die meisten halboffen, man sah Stockbetten mit zerschlissenen Matratzen auf denen Männer schliefen, ihre Beine hingen im Freien. Ich klopfte an eine der Türen und trat ein. Vor einem kleinen Herd, auf dem sich ein Topf befand, stand ein Mann, in der einen Hand ein halbes Hühnchen, in der anderen ein Messer. Der Anblick Lorelles hinter mir brachte ihn aus der Fassung – offenbar gab es in diesem Teil des Flüchtlingsheims nur selten Damenbesuch. Er legte das Hühnchen neben kleingeschnittene Paprika und gehackte Zwiebeln auf den Tisch, wischte sich die Hände an der Hose ab und wandte sich uns zu. Nein, den Namen Mark Chinomba habe er noch nie gehört. „Aus Malawi? Nein, er kann nicht hier sein. Das Zimmer hier ist Senegal.“
Ein anderer Mann saß auf seinem Bett und sah sich auf einem alten Röhrenapparat, der neben dem Bett auf einem Tisch stand, einen Fernsehfilm an. Er blickte nicht auf, während wir uns mit dem Hühnchenmann unterhielten, sondern starrte hingebungsvoll auf den Schirm, dessen Licht ihn beschien, sein Gesichtsausdruck wechselte so rasch wie die Bilder. Auf dem Boden lagen Schuhe und weitere Matratzen verstopften den Durchgang zwischen den Betten. Im Zimmer hing ein widerlicher Geruch nach Essen, müffelnden Schuhen und ungewaschenen Körpern.
„Wo sind die Nigerianer?“, fragte ich neugierig.
Kopfschüttelnd zeigte er nach oben. „Jetzt findest du keine Nigeria. Wenn du Nigeria willst, komm abends. Meiste schlafen jetzt.“
Ich blieb vor der Treppe stehen. Ich war müde und ausgelaugt. „Ich glaube, mir reicht’s.“
Lorelle sah mich an. „Willst du Mark denn nicht finden?“
Im nächsten Stockwerk befand sich ein Raum, der viel größer war, als der vorherige, eine kleine Halle, in der alle Matratzen auf dem Boden lagen. Offenbar waren die meisten Männer hier aus Asien, höchstwahrscheinlich Syrer, Pakistaner, Bangladescher oder Afghanen, dazwischen ein paar Schwarze, alle hatten den gleichen verstohlenberechnenden Blick, alle schüttelten rasch den Kopf, als wir nach Mark Chinomba fragten. Manche lagen auf ihren Matratzen und tippten auf ihren Handys herum, einige saßen an einem Tisch in der Raummitte und stritten beim Kartenspiel. Als wir an weiteren offenen Türen vorbeikamen und über weitere Müllhaufen stiegen, vom Gestank beinahe ohnmächtig wurden, Männern zunickten, die grüppchenweise auf dem Balkon versammelt oder untätig am Fenster standen, kam es mir vor, als schritte ich durch einen Ort aus Dantes Inferno. Niemand kannte Mark. Das oberste Stockwerk war das Frauenstockwerk und schon auf der Treppe konnten wir hören, wie jemand beruhigend auf ein kreischendes Kind einredete. Die durchdringenden Schreie veranlassten mich zum Stehenbleiben.
„Glaubst du, er ist hier, bei den Frauen?“
Sie schüttelte den Kopf. „Nein. Nie im Leben.“
Wir gingen.
Am nächsten Tag rief Lorelle an. „Heute Abend läuft im Neuen Kino eine Doku über Mumia Abu-Jamal. Hat ein Freund erwähnt. Mark ist ein großer Fan von Abu-Jamal.“
Ich hatte keine Ahnung, wer Mumia Abu-Jamal war, notierte mir aber Lorelles Wegbeschreibung. Nach der Vorführung saßen wir in dem kleinen Café neben dem winzigen Kino. An den Nachbartischen unterhielten sich die Leute noch immer über den schonungslosen Dokumentarfilm, den wir gerade gesehen hatten. Mark und Lorelle saßen händchenhaltend auf einem Sofa und Lorelle sah Mark mit einer Zärtlichkeit an, die so gar nicht zu ihrem harten, gepiercten Gesicht passte. Seit über einem Monat hatte sie Mark nicht gesehen. Als wir vorhin reinkamen und ihn an der Theke mit dem Barkeeper reden sahen, waren die beiden aufeinander zugestürzt und hatten sich wild geküsst, während die Leute ringsum Beifall geklatscht hatten. Ich stand da und beobachtete sie, wobei mir kurz durch den Kopf ging, dass Lorelle das Küssen mit all den Ringen in ihren Lippen bestimmt wehtun musste, war von der Szene aber genauso ergriffen wie alle anderen.
„Von Abu-Jamal habe ich heute zum ersten Mal gehört.“
„Wie denn auch?“, lachte Mark. Er wirkte aufgekratzt. „Du wohnst mit deiner schönen Frau in einem großen Haus. Du lebst in Amerika, wo jeder ein Filmstar ist und einen Riesenschlitten fährt.“
„Bei dir hört sich das an, als wäre es eine Sünde oder eine Krankheit, in einem großen Haus zu wohnen.“
„Na ja, ich würde mir keinen Film über Menschen, die in großen Häusern leben, ansehen, über sie auch keine Filme drehen.“
„Das ist fast ein Manifest. Was für Filme würdest du denn machen?“
„Ich sage dir, welche Art Filme ich machen würde. Über einen Mann in einem Tunnel. Einem langen, endlosen Tunnel, an dessen Ende seine Geliebte wartet, aber allmählich begreift er, dass nicht nur seine Geliebte, sondern auch der Tod wartet. Aber wir sehen nie, wie er die Geliebte oder den Tod erreicht, nur eine einzige, lange Einstellung auf ihn im Tunnel, mehr nicht. Es geht um die Reise selbst. Die Ungeheuer, die sich aus der Dunkelheit auf ihn stürzen, existieren sämtlich nur in seiner Phantasie.“
Ich nickte. „Hübsche Allegorie für die menschliche Natur. Schönheit und Tod, Seite an Seite. Wir alle stecken in einem Tunnel, die Liebe treibt uns voran, aber Liebe bedeutet gleichzeitig auch Tod. Begehren heißt sterben.“
„Ja, und nicht zu lieben, bedeutet auch zu sterben“, sagte Mark, ließ Lorelles Hand los und beugte sich vor zu mir. „Wenn ich meinen Film mache, wird der ziemlich avantgardistisch. Marechera. Dostojewski. Caravaggio. Knut Hamsun. So avantgardistisch, dass es einem beim Zuschauen das Herz abdrückt. Was ist der Sinn von Kunst, wenn nicht Widerstand?“
„Widerstand wogegen?“
„Einfach nur Widerstand. Aus Prinzip.“
„Und solche Filme willst du machen?“
„Das ist das Leben, das ich führen will. Kunst und Leben werden eins.“
„Warte nur, bis du älter bist und verheiratet, Kinder hast und Rechnungen bezahlen musst.“
Lachend zuckte er die Achseln. „Vielleicht kommt es dazu ja nie.“
Lorelle hörte zu, den Kopf an seine Schulter gelehnt, und rauchte eine Zigarette. Sie beugte sich vor. „Mark hat einen Kurzfilm gedreht, der hat eine Auszeichnung bekommen.“
Mark hatte einen Film gemacht? Man sah mir meine Überraschung wohl an. Mark lachte und schob Lorelle beiseite. „Ein Kurzfilmchen. Dreißig Minuten lang. Habe ich vor zwei Jahren für ein Seminar gemacht.“
„Aber er hat hier in Berlin einen Regiepreis gewonnen.“
„Toll“, sagte ich. „Über einen Mann in einem Tunnel?“
„Du musst ihn dir ansehen. Ich habe eine Kopie, die kann ich dir leihen“, sagte Lorelle.
Ich wollte mich mit Mark unterhalten, welche Möglichkeiten er jetzt noch hatte, nachdem sein Antrag auf Visumsverlängerung abgelehnt worden war, aber er schien an dem Thema nicht interessiert, und vielleicht war dies ohnehin nicht der richtige Ort.
„Versuch mal, Julius, diesen Anwalt, anzurufen. Wenn möglich, noch heute. Er hat versucht, dich zu erreichen.“ Er nickte und wechselte plötzlich das Thema. „He, hast du nächste Woche Zeit? Da gibt es einen Schallplattenladen, den musst du dir unbedingt ansehen. Der ist gigantisch, der größte in Berlin, vielleicht in ganz Europa.“
„Ich habe Zeit.“
„Gut, dann gehen wir drei dorthin. Danach können wir was essen. Abhängen.“
„Super Idee, aber versprich mir, dass du nicht wieder abtauchst“, sagte ich.
Mark hob sein Bier und zitierte lachend Shakespeare: „When shall we three meet again, in thunder, lightning, or in rain …?“
Er sah glücklich aus und so würde ich ihn immer in Erinnerung behalten, nach vorn gelehnt, um mir zuzuprosten, Lorelle an seiner Seite, denn wie sich herausstellte, war dies unser letztes Zusammentreffen zu dritt.
„When the hurly-burly’s done, when the battle’s lost and won“, ergänzte ich automatisch.
11
Am Tag nach unserem Treffen im Kino brachen die Flüchtlingsunruhen aus, wie es die Zeitungen später nannten. Die Heimbewohner wachten auf und fanden das Gebäude von Polizisten umstellt, die Streifen- und Mannschaftswagen versperrten sämtliche Straßenzugänge. Neben den Mannschaftswagen standen von der Bezirksverwaltung gestellte Doppeldeckerbusse. Einer der Polizisten forderte die Bewohner über ein Megafon auf, ihre Sachen zusammenzupacken und das Gebäude zu räumen – sie hätten sechs Stunden Zeit. Offenbar hatten sich Anwohner bei der Bezirksverwaltung beschwert, sie fühlten sich bedroht, ihre Töchter und Söhne seien nicht mehr sicher auf den Straßen, wo Flüchtlinge Drogen verkauften und sich besoffen prügelten; die Fremden hätten die gesamte Straße in eine Müllhalde verwandelt, überall liege Abfall. Sechs Stunden für die Räumung. Die Busse sollten die Bewohner in ein anderes, außerhalb der Stadt gelegenes Flüchtlingsheim bringen, in der Zwischenzeit durfte niemand das Gebäude betreten oder verlassen. Um die Räumung zu beschleunigen, wurden Wasser und Strom abgedreht. Doch bald hatten Aktivisten in der Innenstadt von der Blockade gehört und versammelten sich auf der Straße, bildeten eine Menschenkette um den Block, solidarisierten sich in Sprechchören mit den Bewohnern und riefen, die Polizei solle abhauen.
„Mark hatte mir eine SMS geschrieben. Als ich ankam, war die Stimmung aufgeheizt. Die Polizei hatte bereits Tränengas gegen die Aktivisten eingesetzt und sie aufgefordert, sich fern zu halten. Sie ließen uns nicht durch die Absperrung“, berichtete Lorelle.
„Wohin hat man sie denn gebracht?“
„Nirgendwohin. Das ist ein beliebter Trick von ihnen. Sie stopfen die Migranten in Busse, mit dem Versprechen, sie anderswo unterzubringen, und setzen sie dann außerhalb der Stadt mitten im Nirgendwo ab.“ Sie nippte an ihrem Tee, als wollte sie den bitteren Geschmack hinunterspülen. „Wie kann man hilflosen Menschen nur so was Grausames antun? Weißt du, was auf den Bussen steht?“
„Was?“
„Fahren macht Spaß. Drumrum Bilder von glücklichen Familien Hand in Hand – Kinder und Eltern und obendrein ein Hund. Der reinste Hohn.“