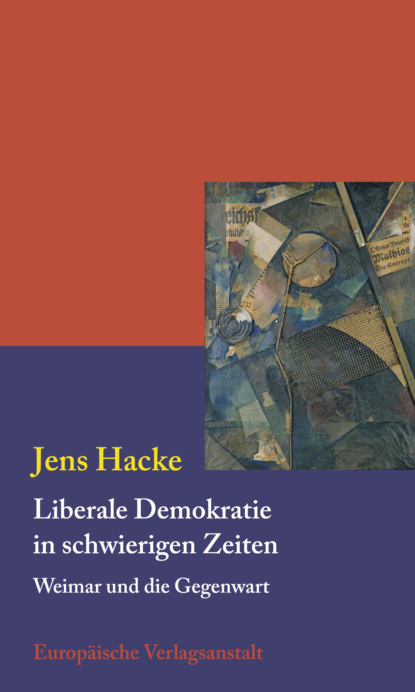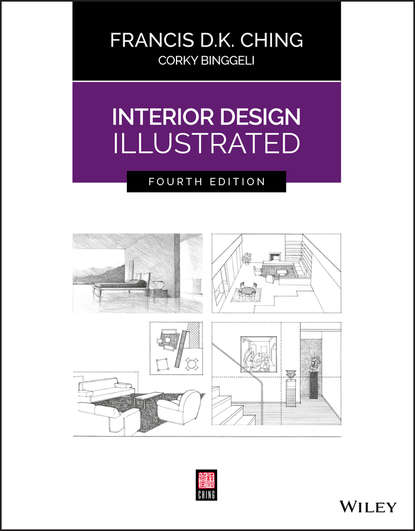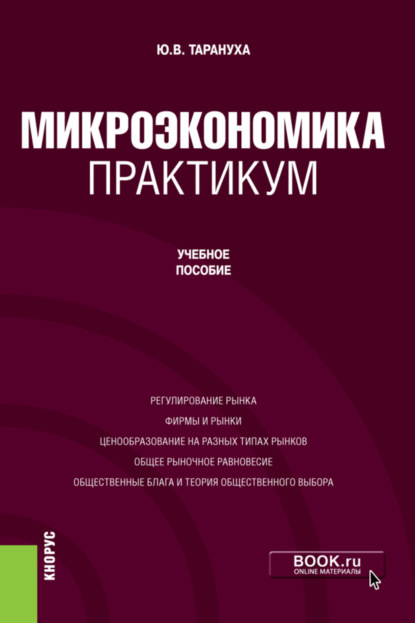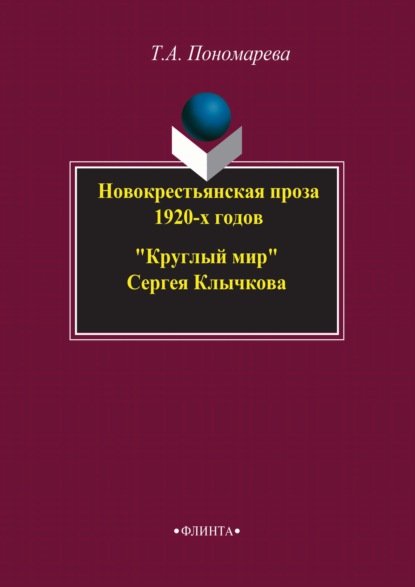- -
- 100%
- +
5. Fazit
Die Ereignisse des Jahres 1918/19 werden bisweilen mit der Epochenzäsur von 1989 verglichen. Tatsächlich liegt ein verbindendes Element darin, dass nicht wenige eine vermeintliche Alternativlosigkeit westlicher Werte zu erkennen meinten. Sicherlich, eine solche Sichtweise ignoriert die parallelen zeitgenössischen Hoffnungen, die sich auf den Sozialismus und die Ausbreitung der Revolution stützten. Aber von liberaler Warte aus wähnte man sich mit der Durchsetzung der liberalen Demokratie an einem „Ende der Geschichte“. In einem „Wilsonian Moment“ glaubte man an die Universalisierung des gerade geborenen westlichen Modells, das Demokratie, liberalen Konstitutionalismus und internationale Verständigung im Rahmen des neu zu gründenden Völkerbundes vereinte.38 So lassen sich – in der Vielfalt der Perspektiven – die Weltkriegsniederlage und die damit einhergehende Staatsgründung in ihren Effekten als eine Transformationsphase begreifen. Unter den Bedingungen der Massendemokratie musste der Liberalismus sich gesellschaftspolitisch in einer Weise modernisieren, die einer Neuerfindung gleichkam.
Der ideelle Aufbruch, als der die Novemberrevolution in vielerlei Hinsicht zu betrachten ist, traf allerdings auf schwierige gesellschaftspolitische und ökonomische Bedingungen. Dazu zählte vor allem die drastische Spielraumverengung für die soziale Demokratie in den Krisen der Republik. Reparationslasten, Inflation und Weltwirtschaftskrise schränkten die Möglichkeiten wohlfahrtsstaatlicher Politik in einer Weise ein, welche die hochfliegenden Hoffnungen auf soziale Gerechtigkeit und Prosperität an fiskalischen Zwängen und an einer auf die Spitze getriebenen Austeritätspolitik zerschellen ließen. Ein weiterer unvorhergesehener Krisenfaktor lag darin, dass der Parlamentarismus – gerade erst mit wirklicher politischer Verantwortung ausgestattet – unter Beschuss geriet. Während sich liberale Theoretiker mühten, die Illusionen einer direkten Demokratie und die Gefahren plebiszitärer Stimmungsschwankungen zu enthüllen, verlor der Weimarer Parlamentarismus rapide an Vertrauen. Der Ruf nach einer starken Exekutive und nach einer autoritären Überwindung gesellschaftlicher Fragmentierung erschwerte daher jede Argumentation für Rationalität, Kompromiss- und Verantwortungsfähigkeit der repräsentativen Regierungsform. Trotz oder gerade aufgrund ihrer realpolitischen Marginalisierung entwickelten allerdings die liberalen Weimarer Demokraten eine bewunderungswürdige theoretische Standfestigkeit.
Die Ideengeschichte lässt sich gewiss nicht als stringente Kette von Lernprozessen und Anpassungsleistungen verstehen. Aber die Krise der Demokratie, ihre enttäuschten Erwartungen und die politischen Niederlagen in Weimar bewirkten langfristig unstreitig eine umfassende Neujustierung liberalen Denkens. Es beinhaltete ein neues Kontingenzbewusstsein, eine Wende zur Skepsis und den geschärften Sinn für politische Gewalt. Das Wissen darum, dass demokratische Gesellschaften nicht davor gefeit sind, in zivilisatorische Regression und eine Herrschaft des Unrechts abzugleiten, prägte ein normativ erneuertes, aber zugleich realistisch gewordenes liberaldemokratisches Denken.39
Demokratie, so die aus der fragilen Weimarer Republik gewonnene Grundeinsicht, war nur als parlamentarisch-repräsentative Regierungsform funktionsfähig, benötigte eine strikte Gewaltenteilung und durfte den Pfad der freiheitsgarantierenden Rechtsstaatlichkeit nicht verlassen. Doch darin erschöpft sich das Vermächtnis der liberalen Weimarer Demokraten nicht. Sie wussten auch, dass die demokratische Verfassung keine Existenzgarantie kennt. Hans Kelsen sah den Identitätskern der Demokratie darin, ihren Feinden nur mit Argumenten begegnen zu dürfen. Gegen eine demokratische Selbstpreisgabe gab es aus seiner Sicht kein probates Mittel.40 Diese Haltung rief bei wehrhaften Republikanern Widerspruch hervor. Aber auch sie sahen, dass Republik- und Verfassungsschutzmaßnahmen stumpfe Schwerter blieben, solange sie sich nicht auf breite Mehrheiten stützten. Kelsen hatte erkannt, dass die Demokratie ethisch autark war, also ihre Bestandsvoraussetzungen selbst erhalten und pflegen musste. Dazu braucht es die erneuerungsfähige Vision einer demokratischen Gesellschaft, die Erziehung zur Demokratie, alltägliche Einübung ihrer Praktiken, die Pflege ihrer Institutionen und die Sorge um die sozial Benachteiligten.
Die Demokratiedebatte der Zwischenkriegszeit gehört fraglos zu den Sternstunden der politischen Ideengeschichte. In der Auseinandersetzung mit den Vordenkern der liberalen Demokratie lässt sich der existenzielle Ernst der Argumentation nachempfinden. Ihre Einsichten bleiben aktuell, weil sie uns daran erinnern, wie anspruchsvoll das Projekt der liberalen Demokratie tatsächlich ist.
Max Weber – Interpret der Moderne an der Schwelle zur Demokratie
Der Rang eines Klassikers kommt demjenigen zu, dessen Werk und Thesen genug Denkanstöße liefern, die über die Zeiten hinweg Herausforderungen stellen. Das ist bei Max Weber in hohem Maße und bei anhaltender Wirksamkeit der Fall, und zwar fächerübergreifend. Soziologen, Historiker, Politikwissenschaftler, Staatsrechtler – sie alle verwenden Webersche Terminologien, arbeiten sich an den Kategorien der Herrschaftssoziologie ab, stehen im Schatten von Webers desillusionierter Entzauberung der Moderne, die im Modus von Bürokratisierung und Rationalisierung ihr „stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit“ errichtet hat. Weber erkannte früh, dass sich der Mensch institutionelle und technische Umwelten schuf, die die Handlungsmöglichkeiten des Individuums unentrinnbar bestimmten. Die nachfolgende zweite Soziologengeneration nannte dieses Phänomen in den Fußstapfen Webers „sekundäre Systeme“ oder „Superstrukturen“.
Das eigentliche Faszinosum liegt darin, dass Weber zu Lebzeiten eigentlich gar kein lesbares Buch publizierte. Wer greift heute freiwillig zur Habilitation über die Römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht (1891) oder liest noch einmal mehrhundertseitige Enqueteberichte über die ostelbischen Landarbeiter (1892)? Auch das vor Begriffs- und Typenbestimmungen berstende Großwerk aus dem Nachlass Wirtschaft und Gesellschaft (1922) ist ohne Register kaum zu benutzen, weil nur wenige Leser Webers wissenschaftliche Prosa länger als zehn Seiten durchhalten. Nein, die Klassizität Webers ist nicht einem einzelnen Buch oder seiner stilistischen Brillanz geschuldet, sie liegt in der Eindringlichkeit seines Anliegens und in der Leidenschaftlichkeit seines Fragens verborgen. Weber arbeitete sich durch ungeheure Stoffmassen, versuchte sein Material durch multidimensionale Herangehensweisen zu erschließen und ließ keine einfachen Antworten gelten. Das Berserkertum seines „wühlenden Geistes“ hinterließ kein gerundetes Werk, sondern einen massiven Torso ungebändigter Gedankenfülle. Dabei war er ein Modernisierer und Organisator der Wissenschaft, dem es ungeachtet der politischen Tendenz allein darauf ankam, ob eine These gut begründet und belegt war. Bekanntheit erlangte Weber über die Aufsatzfolge zur protestantischen Ethik, die den Aufstieg des Kapitalismus aus dem asketischen Geist des Puritanismus erklärte. Auch seine späte politische Publizistik trug zur Begründung seines Ruhmes bei, denn in seinen intellektuellen Interventionen machte Weber die Erträge seiner Herrschaftssoziologie für die Überlegungen zu „Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland“ fruchtbar, während seine epochalen Reden zu „Wissenschaft“ respektive „Politik als Beruf“ bis heute ihre Frische bewahrt haben. Knapp vier Jahrzehnte mühte sich das Riesenunternehmen einer meterlangen} Gesamtausgabe, Webers Denkwege begehbar zu machen und nach allen Regeln historisch-kritischer Edition wissenschaftlich aufzubereiten. Kein Jugendbrief ging verloren, kein Bericht über einen Vortrag Webers in der Lokalpresse blieb unerwähnt.
Seine Ausnahmestellung als universalhistorisch denkender Soziologe, der von der Landwirtschaft zum Börsenwesen, vom antiken Judentum zum Konfuzianismus, von der Musiksoziologie bis zur Wissenschaftstheorie eine ungeheure Vielfalt an Themen erforschte, ließ es lange unmöglich erscheinen, den „ganzen Weber“ ins Blickfeld zu bekommen, zumal die Widersprüche seiner vielfach gebrochenen bürgerlichen Existenz kaum ins Bild des Rationalitätsdenkers und unerbittlichen Realisten zu passen schienen. Erst der Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis unternahm es in seinem Spätwerk, Max Webers Fragestellung (1987) als biographisch existentielles Problem in den Mittelpunkt zu rücken. 2005 erschien dann – acht Jahrzehnte nach Marianne Webers „Lebensbild“ ihres Gatten – die erste wissenschaftliche, wahrlich fulminante Biographie von Joachim Radkau, der eine charakterologische, psychologisch sensible und kulturgeschichtlich eingebettete Deutung Webers lieferte. Radkau machte den Olympier menschlich, leuchtete neben dem Werk die Abgründe seiner Psyche und Süchte ebenso aus wie Webers komplizierte erotische Natur zwischen Kameradschaftsehe und späten erfüllenden Liebesaffären.
In Webers Lebensspanne fiel die Sturzgeburt der Industriemoderne in Deutschland. Die groß- und bildungsbürgerlichen Werte, die seine Erziehung prägten, verloren in einem nervösen Zeitalter des Wandels rasch ihre Orientierungskraft. Weber litt zwar an der Krise des Bürgertums, das trotz seiner ökonomischen Machtstellung im Kaiserreich in politischer Passivität verharrte. Aber er beließ es keineswegs beim Ressentiment – wiewohl er als junger Mann mit der politischen Rechten flirtete und dem nationalistischen Alldeutschen Verband eine Zeit lang angehörte –, sondern stand auf dem Boden der Moderne. Er knüpfte enge Bande mit führenden linksliberalen Köpfen wie Friedrich Naumann und Lujo Brentano, um sich für politische und gesellschaftliche Modernisierung einzusetzen. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges riss ihn die patriotische Welle zunächst mit, aber Weber ernüchterte schnell und gehörte bald zu den wichtigsten Kritikern der Monarchie, prangerte ausufernde Kriegsziele an und setzte sich für Parlamentarisierung und Demokratisierung ein. Als prominenter Beiträger der Frankfurter Zeitung, Mitbegründer der liberalen DDP und Vordenker der Weimarer Verfassung war er eine Galionsfigur der politischen Erneuerung. Auf die Politik wirkte er als Ideengeber, als Politiker scheiterte er hingegen kläglich. Dem Verfechter eines unerbittlichen Realismus fehlte jedes Gespür für parteitaktische Manöver und strategisches Handeln, sein Temperament ließ sich schwer zügeln. Die Autorität seiner politischen Urteilskraft blieb davon jedoch unberührt. Weber hinterließ nach seinem frühen Tod an den Folgen einer Lungenentzündung im Sommer 1920 bleibenden Eindruck bei einer Reihe jüngerer Gelehrter wie Theodor Heuss, Karl Jaspers, Karl Loewenstein, Karl Löwith, Helmuth Plessner oder Carl Schmitt. Seine Elitentheorie der Demokratie, die Parteienwettstreit und Parlamentarismus als Methode der geeigneten Führerauslese wertschätzte und am Ende seines Lebens eine Wendung zum plebiszitär legitimierten charismatischen Führer nahm, lieferte Argumente für Vernunftrepublikaner, die sich nicht umstandslos von der Vorstellung eines personalen Regiments lösen konnten. Die durch Direktwahl bedingte starke Stellung des Reichspräsidenten im Verfassungsgefüge der ersten deutschen Demokratie verdankt sich nicht zuletzt den Vorstellungen Webers. Aber war er deswegen der Ahnherr des plebiszitären Führerstaates?
Die Fragen, wie sich Weber in den bewegten Jahren der Weimarer Republik positioniert und wie er sich gegenüber dem Nationalsozialismus verhalten hätte, haben von jeher die Phantasie der Ideengeschichte angeregt. In der Phase einer kritischen Aufarbeitung des deutschen Sonderwegs überwog die Verurteilung von Webers Nationalismus und die Skepsis, ob sein Einfluss auf das politische Denken in Deutschland denn so segensreich war. Wolfgang Mommsen hatte in seiner bahnbrechenden Studie über Max Weber und die deutsche Politik (1959) seine Orientierung am nationalen Machtstaat und die damit einhergehende Vernachlässigung demokratischer Grundwerte herausgearbeitet. Damit benannte er einen wunden Punkt: In der Tat lässt sich bei Weber kaum etwas für eine normative Theorie der Demokratie lernen, und seine kühle Diktion favorisiert die charismatischen Entscheider, verzichtet aber weitgehend auf moralische Leitlinien, partizipative Elemente und eine Aufgabenbestimmung des sozialen Rechtsstaates. Der junge Jürgen Habermas konnte anlässlich der Tagung zum hundertsten Geburtstag im Jahr 1964 noch von der unheilvollen Wirkung eines „militanten Spätliberalismus“ sprechen und kam nicht daran vorbei, „daß Carl Schmitt ein legitimer Schüler“ beziehungsweise, wie er sich verbesserte, „ein ‚natürlicher Sohn‘ Max Webers“ war.
Der Umgang mit Weber hat sich deutlich entspannt. Derjenige, der in überzogener Drastik die Verantwortungsethik gegen die Gesinnungsethik absetzte – und selbst von politischer Leidenschaft getrieben blieb –, wird nun nicht mehr über Gebühr zur Verantwortung für Deutschlands Weg in die Katastrophe gezogen. Wie unsinnig eine derartige Personalisierung wäre, kann man übrigens bei Weber lernen. Er hatte stets auf die Kulturbedeutung von Religion, Ideen und Ideologien gepocht, die eben in sozialen Formationen wirksam werden, aber nicht als Schöpfung großer Einzelner zu begreifen sind. Webers Leben bietet – das läßt ihn neben Thomas Mann noch einmal als einen der letzten großen Vertreter des klassischen Bürgertums erscheinen – den Stoff für einen Bildungsroman. Auch die neueren Biographien von Jürgen Kaube und Dirk Kaesler präsentieren Weber als eine Person, deren übersensibler und wacher Intellekt die Spannungen eines Zeitalters sichtbar macht. Er muss Abschied nehmen vom klassenbewussten großbürgerlichen Hochmut und geht im Laufe seines Lebens auf Abstand zu den forschen Generalisierungen eines bornierten Wilhelminismus. Die Komplexität der Moderne ist für ihn nur durch eine gedankliche Anstrengung zu erfassen, die Ambivalenzen und Widersprüche verarbeitet, wo das Gute, Heilsbringende zugleich problematisch wird und der Mensch immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten der Kompensation und der Korrektur von unerwarteten Nebenfolgen bleibt.
Webers tragisches Pathos fasziniert uns hundert Jahre später immer noch. Gutmenschentum, Moralismus und Idealismus verachtete er zwar mit übertrieben anmutender rhetorischer Härte – nichts war ihm verhasster als der politisierende „Literat“ –, aber seine Frage nach den Freiheitsräumen des Einzelnen, dessen Schicksal unentrinnbar dem Kapitalismus und den bürokratischen Staatsapparaten ausgeliefert war, bleibt von evidenter Aktualität. Die sich akkumulierenden Sachzwänge der industriellen Massengesellschaft hat er als gelehriger Leser von Karl Marx früh gesehen, und er war umsichtig genug, die politischen Konflikte nicht allein aus materiellen Interessen und den Produktionsverhältnissen zu erklären. Aber was blieb dem Individuum aus Webers Sicht übrig? Heroische Selbstbehauptung, die Wahrung eines letzten persönlichen Entscheidungsraumes oder ein Restbestand von demokratischer Freiheit, die in der „Unterordnung unter selbstgewählte Führer“ bestünde? Sein rettender Glaube richtete sich auf den charismatischen Politiker, der tatsächlich noch zur Entscheidung und politischen Führung in der Lage sein sollte. Schon Joseph Schumpeter hatte sich von dieser Erlösungssehnsucht entfernt und seine „realistische Demokratietheorie“ im Sinne eines marktkonformen Konkurrenzmodells entwickelt, in dem oberflächliche Werbungsmechanismen die letzten Wertentscheidungen, die Weber so wichtig waren, verdrängten.
Webers Platzierung im (spärlich besetzten) Pantheon des deutschen Liberalismus zeigt uns auch, dass das Verständnis von Politik stetiger Historisierungsanstrengungen bedarf. Kampf, Wettstreit, Selbstbehauptung – diese heroische Attitüde Webers wirkt im Zeitalter eines politisch korrekten Konsensliberalismus antiquiert. Gleichzeitig machten wir es uns zu leicht, würden wir den Weberschen Tugendkatalog vorschnell entsorgen und seine altertümlich wirkende Frage nach dem „Menschentum“ in der Moderne gleich mit entrümpeln. Die große Frage, wie der Mensch in selbstgeschaffenen Strukturzwängen handlungsfähig und frei zur Entscheidung bleibt, behält ihre Aktualität. Weber mag sich nicht um eine normativ avancierte Definition von Freiheit oder sozialer Gerechtigkeit gekümmert haben; er wollte das So-Gewordensein der modernen Welt begreifen, warb für eine „Realpolitik auf dem Boden des nun einmal unabänderlich Gegebenen“, anstatt auf politische Handlungsempfehlungen aus dem Korsett einer geschlossenen politischen Theorie zu hoffen. Webers politisches Denken ist konstellationsabhängig und kontingenzbewusst, und nachdem der Glaube an die alleinseligmachende Kraft der Theorie, die den Schlüssel zur Lösung der Weltproblem liefern sollte, langsam verpufft ist, wirken auch Webers mächtige Grundbegriffe wie Urteilskraft, Lebensführung, Verantwortung, Herrschaft nicht mehr ganz so archaisch. Dass es in der Politik auf persönliche Orientierung, auf die Rechtfertigung von politischen Handlungen im Blick auf klar formulierte Ziele und auf Haltung ankommt – dieser Maßstab Webers darf weiterhin Gültigkeit beanspruchen.
Weber-Biographik – neuere Forschungen
„Die wissenschaftliche Arbeit ist eingespannt in den Ablauf des Fortschritts“, wusste Max Weber, denn jede Forschung warte auf Revision, werde überholt und mache neuen Einsichten Platz. Diesen ungebrochenen Glauben an die Perfektabilität wissenschaftlicher Erkenntnis wird man im Hinblick auf die Geisteswissenschaften oder gar für das Genre der Biographik nur schwer aufrechterhalten wollen. Die Verbreiterung der Quellenlage und des Faktenwissens bietet noch keine Garantie dafür, dass eine neue Interpretation überzeugender gelingt. Ganz davon abgesehen, dass das Narrativ eines Lebens der Dramatisierung, Wendepunkte und Leitmotive bedarf, bleibt auch die werkbiographische Deutung von der Perspektive und den Fragen der eigenen Zeit geprägt. Maßstäbe verschieben sich. Klassiker durchlaufen verschiedene Rezeptionswellen und Neuentdeckungen; für wenige moderne Autoren gilt dies so sehr wie für Max Weber. Als Theoretiker der Rationalisierung und Bürokratisierung, Schöpfer soziologischer Grundbegriffe, der Herrschafts- und Religionssoziologe, Künder des politischen Charismas, Erfinder des Idealtypus und Streiter für die Offenlegung der Werturteile in der Wissenschaft lieferte er à la mode das jeweilige Methodenbesteck. Mit Weber als Giganten der Sozialwissenschaft ließ sich Wirklichkeit durchdringen, Objektivität und Rationalität sichern, das galt vom Proseminar bis zur Doktorarbeit. Der Rationalitätspionier moderner Wissenschaftlichkeit konnte säuberlich vom leidenschaftlich-nationalen Publizisten getrennt werden, für die Einsicht in den okzidentalen Rationalismus waren Kenntnisse um die labile psychische Konstitution des Theoretikers nicht erforderlich, zumal dessen Lebensumstände in den Grundzügen aus dem von seiner Gattin Marianne verfassten, heroisierenden „Lebensbild“ (1926) bekannt waren. Weber war einerseits der unbestrittene Fixpunkt in einer postgeschichtsphilosophischen Epoche des Theorie- und Methodenglaubens, als die Historische Sozialwissenschaft Bielefelder Prägung reüssierte. Andererseits eignete sich sein politisches Denken, wie spätestens Wolfgang J. Mommsens großartige Studie zu Max Weber und die deutsche Politik (1959) zeigte, zur umfassenden Auseinandersetzung mit dem Sonderweg des deutschen Liberalismus. War Weber doch ein „militanter Spätliberaler“ (Habermas), der die Bahn für den plebiszitären Führerstaat ebnete? Oder hätte – wie nicht wenige meinten – seine intellektuelle Autorität den Vernunftrepublikanismus der Weimarer Republik entscheidend gestärkt?
Kurz: Die Kampfplätze, auf denen Webers Werk zum Einsatz kam, waren so divers, das Material so überwältigend, dass das Vorhaben einer Biographie des Meisterdenkers mit dem Fortgang der alles in den Schatten stellenden kritischen Gesamtausgabe immer weniger realisierbar erschien. Es waren zwei kritische Bewunderer Webers, Wilhelm Hennis und Ralf Dahrendorf, die sich in den 1980er Jahren gegen den Trend der Spezialisierung wandten: Hennis’ Beschäftigung mit Weber bedeutete eine Revision der eigenen Haltung, denn noch zwanzig Jahre zuvor hatte er den durch Parsons reimportierten Rationalisierungs-Weber vehement vom Standpunkt einer praktischen Politikwissenschaft bekämpft, die sich gegen dessen vermeintlichen Positivismus respektive gegen dessen Verzicht auf Normen und Zwecksetzungen richtete. In seinen späten Studien identifizierte Hennis indes Max Webers Fragestellung nach der conditio humana in der Moderne, nach der Lebensführung und nach politischer Verantwortung als Zentrum des Werkes. Webers Antworten mussten dazu aus den Debatten seiner Zeit decodiert und historisch vergegenwärtigt werden. Auch Dahrendorf plädierte – mit deutlicher Stoßrichtung gegen die geschichtsvergessene Zeitdiagnostik der Soziologie – für den Versuch, „Webers Leben, sein Werk und seine Zeit zu einem Gesamtbild“ zusammenzufügen, um „damit auch der sterilen Landschaft der modernen Sozialwissenschaft etwas von ihrem einstigen Zauber“ zurückzugeben.
Diese Wiederverzauberung gelang vor einem knappen Jahrzehnt einem Seiteneinsteiger. Der Kultur- und Umwelthistoriker Joachim Radkau verblüffte die Fachwelt und faszinierte eine breite Leserschaft mit einer fulminanten Biographie, die jeden postmodernen Zweifel am Genre souverän ignorierte: Familie, Epochenprägung, Sexualität, Krankheitsgeschichte, Sucht und Leidenschaft verwob Radkau zu einer Lebenserzählung, die Webers intellektuellen Denkweg umso faszinierender machte, je klarer die Abgründe erkennbar waren, die Webers Psyche offenbarten. Dass der von der Natur „vergewaltigte“ und später von Depressionen heimgesuchte Weber schließlich im Tunnel von Bruchsal mit Else Jaffé-Richthofen die erotische Erlösung fand, ist nur eine Pointe, auf welche die Weber-Orthodoxie Radkaus Enthüllungsbuch zu reduzieren suchte. Zu Unrecht, denn Radkaus charakterologische Studie bietet weit mehr als Freudianismus und Psychohistorie. Man mag darüber streiten, ob das Ausleben masochistischer Phantasien zur finalen sexuellen Befreiung Webers geführt hat, ob die Diagnose einer Schizophrenie wirklich stichhaltig oder ob der versteckte Naturalismus die geheime Triebfeder seines Denkens war. Die nur leicht überarbeitete Neuauflage von Radkaus Werk präsentiert sich aber nicht zuletzt deshalb so frisch, weil der Bielefelder Historiker Webers Leben originell beleuchtet und ihn gerade nicht als einsamen Solitär, sondern als kommunizierenden, streitenden und in Debatten eingebundenen Gelehrten präsentiert. Wenn Radkau die spannungsreichen intellektuellen Freundschaften zu Friedrich Naumann, Werner Sombart, Ernst Troeltsch oder Robert Michels schildert, läuft er zu Höchstform auf.
Webers Vielseitigkeit, sein fast maßloser Erkenntnishunger und sein Ringen um Erklärungen, die das So-Geworden-Sein der modernen Welt dechiffrieren, machten ihn zu einem Komplexitätsdenker, der keine vereinseitigenden Thesen zuließ. Radkaus Biographie offenbart, dass Webers häufig gepriesener Realismus am ehesten in seinem vieldimensionalen Problembewusstsein, in der dauernden Anstrengung um Selbstkontrolle und im Aushaltenmüssen von Widersprüchen zu orten ist. Radkau wählt mit Bedacht den Leitbegriff der „Leidenschaft“, um Webers Motivationsgründe zu beschreiben: „Die Leidenschaft zur modernen Wissenschaft läßt sich aus keinem großen Ziel keinem höheren Sinn herleiten. Weber schwieg, wenn man ihn nach einem Lebenssinn der Wissenschaft fragte“, man könne sich seinen Drang zur Wissenschaft eben nur „als einen naturhaften Trieb“ vorstellen. Das mag aus philologisch-hermeneutischer Sicht unbefriedigend bleiben, macht aber deutlich, dass sich besondere Begabung und wissenschaftliche Leistungen –Verirrungen inklusive – eben nicht immer auf rationale Gründe oder gute Absichten zurückführen lassen. Erst recht nicht bei jemandem, dessen „heroischer Skeptizismus“ (so Ernst Troeltsch in seinem Nachruf) ihn dazu brachte, der „Forderung des Tages“ gerecht zu werden, die für Weber bekanntlich lautete, dass „jeder den Dämon findet und ihm gehorcht, der seines Lebens Fäden hält“.
Weil es Radkau gelang, Weber zu historisieren, sein psychisches Martyrium zu schildern, seine politischen Irrungen und Lernprozesse offenzulegen, ohne dass dieser Ausnahmegelehrte an Faszination einbüßte, durfte man gespannt sein, welche neuen Akzente die Biographien des Jubiläumsjahres von Dirk Kaesler und Jürgen Kaube setzen würden. Kaesler weckte besondere Erwartungen: Zum einen hatte er sich seit Jahrzehnten mit Weber beschäftigt, zum anderen widmete er dem Konkurrenten Radkau seinerzeit einen harschen doppelseitigen Verriss im Spiegel. Kein kluger Schachzug. Dadurch senkt sich für jeden Rezensenten nun die Hemmschwelle, das Urteil über Kaeslers desaströs missratene Darstellung mit höflichen Floskeln zu kaschieren. Geschrieben sei das Buch, so Friedrich Wilhelm Graf völlig zutreffend in der Süddeutschen Zeitung, „in einem teils grausam unbeholfenen, teils peinlich pathetischen Deutsch, das die Lektüre zu einer Qual macht“. Was Graf damit meint, wird schnell klar, wenn man das Buch an einer beliebigen Stelle aufschlägt. Gravitätisch und verschmockt ist stets vom „Herrn Studiosus“, „Herrn Doktor“ oder „Herrn Professor“ und fast durchgängig von „Max Weber jun.“ die Rede; dauernd wird eine „Bühne bereitet“, auf der vermeintlich bürgerliche Formen nachgespielt werden; die Hälfte des Textes besteht aus seitenlangen Zitaten, die zumeist Mariannes „Lebensbild“ entnommen sind. All dies geschieht, weil der Autor keinen eigenen Erzählfaden außerhalb der Chronologie, keine Leitmotive und keine eigene Sprache findet, auf über 930 Textseiten aber auf jeden Quellenbeleg verzichtet. Es ist in der Tat kaum ein Leser vorstellbar, der sich durch diese Anhäufung von Fakten wühlt, ohne an der Unfähigkeit des Autors zu verzweifeln, Wichtiges vom Irrelevanten zu trennen. „Max Weber ist nicht unser Zeitgenosse“, für sein Leben gibt es „keinen Regisseur, aber viele Mitwirkende“ – diese pompös servierten Banalitäten sind enervierend. Zudem ist es ein Ärgernis, dass Kaesler sich allzu häufig hinter dem Urteil anderer Weber-Interpreten verschanzt, anstatt zu eigenen Schlüssen zu kommen.