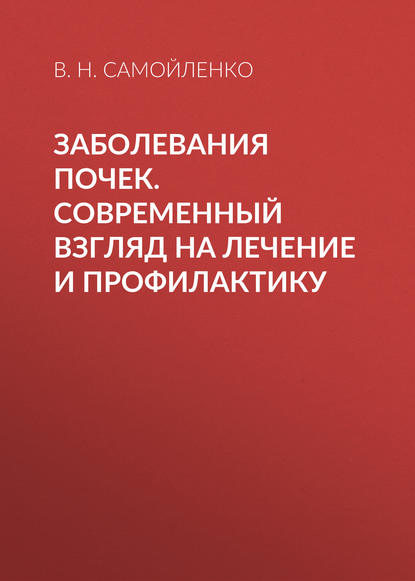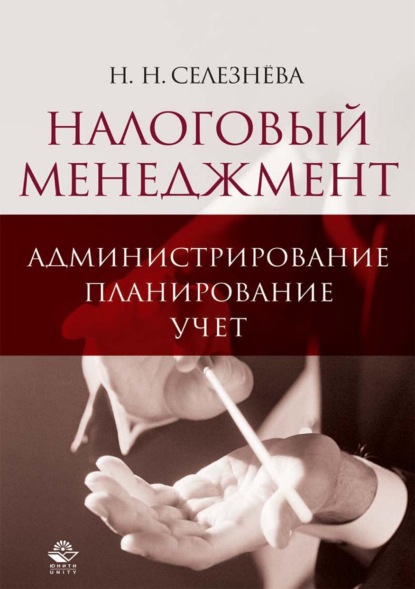Colt-Helden: Super Western Sammelband 7 Romane
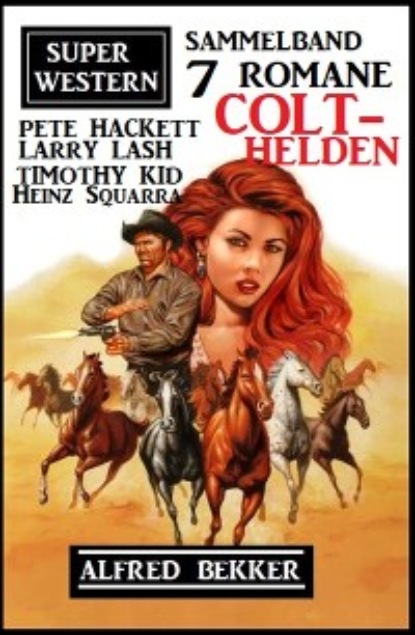
- -
- 100%
- +
Jeff Logans Leiche lag daneben auf der Decke. Die Stangen waren abgeschnitten. Man hatte sie achtlos ins Gestrüpp geworfen.
»In Ordnung, das reicht!« Stadtmarshal Cobb stieß Jay zur Seite. »Holt jetzt den anderen!«
Jay protestierte nicht, weil das zwecklos bleiben würde.
Sie eskortierten ihn zurück, banden ihm die Füße zusammen und warfen ihn über das Pferd.
»Hör zu, wir brauchen nur einen von euch, um die Bucks zu finden«, erklärte der Marshal an Rio gewandt, den sie indessen vom Pferd zogen und von den Fußfesseln befreiten.
»Hab ich schon gehört.«
»Dann ist ja alles klar. Zeigt ihm den Toten noch mal. Keiner wird uns nachsagen, dass wir Unmenschen wären.«
»Dummköpfe seid ihr«, gab Rio zurück. »Hirnverbrannte Narren, die das Geld nie finden werden!« Er lachte schallend.
Jay hörte, dass sie ihn dafür niederschlugen. Rio musste verrückt sein, sich wieder mit ihnen anzulegen, wo er doch wirklich keine Chance gegen sie besaß.
»Weiter!«, kommandierte Marshal Cobb. »Und macht es bei ihm kurz!«
Jay hörte sie weitergehen.
»Du kannst von Glück reden, dass unser Marshal so human ist«, sagte einer. »Wir hätten euch Strolche schon aufgeknüpft. Soll doch aus McClures Geld werden, was will. Uns gehört es doch nicht. Und wir kriegen auch nichts davon. Cobb wirft es der Kasse des Gouverneurs in den Rachen, wenn sich kein anderer Erbe findet.«
Es dauerte nicht lange, dann brachten sie Rio Shayne zurück und warfen ihn wie Durango über das Pferd, fesselten ihm die Beine und gaben immer neue Drohungen von sich.
Jay hörte, wie sie das Grab zuschaufelten. Er fragte sich, ob Jeff je eine Chance hatte, die Verletzung zu überleben, oder ob der Blutverlust von Anfang an zu hoch war. Er wusste es nicht. Sicher würde das für immer ein Geheimnis bleiben. Aber direkt getötet hatten ihn diese Männer, weil sie ihn transportieren mussten. Weil er allein da draußen nicht liegen konnte. ,
Das Pferd bewegte sich und wirbelte neuen Staub mit den Hufen auf, die Durango ins Gesicht trafen. Die Übelkeit überkam ihn abermals und begann seine Gedanken zu verwirren.
*
Jay saß auf einem Stuhl im spartanischen Office des Marshals, das schmal wie ein Handtuch war und rohe Bretterwände auf drei Seiten besaß. Die vierte Seite bestand aus einem Eisengitter. Es reichte vom Boden bis zur Decke. Dahinter befand sich eine Zelle, in der vier einfache Holzpritschen standen. Ein Lichtschacht führte nach draußen.
Jays Blick kehrte ins Office zurück. Vor ihm thronte der Marshal hinter einem Schreibtisch. Und hinter ihm standen zwei Männer mit Colts in den Händen. Sie schienen noch hier in erheblicher Sorge zu sein, dass er ihnen entwischen konnte.
In der geräumigen Zelle erhob sich Rio Shayne von einer der primitiven Pritschen und trat ans Gitter.
Cobb brannte sich eine Zigarre an und rieb das Schwefelholz zwischen den Fingern aus. Er blies Jay den Qualm entgegen und rollte die Zigarre von einem Mundwinkel in den anderen. »Wir müssen es wissen, egal, wie wir es aus euch herausholen.«
Jay schenkte sich die Mühe, den Mann davon überzeugen zu wollen, dass er auf der falschen Spur saß. Cobb würde sich davon nicht überzeugen lassen. Zu fest saß ihnen allen schon in den Köpfen, wie das mit dem Mord auf der Overlandstraße vor sich gegangen sein musste.
Dennoch sagte er: »Kalkulieren Sie gar nicht ein, dass ein paar Wegelagerer den Wagen gesehen und überfallen haben könnten?«
Cobb. nahm die Zigarre aus dem Mund. »Du hast kalkuliert, dass wir dir das schließlich abnehmen müssten, wenn wir die Bucks nicht finden. Aber das ist falsch. Versehentlich nahmt ihr ja auch die Tasche mit. Die habt ihr vermutlich erst weggeworfen, als wir schon in der Nähe waren. Da ist euch sozusagen in letzter Minute noch was gedämmert!«
Jay lehnte sich zurück. Die Mündung eines Revolvers berührte seinen Nacken und ließ ihn fösteln. »Hätten wir den schmierigen Kerl überfallen, wären wir mit dem Geld abgehauen!«
»Eben nicht.« Cobb klemmte die Zigarre wieder zwischen die Lippen. »Weil ja noch der Verletzte in der Hütte lag.«
Einer der Wächter gähnte demonstrativ. »Wollen wir ihn nicht endlich so durch die Mangel drehen, dass ihm die Worte von selbst aus dem Mund fallen? «
»Schlage ich auch vor!«, stimmte der andere prompt zu.
Marshal Cobb überlegte. »Wir haben keine Befugnis, jemand zu foltern, nur weil er uns etwas verschweigt. Ihr müsstet die Gesetze eigentlich kennen!«
»Was heißt denn hier foltern, Marshal. Ein bisschen nachhelfen, nichts weiter. Hier, so!«
Jays Kopf wurde an den Haaren nach hinten gerissen.
Der andere Kerl trat vor und zielte mit dem Revolver auf sein Gesicht. Er grinste teuflisch und spannte den Hammer. »Na, du Hund, singst du jetzt?«
»Aufhören!« Der Marshal sprang empor und verlor die dicke Zigarre aus dem Mund.
Jay wurde losgelassen. Der zweite Mann trat zur Seite.
»Auf einen Halunken wie den achtet ohnehin niemand, Marshal. Ich würde sagen, wir hängen ihn auf und lassen den anderen dabei zusehen. Der redet dann. Wollen wir wetten?«
Cobb nahm die Zigarre vom Tisch und setzte sich. »Sperrt ihn ein. Ich muss darüber nachdenken.«
»Blödsinn, die Zeit verstreichen zu lassen!« .
»Sage ich doch!« Der zweite Mann fuchtelte noch mit seinem gespannten Revolver herum.
»Sperrt ihn ein!«, herrschte Cobb sie an. »Noch bin ich der Marshal von Montrose!«
Jay stand auf. Der eine Kerl ging an ihm vorbei und schloss die Zelle auf, während der zweite ihm die Mündung des Colts in den Rücken bohrte.
Marshal Cobb hüllte sich in eine blaue Qualmwolke, die sein heftiges Paffen rasch vergrößerte.
»Marsch, Rothaut!«
Jay ging in die Zelle, scheppernd schlug hinter ihm die Tür zu.
»Darf man fragen, ob es hier irgendwann mal was zu essen gibt?«, erkundigte sich Rio.
»Das könnte euch so passen, von uns auch noch durchgefüttert zu werden!« Die Stimme des kleinen Kerls klang keifend.
»Selbstverständlich kriegt ihr auch was zu essen«, sagte der Marshal barsch.
»Was kriegen die?«
»Wir werden unsere Gefangenen nicht verhungern lassen, auch Mörder nicht!«
Jay setzte sich auf eine Pritsche, starrte die Dielen an und fragte sich, wie sie aus diesem Teufelskreis noch einmal hinauskommen könnten. Dann hatte er eine Idee, stand auf und kehrte ans Gitter zurück. »Wir kommen von einer Ranch im Osten. Von Rancho Bravo, Marshal.«
Cobbs Gesicht sah abwartend aus. »Na und?«
»Kennen Sie die Ranch?«
»Ich kann nicht jede Ranch in Texas kennen, verdammt. Nein, auch nicht Rancho Bravo.«
»Aber die ist von hier nur vierzig Meilen entfernt!«
»Ist mir doch egal.«
»Was soll denn jetzt kommen?« Der kleine Kerl kicherte. »Was willst du uns jetzt für einen Bären aufbinden?«
»Wir gehören zu dieser Ranch. Ich bin dort Vormann.«
Der Marshal grinste, und die beiden anderen brachen in lautes Gelächter aus.
»Damit rückst du jetzt heraus?« Cobb rollte die Zigarre in den anderen Mundwinkel.
»Es sind nur vierzig Meilen«, sagte Jay noch einmal mit Nachdruck. »Schicken Sie einen Reiter nach Rancho Bravo. Er kann in drei Tagen wieder zurück sein!«
»Wen dem wirklich so wäre, sagt es über den Raubmord absolut nichts aus«, erklärte der kleine Kerl, der noch mit dem schweren Revolver herumfuchtelte.
»Eben«, stimmte der Stadtmarshal zu. »Aber wir sind keine Narren, Durango, oder wie du sonst heißen magst. Außerdem bringt es euch nichts, wenn wir euch drei Tage Luft verschaffen.«
»Sie müssen das nachprüfen!« Rio rüttelte an den Gitterstäben. »Das ist Ihre Pflicht!«
»Meine Pflichten kenne ich besser als du!«, brüllte der Stadtmarshal den hünenhaften Mann in der Zelle an. »Darüber müsst ihr Galgenvögel mich nicht aufklären. Ihr kriegt etwas zu essen, wie es sich gehört. Und bis morgen fällt mir etwas ein, wie wir weiterkommen!«
»Verdammte Bande!«, stieß Rio unbeherrscht hervor. »Vielleicht habt ihr ihn selbst umgebracht und sucht nur ein paar Dumme, auf die ihr es schieben könnt!«
Cobb nahm die Zigarre aus dem Mund. Der kleine Kerl zielte mit dem Revolver auf Shayne. Der dritte Mann zog die schon weggesteckte Waffe wieder.
»Hör auf, Rio«, murmelte Jay.
»Hol ihn heraus, Marshal!«, verlangte der Kleine. »Das lassen wir uns nicht bieten!«
Rio trat zurück.
»Hol ihn heraus!«, schimpfte der kleine Kerl. »Der kriegt von mir die passende Antwort.«
»Morgen reden wir weiter. Über alles wird morgen gesprochen.« Cobb paffte heftig an der Zigarre und kämpfte damit die Versuchung nieder, wie die anderen Rache nehmen zu wollen für die Anschuldigung, die ihn tief traf.
Und Jay wusste, dass Rios hitzige Art sie immer tiefer in den Schlamassel trieb, in dem sie bereits steckten.
»Gehen wir!«, befahl der Marsahl. »Ich verständige den Keeper, dass er für die beiden eine Suppe kochen soll.«
Widerstrebend verließen die Männer das Office. Der Stadtmarshal blieb noch zurück und blickte in die Zelle.
»Und, haben sie ausgepackt?«, fragte draußen jemand.
»Denen wachsen doch Haare auf den Zähnen!«, maulte der eine.
»Verdächtigt haben sie uns!«, rief der Kleine keifend. »Wir hätten das alte Schlitzohr umgebracht, sagt der eine.«
Cobb schüttelte den Kopf. »Komische Typen seid ihr schon.« Dann folgte er den anderen. Die Tür klappte zu.
*
»Dummkopf«, sagte Jay.
Rio setzte sich auf eine Pritsche. »Könnte doch ganz gut möglich sein, oder?«
»Ausgeschlossen.«
»Warum?«
»Weil das zu viele sind, als dass sie sich auf die Dauer trauen könnten. Der Marshal ist doch kein Schwachkopf. Außerdem bleibt nicht viel, wenn sie es teilen. Ein paar hundert Dollar für jeden.«
»Da sind noch die beiden Farmer, Jay!«
Durango blickte auf. »Ja, die standen gestern vor dem Saloon.«
»Und die wissen unter Garantie, dass es sich lohnen würde, diesen komischen Halsabschneider zu fleddern!«
Jay stand auf. »Die könnten ihm gefolgt sein. Oder sie lauerten an dem Weg, den er nehmen würde. Sicher kannten sie diesen Weg.«
»Und warfen uns dann die Tasche ins Gestrüpp«, setzte Rio hinzu. »Wer weiß, wie lange die schon auf eine Gelegenheit warteten, zu Geld zu kommen und anderen was in die Schuhe zu schieben.«
Jay lief in der Zelle hin und her.
»Die sitzen jetzt vielleicht in ihrer Hütte, zählen die Bucks und lachen sich halbkrank über diese Spießer!«
»Gut möglich, Rio. Aber wenn wir dem Marshal jetzt damit kämen, meint der auch nur, wir würden etwas von uns abwälzen wollen. Außerdem würden die Reiter bemerkt, wenn die wirklich dahin ritten. Und da wäre nichts zu finden.«
»Das müssten wir selbst nachprüfen können.«
»Du sagst es.« Jay lehnte sich gegen das Gitter. »Aber wie?«
Rio blickte über die Wände, stand auf und klopfte sie ab. Er kletterte zum Lichtschacht hinauf und sah die im Westen über Wald und Hügeln stehende Sonne.
Da knarrten die Fußwegbretter vor dem Office, die Tür wurde geöffnet und ein Mädchen im verwaschenen Kattunkleid, mit aufgenähten Pappsternen daran, trat ein.
»Hallo, ich bin Fee!«, rief das Saloonmädchen mit rauer Stimme. Es versetzte der Tür einen Tritt, dass sie herumschwang und zuknallte. Die Fensterscheibe rasselte.
»Hallo«, sagte Jay lahm.
Fee schaute sich um, trat dann dicht ans Gitter und sagte: »Siebentausend, wenn nicht noch viel mehr, schätzen die Leute die Beute! Wieviel ist es wirklich?«
»Haben sie dich geschickt?«, fragte Jay zurück.
»Offiziell soll ich euch fragen, ob ihr Bohnensuppe oder Maisbrot und Käse haben wollt. Aber inoffiziell hoffen sie wirklich, dass ich eher was erfahre.« Das Mädchen mit dem Faltengesicht lachte krähend.
»Sag Ihnen, wir nehmen die Bohnensuppe.«
»Gut. Du heißt Jay?«
»Ja. Und er Rio.«
Fee nickte Shayne zu. »Warum seid ihr denn mit dem Zaster nicht auf und davon? Wegen des Verletzten in der Hütte?«
»Sag ihnen, wir wollen die Bohnensuppe!«, wiederholte Jay barsch.
»He, nun dreh doch nicht gleich durch! Lass uns in Ruhe darüber reden, Mann, Jay! Ich sitze hier ziemlich auf dem Trocknen. Meine Zeit ist um. Doug gibt mir sozusagen das Gnadenbrot. Weil er keine Frau hat und hofft, ich würde ihn nehmen. Aber soll ich bis an mein Lebensende in diesem Nest sitzenbleiben? «
»Was will sie eigentlich, Jay?« Rio näherte sich dem Gitter.
»Keine Ahnung.«
»Die Hälfte für mich Jay!«
»Und?«
»Ich hole euch heraus. Cobb ist doch nur im Nebenberuf Marshal. Weil er als Büchsenmacher sowieso kaum Arbeit hat. Und er wohnt nicht hier. Nachts ist kein Mensch im Office. Normalerweise jedenfalls nicht. Er wird einen Nacht-Marshal hierher setzen. Irgendeinen alten Mann, der am Tage nichts tut und sich die Nacht um die Ohren schlagen kann. Sie befürchten nicht, dass euch jemand helfen könnte.«
»Ich weiß immer noch nicht, was das werden soll«, sagte Rio.
»Sie will uns helfen. Für die Hälfte der Beute.«
Rio tippte sich an die Stirn. Jay stieß ihm den Ellenbogen in die Rippen.
»Lass sie doch mal ausreden!«
»Na endlich!« Fee rollte gelangweilt mit den Augen. »Ihr dürft mich natürlich nicht aufs Kreuz legen wollen.«
»Nein, das tun wir nicht!« versprach Jay.
»Na also, jetzt kommen wir doch langsam auf den Grund der Sache. Was habe ich für Garantien?«
»Unser Wort«, erwiderte Jay Durango prompt.
»Das ist nicht viel wert, was?«
»Lass dir etwas anderes einfallen. Wir stecken ziemlich im Dreck und sind für Angebote dankbar.«
Fee überlegte und trat von einem Bein aufs andere. »Ich werde einen Colt haben und ihr keinen. So müsste es gehen. Und wenn ich meinen Anteil habe, trennen wir uns. Wie ihr zu Waffen kommt, müsst ihr dann eben selbst sehen.«
»Einverstanden«, entgegnete Jay und nickte. »Du hast nichts zu befürchten. Wir prellen keinen, der ein guter Kumpel ist.«
»Ihr habt auch den Verletzten nicht im Stich gelassen«, bestätigte das Saloonmädchen. »Wäre das nicht gewesen, hätte ich euch sowieso kein Angebot gemacht.«
»Du bist großartig und denkst haarscharf nach!«, lobte Jay das offensichtlich ziemlich eitle Mädchen.
»Also, bis heute Nacht.« Fee zog sich zur Tür zurück.
»Und denke an die Bohnensuppe!«
»Ist gemacht, Jay. Den Männern erzähle ich, dass es Essig war.« Sie lachte mit ihrer rauen Stimme, dass es klang, als würde steinhart gewordener Käse über ein Reibeisen gezogen.
»Bis später, Fee!«
Sie winkte und verließ das Office. Die Tür knallte heftig zu und die Fensterscheibe rasselte.
»Stimmt bei dir noch alles?«, fragte Rio zweifelnd.
»Ich denke schon.«
»Wenn die nun den Männern sagt, wir hätten immerhin zugegeben, die Beute zu haben?«
»Das sagt sie nicht.«
»Und wenn doch?«
»Dann ändert sich für uns auch nichts. Davon sind die sowieso felsenfest überzeugt. Aber Fee täuscht uns nicht. Die träumt von einer Stange Geld und hat schon genug erlebt, um sich nicht mehr in kleinliche Gewissenskonflikte zu verstricken.«
»Hoffentlich.«
»Sie wird ein bisschen dumm dreinschauen, wenn sie begreift, dass es nichts als unseren Dank dafür gibt. Aber wir müssen jetzt nehmen, was wir kriegen können. Sonst hängen die uns auf oder bringen uns anders um, Rio!«
»Hoffentlich geht das nicht auch noch schief«, murmelte Shayne. »Ich befürchte nämlich, dass wir uns in einer ausgemachten Pechsträhne befinden. Der ganze Jagdausflug war ein Schuss ins Dunkle.«
Jay erfüllte neue Hoffnung.
»Wenn das klappt, müssen wir auf schnellstem Weg nach Rancho Bravo und den Boss benachrichtigen.«
»Damit die wahren Mörder inzwischen Zeit finden, sich mit der Beute abzusetzen, wie?«
»Was denn, du willst hier bleiben?«
»Ich will jetzt wissen, wer uns das einbrockte. Ob die Zattigs oder andere Wegelagerer. Und ich will, dass die Leute in diesem Nest erfahren, was für Greenhorns sie sind. Wie sehr sie zum Narren gehalten wurden!«
»Also gut, einverstanden. Kann allerdings ohne Waffe mehr als riskant werden.«
»Das müssen wir auf uns nehmen. Wir haben uns sehr verdächtig gemacht, Rio. Die ausgeschlagenen Zähne, deine Behauptung, McClure wäre nicht mehr bei der Hütte gewesen, dein Fluchtversuch, meiner noch dazu ... Das sind ehrlich viele Momente, die gegen uns sprechen. Viel mehr als die Tasche hinter der Hütte.«
»Aber die können nur die Zattigs hingeschmissen haben. Das wussten andere Zufallswegelagerer nicht, wie man es auf uns lenken könnte.«
Fee tauchte schon wieder auf, öffnete die Tür und rief: »Mit der Suppe, das geht klar. Dauert noch ein bisschen.« Sie kniff ein Auge zu.
Jay lächelte. »Die ist richtig aufgekratzt von der Aussicht, reich zu werden. Ein paar tausend Dollar müssen ihr wie ein Vermögen vorkommen.«
»Kein Wunder, wenn sie hier nicht das Salz in die Suppe verdient.«
*
Der Marshal trat ein, räusperte sich und umging den Schreibtisch. Er setzte sich in den abgeschabten Ohrensessel dahinter und schlug ein Bein über das andere.
Jay und Rio blickten ihn schweigend an. Keiner von ihnen zeigte noch Lust, Cobb von etwas überzeugen zu wollen.
Schließlich brachte Fee einen Topf, in dem Bohnensuppe dampfte.
Cobb ließ erst noch zwei Männer herein, die ihre Waffen zückten, bevor er die Zelle aufschloss und Fee hineinließ.
»Schön sitzenbleiben!«, befahl Cobb. »Erst isst das Halbblut, dann der andere!«
Jay bekam von dem Mädchen den Topf und aß die Hälfte der Suppe. Dann war Rio an der Reihe.
Fee verließ die Zelle mit dem leeren Topf. »Das sind doch ganz ordentliche Jungens, Marshal. Sehen nicht aus wie Mörder.«
»Mördern sieht man ihr Handwerk nur selten an«, maulte der Marsahl, schloss zu und zog den Schlüssel ab. »Erledigt. Schickt mir jemanden, der den Nacht-Marshal spielt.«
Fee und die Männer gingen hinaus. Die Tür wurde geschlossen. Cobb setzte sich hinter den Schreibtisch. Er hatte nicht die Absicht, sie an diesem Spätnachmittag noch mit Fragen zu traktieren und tüftelte offenbar auch noch an dem Konzept, nach dem er vorgehen wollte, um zu erfahren, was ihn interessierte und was er für Tatsache hielt.
Wenig später betrat ein alter, gebeugter Mann das Office. Er hustete stark, trug altes Cordzeug und hatte ein Gesicht wie spröde gewordenes Leder.
»Du kannst dir zwei Dollar verdienen, Ben.«
Der Mann grinste freundlich. »Kann einer wie ich gut vertragen, Marshal. Savage zahlt mir keinen müden Cent, gibt nie einen Whisky aus und ist überhaupt bis an den Hals zugeknöpft. Dabei habe ich zehn Jahre lang sein schwerstes Fuhrwerk kutschiert und einen Haufen Geld für ihn verdient.«
»Das geht mich nichts an.« Cobb erhob sich. »Du hast nichts zu befürchten. Die haben keine Komplizen. Es ist nur, dass jemand hier sitzt.«
»Gut, Marshal.«
»Komm um neun, wenn es dunkel wird.«
Der alte Ben wandte sich ab und verließ das Office.
Cobb lief auf und ab, blieb mitunter stehen und schaute in die Zelle. Manchmal schien es, als wollte er doch weiter in sie dringen, um ihnen das scheinbare Geheimnis zu entlocken.
Schließlich ging er hinaus.
»Sie hat nichts verlauten lassen«, murmelte Rio. »Komisch.«
»Wieso, Rio?«
»Weil sie eigentlich einen netten Eindruck macht.«
»Du meinst, es passt nicht dazu, dass sie sozusagen zu unserer Komplizin werden will? «
»So ist es.«
»Sie findet keinen Job mehr und weiß es. Und die Leute hier wissen es auch und werden sie entsprechend hochnäsig behandeln. Wenn nicht noch schlimmer. Da kann ein Mann zum wilden Tier und eine Frau zur verschlagenen Schlange werden.«
*
Dem alten Ben sank der Kopf auf die Brust. Ein lauter Schnarchlaut entfuhr ihm. Sein Kopf zuckte empor, er öffnete die Augen und blickte blinzelnd gegen die Lampe.
Der Docht war ziemlich weit heruntergebrannt, so dass es beinahe dunkel im Office war. Aber dem Mann fehlte es schon so sehr an Aktivität, dass er sitzenblieb. Alsbald fielen ihm die Augen wieder zu und sein Kopf sank nach unten.
Jay und Rio lagen wach auf ihren Pritschen und beobachteten den Kampf des Nachtmarshals mit seiner Natur.
Lautlos bewegte sich die Türklinke nach unten. Ein Spalt bildete sich. Ein Revolver schob sich ins Halbdunkel. Darüber tauchte Fees Gesicht auf.
Der Nacht-Marshal schnarchte.
Das Mädchen trat über die Schwelle, schob die Tür zu und erreichte den Schreibtisch. Fee trug noch das alte Kattunkleid mit den Pappsternen darauf. Sicherlich besaß sie kein anderes mehr, was Jay als Indiz dafür wertete, dass sie beruflich in der Tat das Ende erreicht haben musste.
»Mister Cohler«, sagte das Mädchen leise. Der Revolver in ihrer Faust war auf den Mann gerichtet und wackelte nicht. Eiserne Entschlossenheit zeichnete auch ihr Gesicht und ließ es bedeutend weniger faltig erscheinen.
Der Mann schnarchte. Das Kinn schlug auf die Brust.
»Mister Cohler«, sagte Fee etwas lauter.
Da zuckte der Schläfer zusammen, sein Kopf flog förmlich empor und er starrte entsetzt auf die Waffe.
»Erschrecken Sie nicht«, sagte Fee. »Und schreien Sie nicht um Hilfe. Ich möchte nicht auf Sie schießen müssen.«
»Fee, auch das noch auf meine alten Tage!«
»Wir müssen beide zusehen, wo wir bleiben, Mister Cohler. Keiner versteht Sie besser als ich. Aber begreifen Sie auch meine Lage. Die Jungens versprachen mir die Hälfte der Beute. So ein Angebot wird mir kaum noch einmal gemacht.«
Endlich schien der Nacht-Marshal seine Lage voll erkannt zu haben. Seufzend hob der die Hände. »Nicht schießen, Fee. Ich weiß, wie verzweifelt Sie sind.
»Dann gibt es ja nichts weiter zu besprechen, Mister Cohler. Nehmen Sie mit der linken Hand den Schlüssel aus der Lade und schließen Sie die Zelle auf!«
»Sie bringen sich in Teufels Küche, Fee!«
»Da bin ich schon lange. Es kann nur noch besser werden. Ich möchte wirklich nicht schießen!«
Der Mann erhob sich, ließ die linke Hand sinken und öffnete die Schublade. Er zog den Schlüssel heraus, trat mit einer erhobenen Hand ans Gitter und schloss die Tür darin auf.
Jay und Rio erhoben sich.
»Was für ein abgekartetes Spiel!«, jammerte der Nacht-Marshal, dem Cobb vergessen hatte, einen Stern an die fadenscheinige Cordjacke zu stecken.
»Umdrehen!«, befahl Jay. »Rio, ein paar Stricke und einen Knebel für Mister Cohler.«
Shayne verließ die Zelle. »Großartig, Fee, du bist ein Schatz!«.
»Ich fühle mich elend wie noch nie«, bekannte das Saloonmädchen.
Rio fand im Spind neben dem Gewehrständer ein paar Stricke und einen einigermaßen sauberen Lappen. Damit fesselten sie den Mann an Händen und Füßen und knebelten ihn.
Als sie die Zelle verließen, lag Cohler auf einer der Pritschen, unfähig, um Hilfe zu rufen.
Fee trat zurück und bedrohte sie mit dem Colt. »Die Waffe behalte ich. Wie verabredet.«
Rio blickte auf den vollen Gewehrständer.
»Lass das!« Jay schob den Partner vor sich hinaus.
Fee folgte ihnen und schloss die Tür. Die Lampe über dem Schreibtisch flackerte.
Auf der Straße war niemand. Auch hinter den Fenstern konnten sie nirgendwo Lichtschein sehen, nicht einmal im Saloon.
»Wie spät ist es?« Jay schaute über die Schulter.
»Drei. In zwei Stunden wird es hell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Eure Pferde stehen im Mietstall. Ich nehme das eures Freundes, der keins mehr braucht. Dann können sie mir nicht noch anhängen, einen Gaul gestohlen zu haben.«
»Gut, er soll dir gehören«, stimmte Jay zu. Er übernahm die Führung. Sie huschten an den Wänden entlang und duckten sich unter den Fenstern. Das Tor zum Mietstallgelände stand offen. An das barackenähnliche Gebäude war eine kleine Hütte angebaut. Dahinter schloss Buschwerk das Anwesen ab.
»Der Stallmann schläft.«
Jay erreichte die Tür des Stalles. Ein Balken lag quer davor in Eisenkrampen. Er hob ihn aus und legte ihn an die Wand.