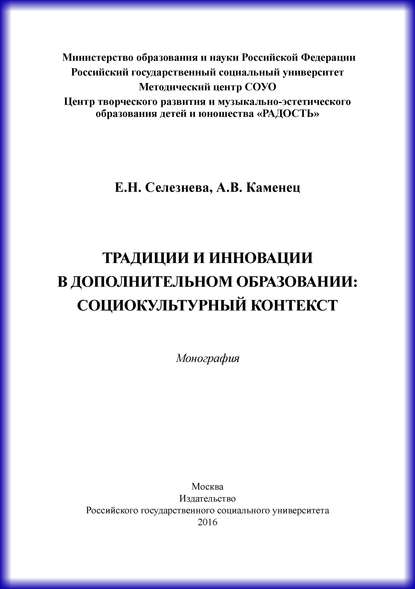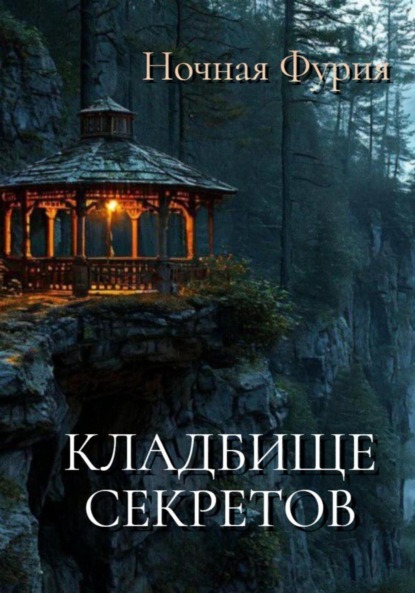Trevellian und die Organ-Mafia: Action Krimi
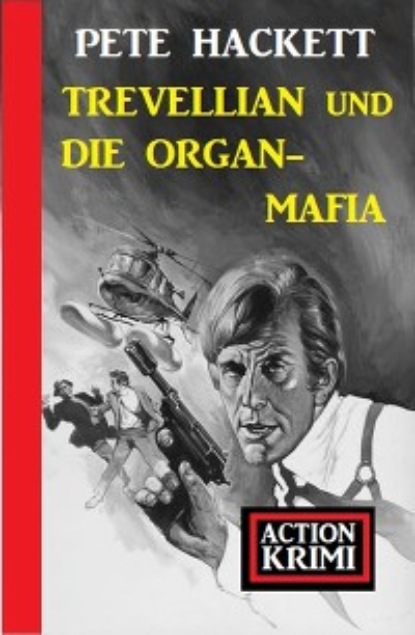
- -
- 100%
- +
Die Frau zog dem Knirps das Hemd über.
Dann bedankte sie sich noch einmal überschwänglich und verließ schließlich mit dem Knaben an der Hand die Praxis.
Der Arzt schaute die junge Frau an, die ihm bei seiner täglichen Arbeit zur Hand ging. Sie war schwarzhaarig, rassig, und sogar der formlose, weiße Kittel, in dem sie steckte, betonte ihre weiblichen Proportionen. „Wie viele noch?“, fragte er.
„Sieben“, antwortete Conchita. So hieß die rassige Lady.
Dr. Estralda drehte die Augen zur Decke. „Dann wird‘s wieder spät“, gab er zu verstehen und schaute zum Fenster hinaus.
Es wurde schon düster. Am Himmel trieben graue Regenwolken. Das Wetter in Bogota war eigentlich immer hässlich. Die Sonne schien hier, je nach Jahreszeit, zwischen drei und sechs Stunden am Tag.
Im Wartezimmer wurde es laut. Die dunkle Stimme eines Mannes war durch die geschlossene Tür zu vernehmen: „Ich muss den Doktor auf der Stelle sprechen, Señorita. Es ist ...“
Der Sprecher verstummte, als der Arzt die Tür öffnete. Da stand seine Sprechstundenhilfe mitten im Wartezimmer, vor ihr stand ein dunkelgesichtiger Mann mit straff nach hinten gekämmten, gelglänzenden Haaren und dichten Koteletten bis zu den Kinnwinkeln.
„Ah, Doktor“, rief der Bursche. „Ich muss Sie sprechen. Es dauert nur ein paar Minuten.“
Der Arzt nickte. „Kommen Sie herein, Señor.“ Er drehte den Kopf zu Conchita herum. „Nehmen Sie sich der einfachen Fälle an, Conchita? Ich muss mit dem Señor einige Dinge besprechen. Ich werde gleich wieder zur Verfügung stehen.“
Er lächelte sie an.
„Gewiss, Doktor“, nickte Conchita und verließ das Behandlungszimmer.
Die Sprechstundenhilfe gab den Weg frei.
Dr. Estralda schloss die Tür, als Pepe Herrero eingetreten war. „Was ist es diesmal?“, stieß er hervor.
„Ein Herz. Wir brauchen einen gesunden Burschen, ungefähr eins-fünfundachtzig groß, neunzig Kilo schwer, Blutgruppe A, positiv.“
Dr. Estralda zog den linken Mundwinkel in die Höhe. „Eins-fünfundachtzig vielleicht, neunzig Kilo auf keinen Fall, bei den ausgemergelten Burschen, die ich betreue. A, positiv ist kein Problem.“
Er ging zum Computer und griff nach der Maus. Einige Klicks, und das Suchfenster seiner Datenbank wurde geöffnet. Er gab in die verschiedenen Textfelder die entsprechenden Kriterien ein. Das Suchergebnis war Null.
„Hab ich Ihnen doch gesagt“, murmelte der Arzt. Er klickte wieder das Suchfenster her. Er gab als Kriterien dieses Mal die Größe mit eins-fünfundsiebzig an, das Gewicht mit 65 Kilo.
Dann klickte er Ok.
Der Computer zeigte fünf Treffer an.
Dr. Ramon Estralda druckte die Personendaten aus. Er reichte die Liste Pepe Herrero. Der überflog sie mit den Augen, nickte und grinste: „Sehr gut, Doktor. Einen der Kerle werden Sie in vier Tagen aus Ihrer Datenbank löschen können.“
„Langsam nimmt es einen Umfang an, Herrero“, knurrte der Arzt, „der die Polizei zwingt, der Sache auf den Grund zu gehen. Da nützt es auch nichts, dass ...“
„Es gibt eben viele reiche Americanos, die kaputte Herzen, Nieren und Lungen haben. Wir leben doch gut davon. Und nach den Hungerleidern, die wir zu Organspendern machen, kräht kein Hahn. Sie kriegen es doch nicht mit der Angst, Doktor?“
„Was heißt hier Angst? Sorgen werde ich mir wohl machen dürfen?“
„Bleiben Sie nur schön bei der Stange. Sie stecken genauso tief drin wie wir.“
„Ich weiß.“
„Bueno. Also dann, bis zum nächsten Mal. Spielen Sie jetzt weiter den Engel der Armen und Entrechteten, Doktor.“
Pepe Herrero verließ die Praxis.
Von einer Telefonzelle aus rief er einen seiner Komplicen an. Er studierte die Liste der Kandidaten, die ihm der Arzt ausgehändigt hatte, während das Freizeichen tutete. Dann hatte er seinen Mann an der Strippe.
„Pass auf, Paco. Der Name ist Benito LaVega. Er wohnt in der Barackensiedlung San Louise.“
„Ich kenne das Elendsviertel. Alles klar. Wann?“
„Am siebten.“
„In Ordnung. Übergabe wie immer?“
„Si.“



6

Benito LaVega lag in seiner Behausung auf einer alten, fleckigen Matratze, aus der an manchen Stellen ganze Büschel von Seegras quollen.
Die Behausung war aus Brettern, Wellblech, zerrissenen Zeltplanen und Teerpappe inmitten der Obdachlosensiedlung errichtet. Ein Stall, in dem sich wahrscheinlich nicht einmal Ziegen und Schafe wohlgefühlt hätten.
Benito döste vor sich hin. Das war sein Tagesablauf. Arbeit bekam er nirgends. Radio oder TV besaß er nicht. Für ein Hobby fehlte ihm das Geld. Also döste er.
Als zwei Männer seine Hütte betraten, schreckte er hoch. Betroffen starrte er zu den beiden gutgekleideten Kerlen in die Höhe. Sie trugen schwarze Sonnenbrillen. Benitos Lider zuckten. Schließlich prägte nur noch Misstrauen seine eingefallenen Züge.
Sie grinsten ihn an.
Benito LaVega stemmte sich auf die Ellenbogen hoch. „Wer sind Sie, Señores?“
„Bist du Benito LaVega?“, fragte der eine fast freundlich.
Der Mann auf der Matratze nickte.
„Gut, Benito. Du suchst einen Job. Wir haben einen. Kannst du einen Lastwagen fahren?“
„Sicher.“
„Prächtig. Du wirst bei uns Lastwagenfahrer. Fernverkehr. Das heißt, du wirst viel unterwegs sein und kaum noch nach Hause kommen.“
„Nach Hause“, entrang es sich Benito LaVega verächtlich. Er rappelte sich auf die Beine. „Nennt ihr das ein Zuhause? Wenn ich Geld verdiene, kehre ich nie wieder hierher zurück.“
„Du wirst Geld verdienen. Gutes Geld. Komm.“
Er folgte ihnen zu einem Mitsubishi-Jeep. Ein dritter Mann erwartete sie. Er saß auf der Rückbank. Benito LaVega setzte sich neben ihn. Der Bursche nickte ihm freundlich zu.
Benito LaVega blickte nicht mehr zurück.
Er war sich sicher, dass er nie wieder hierher zurückkehren würde.
Der Grund dafür aber war nicht der, den ihm die beiden freundlichen Kerle in den teuren Anzügen genannt hatten.
Das allerdings ahnte Benito LaVega nicht.
Sie fuhren mit ihm in die Stadt. Es ging durch verwinkelte Gassen, schließlich rollte der Jeep in einen Hinterhof. Das Gebäude, zu dem er gehörte, sah heruntergekommen und verwahrlost aus. Es war einstöckig, die Fenster waren zum Teil eingeschlagen und verdreckt.
Benito LaVega schaute überrascht auf das abgewirtschaftete Haus. Nirgendwo sah er ein Firmenschild. In dem Hinterhof wuchs an den Mauern, die ihn eingrenzten, kniehoch das Unkraut. Das Gebäude machte den Eindruck, als sei es seit Jahren unbewohnt.
„Was ist das? Das ist doch keine Firma.“ Die jähe Furcht kam wie ein Schwall eiskalten Wassers. „Heilige Jungfrau, ihr ...“
Der Bursche neben ihm hatte plötzlich eine Pistole in der Faust. Die Kerle auf den Vordersitzen sprangen aus dem Jeep. Einer riss die Tür auf. „Aussteigen!“, tönte er barsch.
„Was – wollt – ihr von mir?“, stammelte Benito.
„Du hast wohl was an den Ohren“, grunzte der neben ihm auf dem Rücksitz und stieß ihn mit der Waffe an. „Raus mit dir!“
Dem Burschen an der Tür ging es zu langsam. Er packte Benito am Arm und zerrte ihn brutal ins Freie. Benito stolperte und stürzte. Das Stöhnen, das sich in seiner Brust hochkämpfte, erstarb in der Kehle. Die Angst lähmte seinen Verstand.
Aber instinktiv gehorchte er einem der ältesten Prinzipien der Menschheit – dem Selbsterhaltungstrieb. Er schnellte hoch, warf sich gegen einen der Kerle und brachte ihn zum Straucheln. Dem anderen, der ihn mit beiden Armen umklammern wollte, drosch er die Faust mitten ins Gesicht. Dann wirbelte er herum und floh in Richtung Einfahrt.
Aber da sprang der mit der Pistole aus dem Fahrzeug. Er kam hinten um den Jeep herum, in dem Moment, als Benito den Wagen passierte. Der Kerl stellte Benito ein Bein. Benito hob regelrecht ab. Krachend landete er auf dem Bauch. Sein Gesicht knallte seitlich auf das Pflaster. Ein Stöhnen brach sich Bahn aus seinem weit aufgerissenen Mund.
Im nächsten Moment umringten ihn seine Kidnapper. Er bekam einen schmerzhaften Tritt in die Seite. Es war jener Bursche, dem er die Faust ins Gesicht schlug und der aus der Nase blutete. Der andere riss ihn zurück. „Hör auf!“ zischte er. „Er muss unversehrt sein.“
Der mit der blutenden Nase beruhigte sich. Mit dem Handrücken wischte er sich das Blut ab. „Dreckiger Bastard“, knirschte er zwischen den Zähnen.
Sie zerrten Benito auf die Beine und bugsierten ihn zwischen sich her zum Haus. Die Haustür war zerkratzt, der Lack blätterte von ihr ab, das Holz zeigte Moderflecken. Einer hatte einen Schlüssel. Benito wurde ins Obergeschoss dirigiert und in einen kleinen, fensterlosen Raum mit einer Entlüftungsanlage gestoßen, die wohl längst außer Betrieb war. Die Luft hier war muffig und roch nach Fäulnis. Ein Rohrstumpf, der aus dem Boden ragte und ein verschraubter Wasseranschluss in der Wand zeugten davon, dass sich in diesem winzigen Raum früher einmal eine Toilette befunden hatte.
Sie fesselten Benitos Hände und Füße und knebelten ihn.
Dann ließen sie ihn allein. Finsternis umgab ihn in seinem engen Gefängnis. Die Angst zerfraß ihn. Er zerrte an seinen Fesseln, versuchte, den Knebel auszustoßen. Benito schaffte es nicht. In sein Bewusstsein senkte sich die namenlose Panik ...



7

Nach dem Mord an Benito LaVega veröffentlichte Miguel Santana in dem Blatt, für das er arbeitete, einen Bericht über den organisierten, illegalen Organhandel in Bogota.
Er prangerte die menschenunwürdigen sozialen Verhältnisse an, verurteilte in seinem Artikel die unzulänglichen Ermittlungen der Polizei, stellte einige Hypothesen auf, die unter anderem den Einsatz so mancher Sozialdienste in Frage stellten und rückte einige Einrichtungen – ohne natürlich Namen zu nennen –, dieser Organisationen in ein denkbar schlechtes Licht. Er schrieb von verbrecherischem Eigennutz ...
Als er eines Abends in seine Wohnung zurückkehrte, wurde er erwartet.
Zwei Männer hatten sich Zutritt zu seinem Appartement im Norden der Stadt verschafft. Einer bedrohte ihn mit einem Revolver. Und er ließ keinen Zweifel daran offen, dass er eiskalt abdrücken würde, wenn Miguel Santana auch nur falsch Luft holte.
„Du bist also dieser Schmierfink von El Tiempo“, raunzte ihn der andere an, also jener, der keine Pistole hielt.
„Ja, ich arbeite als Journalist ...“
Der Bursche schlug zu. Er hämmerte seine Faust mitten in Miguel Santanas Gesicht. Sofort schoss aus dessen Nase das Blut, rann über seine Lippen und sein Kinn und tropfte auf den Fußboden. Vor den Augen des Zeitungsmannes schien der Raum zu explodieren. Der jähe Schmerz entriss ihm einen Aufschrei, in seine Augen schossen Tränen und das Gesicht mit dem brutalen Zug um den dünnlippigen Mund war nur noch wie durch wallende Nebelschleier für Santana zu erkennen.
Der nächste Schlag traf ihn in den Magen. Er beugte sich unwillkürlich nach vorn, hinein in das hochzuckende Knie des Schlägers. Es klatschte grässlich. Santana gurgelte und stöhnte. Er wankte zurück, hob die Hände, um sein Gesicht zu schützen. Er spürte Angst, Übelkeit und Schmerz und fühlte die Betäubung, die sein Bewusstsein erlahmen ließ.
Ein Tritt in den Unterleib ließ seinen Mund weit aufklaffen, er konnte nur noch röcheln. Er sank gegen die Wand, hatte das Empfinden, in seinem Körper loderte ein heißes Feuer in die Höhe, der Inhalt seines Magens kam hoch, er übergab sich und fiel vor Schwäche nach dem Tritt auf die Knie, die Hände vor dem Leib verkrampft.
„Du solltest dir diese Lektion zu Herzen nehmen, Schmierfink!“
Die Stimme erreichte sein Gehör wie aus weiter Ferne. Er hatte gegen seine große Not anzukämpfen, sein Bewusstsein wies Lücken auf, er erfasste die Worte verstandesmäßig gar nicht mehr.
„Du hast nämlich ein heißes Eisen angefasst!“
Er hatte das Empfinden, dass die Worte wie Klumpen flüssigen Bleis auf ihn hinunter tropften.
„Wenn wir wieder kommen müssen, weil du mit deinem Drang zum Schreiben bei einer Reihe von Leuten ins Fettnäpfchen trittst, kommst du nicht mehr mit einer blutenden Nase weg. Dann stanzen wir dir mit einer Pistolenkugel ein kleines, rundes Loch zwischen die Augenbrauen.“
Der Sprecher schlug zu. Er knallte Miguel Santana die Faust aufs Ohr.
Santana kippte zur Seite und blieb verkrümmt liegen. Sein leises Wimmern entlockte den beiden rabiaten Gangstern nicht die geringste Gemütsregung.
„Ich hoffe, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt, Schmierfink“, zischte der Schläger und trat Santana noch einmal brutal in die Seite.
Dann verschwanden die beiden.



8

Vier Wochen waren vergangen.
Der Chef rief uns zu sich. Mit uns meine ich die G-men Milo Tucker und Jesse Trevellian, meine Wenigkeit also.
Der Spezial Agent in Charge, kurz SAC, saß hinter seinem Schreibtisch und forderte uns auf, nachdem er unseren Morgengruß erwidert hatte, Platz zu nehmen.
„Sie machen kein besonders spaßiges Gesicht, Chef“, gab Milo etwas respektlos, wie ich fand, zum Besten.
Mr. McKee verzog den Mund. „Es besteht auch nicht der geringste Grund für mich, spaßig auszusehen“, versetzte Mr. McKee ernst. „Seht euch mal das an.“
Er hielt uns die New York Times hin, die auf die Hälfte zusammengefaltet vor ihm auf dem Schreibtisch lag.
In dem Moment schaute Mandy zur Tür herein. „Kaffee, Gentleman?“, fragte sie lächelnd.
„Natürlich, Mandy“, brummte Mr. McKee. Grimmig fügte er hinzu: „Ohne dass sie Ihren Kaffee bekommen haben, bringe ich die beiden doch nicht wieder los.“
Wir schauten ihn verblüfft an. Er sah zwar nicht wie ein Spaßvogel aus, aber was er eben von sich gegeben hatte, beinhaltete nach unserem Empfinden doch ein hohes Maß an Humor.
„Hah!“, blaffte Milo.
Mandy verschwand.
„Spaß beiseite“, knurrte der Chef. „Schaut euch mal den Artikel an. Es gibt schätzungsweise Arbeit, Jungs.“
„Aha, darum wollen Sie uns so schnell wie möglich loswerden“, schmollte Milo. „Sie können es nicht sehen, wenn wir mal einen Gang zurückschalten.“
Meine Augen erfassten die Überschrift, die als fette Schlagzeile zuoberst auf der Seite stand: Texanischer Ölmagnat in New York nach Herztransplantation gestorben. Und in kleinen Buchstaben stand darunter: Herkunft des Spenderherzens unbekannt. Organ-Mafia am Werk?
Ich schaute, wer den Artikel verfasst hatte. Die Initialen L.H. standen darunter. L für Lew, H für Harper.
Ich las. Der texanische Ölmillionär – Multimillionär – hieß Tom J. Glansing. Er wurde im Saint Luke‘s and Roosevelt Hospital Center von einem Arzt namens Dick Svenson betreut, und dieser konnte im Interview nichts weiter berichten, als dass die Operation drei Wochen vorher in Bogota durchgeführt worden war. Er, der Arzt, sei der Meinung gewesen, die Herkunft des Spenderherzens sei dokumentiert und legal.
„Die Transplantation des körperfremden Organs hat im Körper des Millionärs immunologische Abwehrreaktionen ausgelöst und das eingepflanzte Herz abgestoßen“, stand da noch zu lesen und natürlich eine Menge mehr an medizinischem Fachchinesisch.
Dann folgten Ausführungen zum illegalen Geschäft mit menschlichen Organen, und dass insbesondere in den Ländern der dritten Welt ein schwunghafter Handel mit Nieren, Herzen, Augenhornhäuten und so weiter betrieben wird.
Ich reichte die Zeitung Milo.
Als auch der den Bericht gelesen hatte und das Gesicht hob, sagte Mr. McKee: „Es gibt Gesetze und Vorschriften, die das Verfahren bei einer Organtransplantation bis ins kleinste Detail regeln. Diese Regeln gelten im Großen und Ganzen weltweit. So darf die Transplantation bestimmter Organe nur in dafür zugelassenen Transplantationszentren vorgenommen werden. Sie ist nur zulässig, wenn die Organe durch eine vom Gesetz legalisierte Stelle vermittelt wurden. Es gibt Koordinierungsstellen für die Entnahme, und es muss gewährleistet sein und in einem jährlichen Bericht nachgewiesen werden, dass die im Transplantationsgesetz festgelegten Maßnahmen nach den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurden. Man hat Vermittlungsstellen mit einer gerechten Verteilung der Organe beauftragt ...“
Der Chef seufzte.
„Aber wem erzähle ich das, Jungs? Das wisst ihr sicherlich ebenso gut wie ich.“
Da war ich mir nicht so sicher. Deshalb erwiderte ich nichts.
Auch Milo hüllte sich in Schweigen.
„Nichts von alledem wurde bei dem texanischen Ölmulti beachtet. Soviel ich herausbekommen habe, wurde er nach Bogota ausgeflogen, dort war er nach der Operation drei Wochen in stationärer Behandlung, und dann wurde er per Privatjet nach New York zurück gebracht. Alles das geschah unter der Obhut dieses Dr. Dick Svenson.“
„Und dem ist er schließlich unter den Händen gestorben“, verlautbarte Milo mit kühnem Scharfsinn.
„Ja, sonst wäre er nicht tot“, sagte ich sarkastisch.
„Ha, ha“, machte Milo. „Dein Scharfsinn ist bewundernswert.“
„Meine Herren“, ermahnte uns der Chef.
Jetzt kam Mandy mit dem Kaffee. Sie schenkte unsere Tassen voll. Er war schwarz wie die Hölle und schon nach wenigen Augenblicken roch es in dem Büro wie in einem türkischen Kaffeehaus. Mandys Kaffee war der beste. Wir schnüffelten an dem Gebräu wie Trüffelschweine.
Wir bedankten uns artig, Mandy wehrte lächelnd ab und verließ uns. Die Thermoskanne ließ sie auf dem Tisch zurück.
„Sorry“, murmelte Milo. „Ich schätze, wir sollen jetzt losmarschieren, um diesen Dr. Svenson ein wenig unter die Lupe zu nehmen, Sir.“
„So ist es.“ Mr. McKee nickte. „Lew Harper ist ein Mann, der weiß, von was er schreibt. Sicher, man wird es unten in Kolumbien vielleicht nicht ganz so genau nehmen mit den Transplantationsgesetzen. Es gibt dort viele Obdachlose, Straßenkids und andere arme Schlucker, die der bitteren Armut auf dem Land entfliehen wollen und in die Großstadt gehen – um dort noch tiefer in der Verelendung zu versinken. Sie sterben oftmals an Entkräftung, und es gibt niemanden, der einer Transplantation zustimmen muss. Unabhängig davon – die Ärzte müssen sich an die geltenden Bestimmungen halten. Und da habe ich den unumstößlichen Verdacht, dass einige der Herrn in Weiß ihre Pflichten nicht ganz so ernst nehmen, vor allem dann nicht, wenn eine schöne Stange Geld winkt.“
„Allein der Eid des Äskulap nährt noch lang nicht seinen Mann“, philosophierte Milo.
„Und wie in jeder Gesellschaftsschicht gibt es auch unter den Göttern in Weiß schwarze Schafe“, fügte Mr. McKee lakonisch hinzu.
„Kann ein ruhiger Job werden“, bemerkte ich. „Sicher ist Doc Svenson ein ehrenhafter Mann, und er wird uns eine einleuchtende Erklärung abgeben können. Ehe wir uns aber mit dem armen Dr. Svenson, der nun durch sämtliche Medien gezerrt wird, befassen, will ich mich von Doc Howard erst mal über die medizinische Seite einer Organverpflanzung aufklären lassen. Man will ja schließlich mitreden können.“
Ich schlürfte genussvoll von meinem Kaffee.
Indes griff Mr. McKee zum Telefon. Nach kurzer Zeit sagte er: „Hallo, Doc, zwei Gentleman namens Trevellian und Milo brauchen Ihren fachmännischen Rat. Haben sie eine halbe Stunde Zeit für Sie? – Gut. Sie sind in drei Minuten bei Ihnen.“
Immer diese Zeitvorgaben, dachte ich und beeilte mich, die Tasse leer zu kriegen.
„Erstattet mir Bericht, Leute“, rief der SAC, als wir schon unter der Tür waren.
„Ehrensache“, versprach Milo, dann staksten wir zum Aufzug.



9

„G-men, was kann ich für Sie tun?“, fragte Doc Howard, der Medizinmann im New Yorker Field Office. Er saß hinter seinem Schreibtisch. Doc Howard war Spezialist in Sachen Gerichtsmedizin und ein erstklassiger Gutachter.
„Erzählen sie uns was über Organverpflanzungen, Doc“, sagte ich.
„Die rechtliche oder ...“
„Die medizinische Komponente, Doc“, sagte Milo.
Der Arzt schaute meinen Freund und Kollegen streng an. „Haben Sie‘s eilig, Tucker?“, stieß er schließlich hervor.
„Nein, wieso? – Oh, verzeih‘n Sie, ich habe Sie unterbrochen.“ Milo schaute mich an. „Ist wohl nicht mein Tag heute, wie?“
Doc Howard deutete ein Grinsen an. „Schon gut. Also die medizinische Seite. Was wollen Sie wissen?“
„Nur ein paar ganz lapidare Dinge, Doc. – Wie viel Zeit darf zum Beispiel zwischen einer Organentnahme und der Einpflanzung verstreichen? Oder – was ist der Auslöser, wenn ein Organ vom Körper nicht angenommen wird? Welche Kriterien sind beim Spender zu beachten?“
„Hm“, machte der Doc. „Fangen wir mal bei Ihrer letzten Frage an, Jesse. Je nach Art des Organs, das verpflanzt werden soll, sind die Kriterien anders zu bewerten. Die Blutgruppe muss natürlich bei jedem inneren Organ, das transplantiert werden soll, identisch sein. Bei Niere und Bauchspeicheldrüse müssen darüber hinaus die Gewebeeigenschaften zusammen stimmen, bei Herz und Lunge die Größe und das Gewicht des Spenders, bei der Leber ebenfalls das Gewicht.“