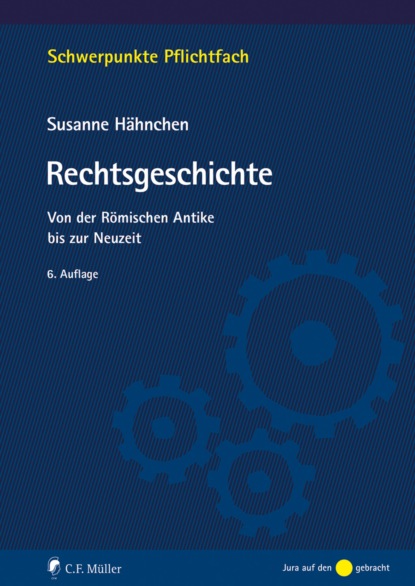- -
- 100%
- +
129
Eine andere häufige Einrede war die exceptio pacti (Einrede wegen einer Nebenabrede), hier wiederum in die abstrakte Klage auf eine bestimmte Geldsumme eingefügt:
Titius iudex esto. Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere, si inter Aulum Agerium et Numerium Negidium non convenit, ne ea pecunia intra quinquennium peteretur, iudex Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia condemnato, si non paret, absolvito.
Übersetzung:
Titius soll Richter sein. Wenn es sich herausstellt, dass N.N. dem A.A. 10 000 Sesterzen geben muss, wenn zwischen A.A. und N.N. nicht vereinbart worden ist, dass dieses Geld nicht innerhalb von fünf Jahren eingeklagt werden darf, soll der Richter den N.N. an A.A. zu 10 000 Sesterzen verurteilen. Wenn es sich nicht herausstellt, soll er freisprechen.
Beide hier aufgeführte Einreden sind in Klagen aus sog. strengrechtlichen Rechtsgeschäften (iudicia stricti iuris) eingefügt. Der Beklagte selbst musste in iure darauf achten, dass der Prätor die exceptio gewährte. Ohne exceptio konnte der iudex die Arglist oder das pactum nicht mehr berücksichtigen.
130
Keiner solchen Einfügung einer exceptio doli oder pacti bedurfte es, wenn die Klagformel bereits von sich aus gebot, nach Treu und Glauben zu entscheiden. Man spricht dann von einem bonae fidei iudicium. Das bedeutete ursprünglich, dass die bloße bona fides[19] verbindlich machte und dass sich auch der genaue Inhalt der Verpflichtung daraus bestimmte. Daraus folgte, dass der Richter mehr Ermessen bei der Beurteilung des Rechtsverhältnisses hatte als bei den älteren Klagen strengen Rechts.[20] Die Klagen aus Treu und Glauben entstanden im Amtsrecht (ius honorarium) der Prätoren (Rn. 117 ff). Zu diesen iudicia gehörten vor allem die Klagen aus den Konsensualkontrakten (Rn. 120). Als Beispiel wird hier die actio empti (Kaufklage) angeführt:
Titius iudex esto. Quod Aulus Agerius de Numerio Negidio hominem Stichum emit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius iudex Numerium Negidum Aulo Agerio condemnato, si non paret, absolvito.
Übersetzung:
Titius soll Richter sein. Im Hinblick darauf, dass A.A. von N.N. den Sklaven Stichus gekauft hat, um welche Angelegenheit es sich handelt, was wegen dieser Sache N.N. dem A.A. geben oder tun muss nach guter Treue, dazu soll der Richter N.N. an A.A. verurteilen. Wenn es sich nicht herausstellt, soll er freisprechen.
Primär ging die actio empti des Käufers auf Erfüllung des Kaufvertrages, also Übergabe des Sklaven und Gewähr für das Behaltendürfen. Aufgrund der bona-fides-Klausel in der Klageformel konnten nun auch Nebenabreden zur Erweiterung der Verpflichtung eingeklagt werden. Bei strengrechtlichen Verträgen hingegen, z. B. beim Darlehen (mutuum), konnten solche Zusatzverpflichtungen nur durch Stipulation begründet werden.
131
Bemerkenswert ist ein weiterer, neben dem Kauf sehr häufig verwendeter Vertrag. Die locatio conductio umfasste im römischen Recht diejenigen Vereinbarungen, die wir heute als Dienst-, Arbeits-, Werk-, Miet- und Pachtverträge differenzieren. Der gemeinsame Gedanke war, dass ein locator etwas „hinstellte“ (von lat. locare – legen, stellen) und die faktische Verfügungsmacht darüber einräumte. Konkret war es derjenige, der eigene oder fremde Dienste anbot, die Anfertigung eines Werkes nachfragte indem er Stoff zur Verfügung stellte, oder einen Miet- oder Pachtgegenstand gab. Der conductor war hingegen derjenige, der das Hingestellte mit sich nahm (lat. conducere – mitführen), also der Dienstherr, der Werkunternehmer, der Mieter oder Pächter. Auch die beiden Klagen aus locatio conductio, also die actio locati auf (Miet-/Pacht-)Zinszahlung bzw. Leistung des Werkes oder der Dienste und die actio conducti auf Überlassung der Sache bzw. Bezahlung der Leistung sind bonae fidei iudicia.
Die locatio conductio war schon in der Antike ein Vertrag mit faktisch besonders häufig vorkommenden sozialen Problemen.[21] Diese Tatsache kann man durch die Überlegung erklären, dass wer ein Grundstück pachten oder eine Wohnung mieten muss, regelmäßig kein oder zu wenig Eigentum hat und wer sich selbst gegen Geld „verkauft“, dies in der Regel aus wirtschaftlichen Erfordernissen tut. In Rom wurde es als Zeichen von Armut und eines freien Bürgers unwürdig angesehen, wenn man seine Dienste gegen Geld anbot.[22] Ehrenhaft waren nur höhere Dienste (operae liberales), die besondere Kenntnisse erfordern oder dem öffentlichen Wohl dienen, wie Medizin, Architektur oder Unterricht.
Juristische Beratung war bei den Römern zunächst reiner Freundschaftsdienst, allenfalls unentgeltliches mandatum.[23] Das honorarium als Anerkennung (ursprünglich kein Lohn!) ist erst mit der Niederlassung griechischer, nicht vermögender Gelehrter als Gegenleistung üblich und später in der außerordentlichen, kaiserlichen Gerichtsbarkeit (extraordinaria cognitio) klagbar geworden (Rn. 157). Erst das Christentum brachte die allgemeine Wertschätzung von Arbeit (labor) in dem Sinne, dass es keine Schande ist arbeiten zu müssen.
Die mittelalterlichen Juristen (Rn. 379 ff mit Fn. 46) entwickelten die Dogmatik der locatio conductio weiter. Als Ende des 19. Jahrhunderts das BGB entstand, wurde insbesondere die – liberale oder soziale – Ausgestaltung der hier erwähnten Vertragstypen diskutiert. Auf sie bezog sich der Vorwurf Otto v. Gierkes, es fehle ein „Tropfen sozialistischen Öles“ (Rn. 734).
132
Wir haben bisher drei Elemente des römischen Vertragssystems kennen gelernt: Verbalkontrakte (Rn. 72), Realkontrakte (Rn. 127), Konsensualkontrakte (Rn. 120). Das vierte Element waren die Litteralkontrakte, keine schriftlichen Verträge, sondern Schuldbegründungsakte, die sich aus der römischen Buchführung ergaben. Durch bestimmte Eintragungen in den Geschäftsbüchern entstanden offenbar „abstrakte“ Obligationen. Der spätrömische Kaiser Justinian (insb. Rn. 216 ff), der für die Überlieferung des römischen Rechts eine große Rolle gespielt hat, nahm den Litteralkontrakt nicht in seine Zusammenstellung der römischen Quellen auf, und so sind wir über ihn nur unzulänglich unterrichtet. Jedenfalls gab es im römischen Schuldrecht keine Vertragsfreiheit wie heute nach § 311 BGB. Klagbar waren grundsätzlich Verpflichtungen aus bestimmten typisierten Verträgen und diese Klagen wurden in das Edikt des Prätors aufgenommen.
Ob man jedoch von schuldrechtlichem Typenzwang sprechen sollte (wie wir ihn heute nur im Sachenrecht akzeptieren), erscheint fragwürdig.[24] Die Systematisierungsbestrebungen sind wahrscheinlich erst später aufgekommen. Jedenfalls sorgten die Prätoren mit ihrer Rechtsfortbildung dafür, dass entsprechend den praktischen Bedürfnissen anerkennenswerte Vereinbarungen auch eingeklagt werden konnten oder – sofern dies dienlicher war – daraus eine Einrede (exceptio) gewährt wurde. So gab es besondere (prätorische) Klagen gegen Schiffer (nautae) wegen des ihnen anvertrauten Gutes, gegen Bankiers (argentarii) sowie gegen Herbergs- und Stallwirte (caupones, stabularii) wegen der von den Gästen eingebrachten Sachen (Vorläufer der §§ 701 ff BGB) und auch eine Klage aus formlosem Schuldanerkenntnis (constitutum debiti). Man spricht hier von pacta praetoria.
Zusätzliche Erweiterungen der Klagemöglichkeiten folgten in klassischer Zeit in Gestalt sog. Innominatrealkontrakte (Rn. 188). Pacta legitima betrafen Schenkungen und sind spät- oder nachklassisch (Rn. 189). Vorher benutzte man die Stipulation, um ein Schenkungsversprechen klagbar zu machen. Handschenkungen hingegen, also sofort vollzogene Schenkungen, waren nach klassischem Recht formlos gültig, soweit nicht die Übereignung der Sache einer Form (mancipatio, Rn. 68) bedurfte. Diese Klagen, die alle nicht in das Vertragssystem passen, sowie im Einzelfall gewährte Klagen (actiones in factum, actiones utiles) deckten die Bedürfnisse der Praxis ab, sodass das Fehlen der Vertragsfreiheit im heutigen Sinne zu keinen Unzuträglichkeiten führte. Am besten vermeidet man unsere moderne Terminologie sogar in diesem Zusammenhang.
133
Durch die Stellvertretung entsteht rechtliche Bindung zwischen einem selbst nicht Handelnden (Vertretener, Prinzipal) und einem Vertragspartner durch Einschaltung eines Vertreters. Stellvertretung wird gelegentlich als „rätselhafte Rechtsfigur“ oder „juristisches Wunder“ bezeichnet und ist keinesfalls so selbstverständlich, wie sie uns heute in den §§ 164 ff BGB entgegen tritt. Das römische Recht kannte sie grundsätzlich nicht. Vielmehr galt der Grundsatz der Höchstpersönlichkeit der Obligationen, d.h. eine schuldrechtliche Bindung setzte grundsätzlich das persönliche Aktivwerden der beteiligten (freien) Personen voraus. Aus dem gleichen Grunde gab es auch keine Abtretung von Forderungen, sondern diese mussten zwischen dem Schuldner und dem neuen Gläubiger neu begründet werden.
Die Vorteile der Stellvertretung zeigen sich in einer arbeitsteiligen Wirtschaft. In Rom war es jedoch durch die Gewaltunterworfenen möglich, ähnliche Ergebnisse, aber mit ganz anderen rechtlichen Konstruktionen, zu erzielen.
Hauskinder und Sklaven erwarben unter gewissen Voraussetzungen Besitz und Eigentum für ihren Familienvater (pater familias) bzw. Herrn (dominus). Sie konnten ihm auch Ansprüche gegen Dritte mittels Stipulation verschaffen. Mit den sog. adiektizischen Klagen gestattete der Prätor, dass der Geschäftspartner, der mit einem Untergebenen kontrahierte, dessen Herrn, Vorgesetzten oder Vater auf das verklagte, was der Untergebene dem Partner versprochen hatte. Ob der Untergebene (auch) selbst schuldete, hing davon ab, ob er frei war. Sklaven konnten nicht rechtlich, sondern nur „natürlich“ schulden. Wirtschaftlich interessanter war in jedem Fall die Haftung des Vaters oder Herrn.
134
Die adiektizischen Klagen waren die folgenden: Hatte der Gewalthaber seinem Hauskind oder Sklaven ein sog. peculium (Sondervermögen, etwa einen Gewerbebetrieb oder einen landwirtschaftlichen Hof) zur selbstständigen Bewirtschaftung überlassen, so haftete er auf Grund der actio de peculio den Vertragspartnern des Hauskindes oder Sklaven. Die actio de peculio (Klage wegen eines Sondervermögens) lautete:
Titius iudex esto. Quod Aulus Agerius apud Stichum, qui in postestate Numerii Negidii est, mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Stichum, si liber esset, ex iure Quiritium Aulo Agerio dare facere oporteret ex fide bona, eius iudex Numerium Negidium Aulo Agerio dumtaxat de peculio et si quid dolo malo Numerii Negidii factum est, quominus peculii esset, vel si quid in rem Numerii Negidii inde versum est, condemnato, si non paret, absolvito.
Übersetzung:
Titius soll Richter sein. Wenn sich herausstellt, dass A.A. dem Stichus, der in der Gewalt des N.N. ist, einen silbernen Tisch in Verwahrung gegeben hat, worum es geht, was wegen dieser Angelegenheit Stichus, wenn er frei wäre, nach quiritischem Recht dem A.A. geben oder tun müsste nach guter Treue, dazu soll der Richter den N.N. an A.A., soweit das Sondervermögen reicht, und wenn durch böse List des N.N. geschehen ist, dass etwas (daraus) dem Vermögen des N.N. zugewendet worden ist, verurteilen. Wenn es sich nicht herausstellt, soll er freisprechen.
Stichus ist ein üblicher Blankettname für einen römischen Sklaven. Es geht in dem konkreten Beispiel um eine actio depositi (Verwahrungsklage). Der Sklave Stichus soll für den Kläger einen silbernen Tisch verwahrt haben. Beklagter ist jedoch der (unbeteiligte) Herr des Stichus, weil der Sklave nicht verklagt werden konnte. Mittels sog. Subjektumstellung wird erreicht, dass der Herr zu dem verurteilt wird, wozu sich sein Untergebener Stichus, wäre er frei, hätte verpflichten können. Allerdings beschränkt sich die Haftung des Herrn grundsätzlich auf den Bestand des dem Sklaven zur Bewirtschaftung überlassenen Sondervermögen (peculium). Manche Sklaven führten mittels dieses Sondervermögens selbstständig Geschäfte. Das peculium gehörte zwar formal dem Herren, haftete aber den Geschäftspartnern.
Bei selbstständiger Betriebsführung einer Gastwirtschaft oder eines Ladens durch einen institor wurde die actio institoria gewährt. Jünger war die actio quod iussu (Klage wegen Ermächtigung) auf Grund einer Ermächtigung (iussum) zur Vornahme eines Einzelgeschäfts. Sie wurde zunächst nur bei Ermächtigung von Hauskindern erteilt, in spätklassischer Zeit auch bei der von Vermögensverwaltern (Prokuratoren) welche typischerweise Freigelassene waren. Und mit der actio exercitoria (Reederklage) klagte der Vertragspartner eines Schiffskapitäns gegen den Reeder. Der Spätklassiker Papinian dehnte dann die Haftung des Geschäftsherren auch auf Freie aus (Rn. 170) und legte damit die Grundlage für die Entwicklung der modernen Stellvertretung.
§ 4 Der Prinzipat[1]
Literatur:
Bleicken, Verfassungsgeschichte und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreiches, Bd. 1 (4. Aufl. 1995); ders., Prinzipat und Republik. Überlegungen zum Charakter des römischen Kaisertums (1991); Christ, Die Römische Kaiserzeit: Von Augustus bis Diokletian (5. Aufl. 2018); Eck, Augustus und seine Zeit (6. Aufl. 2014); Kunkel/Schermaier, Römische Rechtsgeschichte (14. Aufl. 2005) S. 63 ff; 94 ff, 140 ff; v. Premerstein, Vom Werden und Wesen des Prinzipats (1937, trotz des Alters ein Standardwerk); Sommer, Das römische Kaiserreich, Aufstieg und Fall einer Weltmacht, 2018; Waldstein/Rainer, Römische Rechtsgeschichte (11. Aufl. 2014) S. 154 ff, 185 ff; Wieacker, Römische Rechtsgeschichte II (2006) S. 3 ff; ders., Der römische Jurist und Über das Klassische in der Römischen Jurisprudenz, beides in: Vom Römischen Recht. Zehn Versuche (2. Aufl. 1961) S. 128 ff und S. 161 ff.
Zum Privatrecht und Prozessrecht siehe § 2.
135
Zeit allgemeines historisches Geschehen rechtshistorisch bedeutsam 27 vor – 14 n. Chr. Herrschaft des Augustus (Beginn des Prinzipat) Entstehung der Rechtsschulen klassische Jurisprudenz (1.-3. Jh.) Einführung des ius respondendi 9 n. Chr. Schlacht im Teutoburger Wald 64 Brand Roms (Nero), Christenverfolgung 79 Ausbruch des Vesuv um 130 Ediktsredaktion des Julian um 150 Institutionen des Gaius 212 constitutio Antoniana 235-284 Reichskrise, Soldatenkaiser Beginn der nachklassischen Zeit ab 284 Dominat (ab Herrschaft Diokletians)
I. Rechtliche Grundlagen der Herrschaft des princeps
136
Durch das Ende Caesars (Rn. 103) gewarnt, war Octavian bemüht, seine Herrschaft möglichst unter Benutzung republikanischer Institutionen zu festigen. So erhielt er in der Senatssitzung am 13.1.27 v. Chr. vom Senat zunächst ein auf 10 Jahre befristetes imperium und damit den Oberbefehl über das gesamte Militär des römischen Reiches, im Jahre 23 v. Chr. außerdem auf Lebenszeit das imperium proconsulare maius, d.h. die Militär- und Zivilgewalt in Italien und allen Provinzen. Er beschränkte sich jedoch faktisch auf die Verwaltung der sieben noch nicht befriedeten Provinzen, darunter Gallien und Spanien. Diese Provinzen waren insofern wichtig, als dass dort die Legionen standen und damit der Hauptteil des Militärs. Die restlichen zehn Provinzen überließ er dem Senat zur Verwaltung. Die Einteilung in kaiserliche und Senatsprovinzen blieb während des ganzen Prinzipats bestehen.
Der Senat verlieh ihm 27 v. Chr. den Ehrennamen Augustus (der Erhabene, Heilige). Das Konsulat, das Augustus seit 31 v. Chr. innehatte, legte er 23 v. Chr. nieder, ließ sich aber später zuweilen noch zum Konsul wählen, und der Senat gab ihm das Recht, dort wie ein Konsul Anträge zu stellen (ius agendi cum patribus). Zu der tribunizischen sacrosanctitas (Rn. 46, 106) und dem ius auxilii (Interzessionsrecht gegenüber Magistraten) erhielt er die volle tribunizische potestas (Amtsgewalt eines Volkstribuns), d.h. auch das Recht, concilia plebis und den Senat einzuberufen. Außerdem übte er die Befugnisse eines Zensors (Rn. 81) aus, zu denen vor allem die lectio senatus gehörte, also die Ernennung von Senatoren. 12 v. Chr. wurde er schließlich noch pontifex maximus (Rn. 49 f). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Augustus die Macht eines Oberkommandierenden über das gesamte Militär mit den Zuständigkeiten eines Konsuls, Volkstribuns, Zensors und Oberpriesters zukam – auf Lebenszeit.
137
Er selbst nannte sich nach republikanischen Vorbildern aus dem Bereich des Klientenwesens princeps civium, erster der Bürger, und betonte in seinem Rechenschaftsbericht, den res gestae, er habe nicht mehr Amtsgewalt (potestas) als seine Amtskollegen gehabt, aber alle an Ansehen (auctoritas) überragt. Dieser Rechenschaftsbericht ist vor allem als Monumentum Ancyranum genannte Inschrift erhalten (aufgestellt in Ankara).
Zunächst als Privatmann und mit seinem eigenen Vermögen baute Augustus einen Beamtenapparat auf. Nachdem der ermordete Caesar 43 v. Chr. vom Senat zum Gott erklärt worden war („Apotheose“), bildete sich in den östlichen und westlichen Provinzen schon zu Lebzeiten des Augustus ein Kaiserkult heraus, der später zu erheblichen Schwierigkeiten mit den monotheistischen Juden und Christen führen sollte (Rn. 147). Domitian (81-96 n. Chr.) war der erste Kaiser, der offiziell den Titel dominus et deus (Herr und Gott) führte.
Der Fortbestand republikanischer Einrichtungen gab für die neue Herrschaftsform des Prinzipats nur die Fassade her. Das politische System der Republik mit seinen „checks and balances“ (Rn. 48) war der Alleinherrschaft des princeps (Kaisers) gewichen. Begleitet wurde die neue Herrschaft von einer regen Propaganda für altrömische politische und kulturelle Werte (durch den Historiker Livius, die Dichter Vergil und Horaz, aber auch die Verbannung des „zersetzenden“ Ovid). Ohne dass von einer Demokratie auch nur im entferntesten die Rede sein kann, erleichterte das Prinzipat das Los der Massen wenigstens an seinem Anfang, brachte einigen Frieden (pax Augusta) und verringerte die Ausbeutung der Provinzen. Der schon von Caesar initiierte Gedanke eines Weltreiches machte Fortschritte, wodurch trotz aller gegenteiliger Kulturpropaganda das altrömische Element zunehmend von Provinzialen verdrängt wurde.
138
Die von Augustus in Anspruch genommenen Kompetenzen wurden die Grundlage für die Herrschaft seiner Nachfolger, wobei sich diese Herrschaft faktisch mehr oder weniger milde oder autokratisch-despotisch gestaltete, der Kaiser jedenfalls aber mehr Macht ausübte, als ihm formal zustand. Auch eine ausdrückliche Regelung der Nachfolge gab es nicht. Die Kaiser bestimmten ihre Nachfolger zum Teil selbst, die dann vom Senat und vom Militär ausgerufen wurden. Praktisch bildeten sich Dynastien heraus: die julisch-claudische Dynastie von Augustus bis Nero, die Flavier, die sog. Adoptivdynastie des Nerva („Senatskaiser“), die Antonine, die Severer.
Politisch stand die alte Senatsaristokratie dem Prinzipat zunächst kritisch gegenüber; das ist bei den wenig schmeichelhaften historischen Berichten vor allem über die julisch-claudische Dynastie zu berücksichtigen. So standen die Autoren Sueton und Tacitus auf der Seite der Opposition gegen die Kaiser. Dieser Gegensatz hörte erst mit Beginn des 2. nachchristlichen Jahrhunderts und den sog. Senatskaisern ab Nerva auf.
139
Es entspricht der Grundidee des Prinzipats, dass die alten republikanischen Einrichtungen (Rn. 77 ff) erhalten blieben, wenn auch überwiegend nur der äußeren Form nach. Das Konsulat wurde, soweit der Kaiser es nicht selbst innehatte, als Ehrentitel vergeben. Die Jahre des römischen Kalenders wurden noch unter dem byzantinischen Kaiser Justinian (527-565 n. Chr., Rn. 216 ff) wie in der Republik nach den jeweiligen beiden Konsulen benannt. Die Prätoren blieben Herren der Zivilgerichtsbarkeit, soweit nicht die neue Prozessart der Beamtenkognition (Rn. 154 ff) allmählich den Formularprozess verdrängte. Außerdem sorgten die Prätoren nunmehr für die öffentlichen Spiele. Die Ädilen behielten weiterhin Polizei und Gerichtsbarkeit auf dem Markt. Die Quästoren verloren jedoch bald die Aufsicht über das „alte“, nunmehr „senatorische“ Staatsvermögen (aerarium populi Romani). Dafür wurden zunächst Prätoren, später kaiserliche Beamte (praefecti aerarii) eingesetzt. Ebenfalls neue quaestores Augusti wurden zu persönlichen Assistenten des Kaisers. Volkstribunat und Zensur besetzte man nicht mehr, da der Kaiser deren Kompetenzen ausübte.
140
Die Volksversammlungen (Rn. 88 ff) wurden noch für die Einsetzung der Magistrate benutzt. An die Stelle einer echten Wahl trat jedoch der Vollzug der Kandidatenempfehlung des princeps. Die Komitialgerichtsbarkeit war schon in der letzten Zeit der Republik durch Einrichtung von Strafgerichtshöfen (quaestiones) verdrängt worden, besonders unter Sulla (Rn. 98).
Augustus ließ noch Volksgesetze verabschieden: Ehegesetze (Rn. 149), Gesetze zur Einschränkung von Sklavenfreilassungen (Rn. 150) und zur Abschaffung des in der Praxis bereits vom Formularverfahren verdrängten Legisaktionenprozesses (Rn. 56 ff, 117).
Die Gesetzgebung verlagerte sich aber zunehmend von den Volksversammlungen auf den Senat: es gab nun vermehrt senatus consulta, Senatsbeschlüsse, auch auf dem Gebiet des Privatrechts. In den ersten Jahrzehnten fungierte der Senat auch als Kriminalgericht in politisch heiklen Fällen.
Der Senat (Rn. 87) wurde mit Rücksicht auf das Recht des princeps, die Senatoren zu berufen, zu einem kaiserlichen Akklamationsorgan, d.h. die ehemaligen Herren im Staate durften nun dem Einzelherrscher zustimmend applaudieren. Wenn auch unter der Oberhoheit des princeps, so verblieb dem Senat immerhin die Verwaltung der Senatsprovinzen und der Senatskasse (aerarium populi Romani). In die den Kaisern besonders nahe stehende Provinz Ägypten durften Senatoren nur mit kaiserlicher Genehmigung reisen.