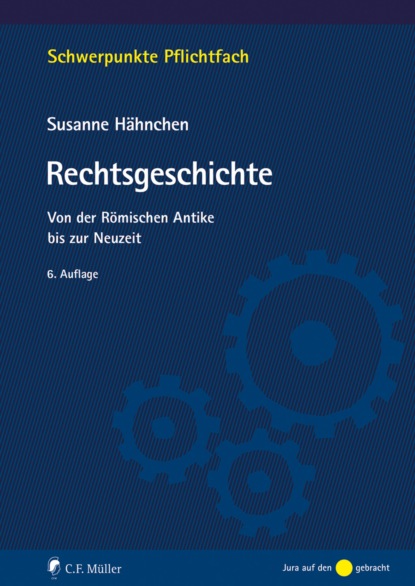- -
- 100%
- +
III. Das letzte Jahrhundert der Republik
95
Die Verdrängung der traditionellen Landwirtschaft durch das Latifundienwesen führte zum Niedergang der römischen Bauern, die auch die Kriegsdienste im Volksheer leisten mussten. Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. standen weite Teile des römischen Acker- und Weidelandes als ager publicus (öffentliches Land) zwar formell im Eigentum des römischen Volkes, wurden aber faktisch von den meistens dem Senatsadel angehörenden Großgrundbesitzern genutzt. Daran anknüpfend und gestützt auf die Volksversammlung wurde durch die Popularen (von populuaris = volksfreundlich) die soziale Frage gestellt. Es war aber letztlich ein Machtkampf innerhalb der Senatsaristokratie. Tatsächlich waren die Führer der Popularen – wie ihre Gegener, die im Senat vorherrschenden, konservativen Optimaten (von optimates = die Besten) – alle Angehörige der Nobilität, also der herrschenden Familien. Diese Gruppierungen waren keine durchorganisierten Parteien im modernen Sinne, sondern informelle Zusammenschlüsse Gleichgesinnter. Eine wichtige Rolle in den Auseinandersetzungen spielte das Klientenwesen (Rn. 41, 75), das die Grundlage war für die Mobilisierung der Anhängerschaft der politischen Kontrahenten.
In der Folge dominierender Einzelpersönlichkeiten in der Politik kam es zur Veränderung der Herrschaftsstrukturen. Die republikanischen Institutionen wurden zwar nicht offiziell abgeschafft, aber von neuen Erscheinungen überlagert. Man nennt das letzte Jahrhundert der Republik, das dann schließlich in die neue Herrschaftsform des Prinzipats (der Kaiserzeit) einmündete, auch das Revolutionsjahrhundert.
96
Zum offenen Ausbruch kamen die politischen Gegensätze zunächst im Jahre 133 v. Chr., als der Volkstribun Tiberius Sempronius Gracchus ein Gesetz zur Beschränkung der Anteile einzelner bei der Nutzung des ager publicus durchsetzen wollte. Angeblich sollte damit nur ein älteres Gesetz wiederhergestellt werden: Dieses Gesetz gehörte zu den lizinisch-sextischen Gesetzen (367 v. Chr.) und bestimmte, niemand dürfe mehr als 500 iugera (Morgen) Ackerland besitzen. Den auf Geheiß des Senats mit Veto einschreitenden Kollegen ließ Tiberius S. Gracchus durch ein Gesetz (vermutlich ein Plebiszit) absetzen, was einem Verfassungsbruch gleich kam. Als er sich dann auch noch entgegen den bisher beachteten Regeln für ein zweites Amtsjahr wählen lassen wollte, kam es zu Unruhen, in deren Verlauf er und eine Anzahl seiner Anhänger getötet wurden. Damit begann die letzte Phase der Republik, in der Verfassungsbruch und brutale Gewalt die Regel waren.
Der jüngere Bruder Gaius Sempronius Gracchus setzte die sog. Gracchischen Reformen fort. Er war Volkstribun 123/122 v. Chr. und erreichte die Zuteilung von neuen Bauernstellen auf ehemaligem ager publicus. Diese Siedlerstellen waren Privateigentum, aber zum Schutz ihrer Inhaber unveräußerlich. Außerdem ließ er in Italien und Karthago Kolonien für römische Bürger gründen, wies die Aburteilung ausbeuterischer Provinzialstatthalter Richtern aus dem Ritterstand zu und begründete die verbilligte, später kostenlose Versorgung der Armen in der Hauptstadt mit Getreide.
Nach Ablauf seines Tribunats wurde Gaius S. Gracchus auf Grund eines senatus consultum ultimum (Rn. 87) umgebracht. Durch ein Gesetz vom Jahre 111 v. Chr. hob man die Unveräußerlichkeit der neuen Siedlerstellen auf, die nun bald von den Großgrundbesitzern zurückgekauft werden konnten.
97
In den Kriegen gegen die germanischen Ambronen, Kimbern und Teutonen sowie gegen den numidischen König Jugurtha erwies sich der Ritter Gaius Marius als ein Retter des Vaterlandes. 104-100 v. Chr. wurde er fünfmal hintereinander zum Konsul gewählt, obwohl die Wiederwahl nach einem Gesetz aus dem Jahre 151 v. Chr. verboten sein sollte. Er errang seine militärischen Erfolge mithilfe eines neuartigen Berufsheers aus besoldeten proletarii, die zu ihm in einem klientenmäßigen Abhängigkeitsverhältnis standen. Der Plan des Marius, die ehemaligen Soldaten (Veteranen) mit Ackerland zu versorgen, führte zu einer Konfrontation mit den nobiles, in der Marius zunächst unterlag. Nach dem Bundesgenossenkrieg (Rn. 76) ließ Marius 88 v. Chr. dem konservativen Konsul Sulla, Angehöriger der Optimaten, das Oberkommando im Krieg gegen Mithridates von Pontus entziehen. Sulla erstürmte daraufhin Rom. Marius konnte entkommen und verfolgte seine Gegner, von seinem Anhänger Cinna nach dem Abzug Sullas in das Amt des Konsuls zurückgebracht, durch Hinrichtungen und Vermögenseinziehungen. Marius starb 86 v. Chr.
98
85 v. Chr kehrte Sulla aus dem Krieg gegen Mithridates zurück, erstürmte Rom und rächte sich nun seinerseits an seinen Feinden. Cinna wurde 84 v. Chr. ermordet, nachdem er drei Jahre offenbar ohne Wahl regiert hatte. Auf Grund der sog. Proskriptionen (öffentliches Anschreiben der Namen) gab Sulla seine Gegner zur Tötung frei, zog ihre Vermögen ein und schloss sie sowie ihre Nachkommen von öffentlichen Ämtern aus. Durch ein Volksgesetz (lex Valeria) ließ er sich 82 v. Chr. zum Diktator (Rn. 85) ohne zeitliche Begrenzung ernennen, mit allumfassender, auch gesetzgebender Gewalt. Das war eine bislang in Rom unbekannte Diktatur neuen Stils. Außerdem ließ er sich zum Konsul wählen.
Sulla festigte vorübergehend die Herrschaft des Senatsadels. So durften nur noch Senatoren zu Volkstribunen gewählt werden. Gleichzeitig wurden die Befugnisse der Tribune beschränkt. Den Senat verdoppelte er durch die Ernennung von 300 neuen Senatoren, zum großen Teil eigene Anhänger aus dem Ritterstand. Strafprozesse kamen vor neu eingerichtete ständige Strafgerichtshöfe (quaestiones perpetuae). Oberitalien wurde zur provincia Gallia Cisalpina. Seine Veteranen siedelte Sulla auf unveräußerlichen Bauernstellen an. 79 v. Chr. legte er die Diktatur freiwillig nieder und starb im folgenden Jahr. Seine „konservativen“ (alte Institutionen bewahrende) Maßnahmen wurden unter den späteren, den Popularen nahe stehenden Amtsträgern zum großen Teil wieder rückgängig gemacht.
99
In die Jahre 73 bis 71 v. Chr. fällt der große Sklavenaufstand. Angeführt wurde er von dem vermutlich aus Thrakien stammenden Spartacus, der zusammen mit 78 anderen Gladiatoren aus einer Gladiatorenschule floh. Zahlreiche Sklaven aus landwirtschaftlichen Großbetrieben (Latifundien), aber auch verarmte Freie schlossen sich den Rebellen an. Nach anfänglichen militärischen Erfolgen des durch Italien ziehenden, riesigen Sklaven-Heeres über die römischen Legionen scheiterte der Aufstand, weil den Aufständischen ein politisches Programm fehlte und das Ziel vorrangig in der Flucht in die Heimat bestand. Der römische Reichtum basierte jedoch maßgeblich auf der Ausbeutung der Sklaven und daher konnte und wollte man ein solches Verhalten nicht hinnehmen.
Die vernichtende Schlacht bei Tarentum wurde von Lucullus, Crassus und Pompeius geführt. Die überlebenden etwa 6000 Sklaven ergaben sich und wurden von Crassus an der Via Appia, der nach Rom führenden Straße, gekreuzigt.
100
63 v. Chr. versuchte der Senator Catilina gewaltsam an die Macht zu kommen, nachdem seine Bewerbungen um das Konsulat wiederholt gescheitert waren. Überliefert ist diese (aufgedeckte) Catilinarische Verschwörung durch die gegen deren Anführer gerichteten Gerichtsreden Ciceros, der Catilina schon vorher bekämpft und sozialrevolutionärer Umtriebe bezichtigt hatte. Auch der konservative Schriftsteller Sallust schilderte Catilina und seine Leute später als verkrachte Existenzen, Catilina selbst als Überläufer zum anderen politischen Spektrum, nachdem seine Ambitionen auf der konservativen Seite keinen Erfolg hatten. Cicero ließ die Anhänger des Catilina aufgrund eines senatus consultum ultimum (Rn. 87) ohne Gerichtsverfahren hinrichten. Die Popularen hielten dieses Vorgehen für rechtswidrig, und Cicero musste nach Änderung der politischen Mehrheiten im Jahre 58/57 v. Chr. für 17 Monate nach Griechenland ins Exil gehen. Nach einer lex Sempronia aus dem Jahre 123 v. Chr. entgingen römische Bürger nämlich durch das Exil der Todesstrafe.
101
60 v. Chr. verbündeten sich Crassus, Pompeius (Rn. 99) und Caesar zum sog. ersten Triumvirat (Bündnis aus drei Männern). Dieses stellte an sich eine private Abrede ohne staatsrechtliche Grundlage dar. Crassus war ein Finanzmann, der die Basis seines Vermögens bei den Proskriptionen Sullas (Rn. 98) erworben hatte. Pompeius taktierte politisch zwischen den Optimaten und den Popularen.
Gaius Iulius Caesar wurde 100 v. Chr. in einer patrizischen Familie geboren. Er war der Neffe der Ehefrau des Marius (Rn. 97) und verheiratet mit einer Tochter des Cinna (Rn. 97 f). In seiner Jugend hatte er unter den Proskriptionen Sullas gelitten. Er war zunächst vom Quästor zum Prätor aufgestiegen, danach Proprätor in Spanien gewesen und pontifex maximus (Rn. 50). Für das Jahr 59 v. Chr. wurde er zum Konsul gewählt. Er setzte verschiedene Gesetze gegen den Widerstand des Senats durch, u. a. zur Versorgung der Veteranen des Pompeius mit Land. Im Volk war er sehr beliebt und erhielt durch ein Plebiszit das prokonsularische Imperium als Statthalter über die Provinzen Gallia Cisalpina (Oberitalien), Illyricum (Dalmatien) und Gallia Narbonensis (Südfrankreich), bis 49 v. Chr. verlängert um weitere fünf Jahre. Während dieser Zeit, im Jahre 52 v. Chr., warf er den Aufstand der Gallier unter Vercingetorix nieder.
102
Bereits im Jahr 53 v. Chr. endete das Triumvirat. Crassus war im Krieg gegen die Parther gefallen. Pompeius versuchte in Rom, die politischen Fäden in der Hand zu behalten und näherte sich dem Senat an. Er bekleidete ab 52 v. Chr. das Amt eines consul sine collega, eines Konsul ohne Kollegen, also eine neue Art von Diktatur (Rn. 85, 98). Nach einer lex Pompeia vom Jahre 52 v. Chr. sollten Provinzstatthalter künftig wieder vom Senat ausgewählt werden sowie zwischen Statthalterschaft und Höchstmagistratur mindestens fünf Jahre liegen. Caesar nahm dieses Gesetz zu recht persönlich. Verhandlungen zwischen Caesar auf der einen sowie dem Senat und Pompeius auf der anderen Seite scheiterten. Dabei verweigerte Caesar u. a. die einseitige Auflösung seiner Legionen. Nach Ablauf seines Prokunsulats 49 v. Chr. beschloss der Senat ein gegen Caesar gerichtetes senatus consultum ultimum (Rn. 87).
Die Legionen des römischen Heeres standen in den Provinzen unter dem Kommando der Provinzstatthalter. Gestützt auf die militärische Macht der Legionen dreier Provinzen überschritt Caesar am 11.1.49 v. Chr. das Grenzflüsschen Rubikon in Norditalien, angeblich mit dem Ausspruch alea iacta est (der Würfel ist geworfen). Sein Verhalten war insofern revolutionär bzw. rechtswidrig, als er Kommandogewalt nur in seinen Provinzen gehabt hatte und nach Beendigung der Statthalterschaft an sich gar keine mehr.
Der anschließende Bürgerkrieg endete mit Siegen Caesars. Pompeius war 48 v. Chr. auf der Flucht nach Ägypten zu der dort mit ihrem Bruder Ptolomaios regierenden Königin Kleopatra ermordet worden.
103
Schon 49 v. Chr. hatte sich Caesar durch Plebiszit (!) zum Diktator ernennen und in den Folgejahren mehrfach zum Konsul wählen lassen. 46 v. Chr. erhielt er die Diktatur auf 10 Jahre, im nächsten Jahr wohl durch einen Senatsbeschluss die Diktatur zur Führung der Staatsgeschäfte auf Lebenszeit. Er hatte die sacrosanctitas eines Volkstribunen (Rn. 46), ohne das Amt selbst zu bekleiden. Als erster Römer ließ er sich auf Münzen abbilden, geschmückt mit einem Kranz, wie ihn die altrömischen Könige getragen haben mögen.
Ob Caesar wirklich nach der Königswürde gestrebt hat, ist unter den Historikern umstritten. 44 v. Chr. ermordeten ihn vor einer Senatssitzung in Rom der Senatsaristokratie nahe stehende Verschwörer, angeführt von Iunius Brutus, einem Urenkel des Volkstribunen Livius Drusus, Freund Ciceros und Parteigänger des Pompeius. Brutus beging Selbstmord nach der Schlacht bei Philippi, 42 v. Chr. Sein Onkel Cato Uticensis hatte sich 46 v. Chr. das Leben genommen wegen des Untergangs der republikanischen Freiheit. Die Caesarmörder beriefen sich zu ihrer Rechtfertigung auf einen Eid, den das römische Volk nach Vertreibung der Könige geschworen haben soll. Danach wollte kein Römer jemals wieder die Herrschaft eines Königs dulden.
104
Caesar hatte seine politischen Gegner nicht mit Proskriptionen verfolgt, wie Marius und Sulla, sondern versucht, sich mit ihnen zu versöhnen (clementia Caesaris, die sprichwörtliche Milde Caesars). Auch um eine Verständigung mit Cicero war er bemüht.
Caesar ließ Kolonien auf dem italienischen ager publicus und in den Provinzen gründen, nicht nur zur Versorgung seiner Veteranen, sondern auch für die Neuansiedlung des römischen Stadtproletariats. Schon 49 v. Chr. hatte er den Einwohnern Italiens das römische Bürgerrecht verliehen. Städten in den Provinzen, vor allem in Spanien und Südfrankreich, verschaffte er das latinische Recht (römisches commercium und connubium; Wahlrecht für Ratsherren). Verdiente Persönlichkeiten in den Provinzen wurden römische Bürger.
Caesar betätigte sich stark als Gesetzgeber. Er erließ eine einheitliche Gerichtsordnung für Gallia Cisalpina (lex Rubria) und eine Munizipalordnung für Italien (lex Iulia municipalis). Sein Plan, das ius civile zu kodifizieren, blieb unausgeführt.
Die Zahl der Senatoren erhöhte er auf 900, darunter viele aus dem ländlichen Italien, aus Spanien und Gallien. In Caesars Wirken kündigte sich die neue Herrschaftsform des Prinzipats bereits an, aber auch die Umwandlung des römischen Gemeinwesens von einem städtischen Herrschaftszentrum zu einem Flächenstaat.
105
Nach dem Tode Caesars bildeten Octavianus (Großneffe und Adoptivsohn Caesars), Marcus Antonius und Marcus Aemilius Lepidus 43 v. Chr. das zweite Triumvirat. Durch ein Plebiszit ließen sie sich als tresviri rei publicae constituendae diktatorische Befugnisse für fünf und später für fünf weitere Jahre übertragen. Mit den Anhängern der Caesarmörder kam es zum Bürgerkrieg, in dem diese 42 v. Chr. bei Philippi eine entscheidende Niederlage erlitten. Octavian ließ (ohne selbst daran interessiert zu sein) auf Betreiben des Antonius Cicero hinrichten. Lepidus trat 36 v. Chr. zurück. Octavian herrschte zunächst im Westen des Reiches, Antonius im Osten. Mit der ägyptischen Königin Kleopatra hatte Antonius drei Kinder (nachdem sie schon einen Sohn von Caesar hatte). Schließlich kam es zum Machtkampf zwischen Octavian und Antonius. Kleopatra und Antonius begingen Selbstmord nach der Seeschlacht bei Aktium an der Westküste Griechenlands (31 v. Chr.).
106
Octavians Triumviralgewalt endete 32 v. Chr. Von 31 bis 23 v. Chr. war er Konsul. Schon 36 v. Chr. hatte er sich – wie früher Caesar – die tribunizische sacrosanctitas (Unverletzlichkeit) verleihen lassen. 30 v. Chr. kam das ius auxilii (Interzessionsrecht als Volkstribun) hinzu. Ebenfalls nach dem Vorbild seines Adoptivvaters Caesar und in Anlehnung an das Institut der Klientel ließ er sich 32 v. Chr. einen Gefolgschaftseid Italiens und der westlichen Provinzen schwören (coniuratio Italiae et provinciarum). Politisch richtete sich dieser Eid gegen seine Widersacher im Osten des Reiches. Nach seinem Triumph im Jahre 29 hatte er keine militärischen Befugnisse mehr. Am 13.1.27 v. Chr. gab er die ihm verbliebenen Rechte feierlich an den Senat zurück, empfing jedoch neue, die seine künftige Herrschaft als princeps (Kaiser) unter dem Namen Augustus begründeten (Rn. 135).
1. Grundlegende Veränderungen
107
Das alte Zivilrecht (ius civile) der XII Tafeln zeichnete sich durch hohen Formalismus aus und war grundsätzlich nur für römische Bürger anwendbar (Rn. 42, 56 ff). Seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. fanden nicht nur kriegerische Eroberungen statt, sondern der Handel – insbesondere mit Nichtrömern – dehnte sich aus. Hierfür brauchte man neue Lösungen. Sie entwickelten sich parallel zu den älteren Formen vermutlich in der Rechtsprechung des praetor peregrinus (Rn. 80, 119) und begründeten nicht unwesentlich den späteren Ruhm des römischen Rechts.
2. Gesetzgebung
108
Durch Gesetze wurden während der Republik nur Teilfragen des Privatrechts neu geregelt. Am wichtigsten war die lex Aquilia, nach der Überlieferung ein Plebiszit aus dem Jahre 286 v. Chr. und damit das erste nach der lex Hortensia von 287 v. Chr. (Rn. 46, 93). Danach hätte die lex Aquilia im besonderen Interesse der Plebejer gelegen. Heute hingegen meinen viele Gelehrte wohl zutreffend, die wirtschaftliche Entwicklung zwinge zu der Annahme, dass die lex Aquilia erst um 200 v. Chr. erlassen worden sei.[6] Gegenüber dem älteren Recht der XII Tafeln (XII tab. 8, 3, Rn. 70) ist auffällig, dass bei der Verletzung eines Sklaven nicht mehr eine feste Geldbuße (150 Asse) geschuldet, sondern ein am Interesse des Eigentümers orientierter Schadensersatz bestimmt wurde. Darin dokumentiert sich nicht nur die Geldentwertung[7], die feste Bußen sinnlos machte, sondern auch die Entwicklung der Sklaven von (wenn auch minderberechtigten) Personen zu bloßen Trägern der „Ware“ Arbeitskraft.
Das Gesetz hatte drei Kapitel. Im ersten war bestimmt, dass bei Tötung (occidere) eines Sklaven oder eines vierfüßigen Herdentieres dem Eigentümer Schadensersatz im Betrage des Höchstwertes des Sklaven oder Tieres im letzten Jahr zu leisten ist. Das zweite Kapitel betraf einen vollkommen anderen, hier nicht interessierenden Zusammenhang (den ungetreuen adstipulator). Das dritte Kapitel verpflichtete zum Schadensersatz bei der Verletzung eines Sklaven oder der Zerstörung oder Beschädigung von Sachen durch brennen (urere), brechen (frangere) oder verstümmeln, zerschmettern (rumpere, später cor-rumpere = verderben). Aus den Verben occidere, urere, frangere, rumpere folgerten noch die klassischen Juristen, dass der Schaden durch direkte körperliche Einwirkung auf das verletzte Objekt verursacht werden musste (damnum corpore corpori datum), wenn die lex Aquilia direkte Anwendung finden sollte. Für die Tatbestände der Schädigung durch indirekte Einwirkung (z. B. Verhungernlassen durch Einsperren, Scheuchen von Vieh in einen Abgrund) entwickelte man im Laufe der Zeit sog. analoge Klagen (actiones utiles, actiones in factum)[8], ebenso etwa für die Verletzung freier Hauskinder, die vom Wortlaut Klageformel her auch nicht erfasst waren.
Die Verletzung musste iniuria geschehen sein. Ursprünglich war damit Widerrechtlichkeit gemeint, seit spätrepublikanischer Zeit differenzierte man zur Schuld (culpa).
Das erste und letzte Kapitel der lex Aquilia wurden später im gemeinen Recht verallgemeinert, d.h. nicht mehr nur für bestimmte Sachen und Handlungen angewendet. Sie waren damit die Vorläufer des heutigen § 823 Abs. 1 BGB.
109
Ein anderes das Zivilrecht betreffendes Plebiszit war die lex Cincia (204 v. Chr.). Danach waren Schenkungen verboten, die an nicht nahe verwandte Personen gingen und ein bestimmtes, uns nicht mehr bekanntes Maß überstiegen (donationes immodicae). Trotz unmittelbarer Freigiebigkeit wird auch mit einer Schenkung in weiterem Sinne meist ein Zweck verfolgt. Gemäß einem alten Rechtssatz, dessen Herkunft nicht überliefert ist, waren auch Schenkungen zwischen Ehegatten ungültig, einschließlich des dinglichen Übertragungsgeschäfts. Eine Ausnahme bildete nur die dos (Mitgift).
Wichtig erscheint die lex Laetoria oder Plaetoria (etwa 200 v. Chr.) gegen die Übervorteilung der minores, d.h. junger Leute nach Erreichen der Mündigkeit. Feste Altersgrenzen für die Geschäftsfähigkeit und den Minderjährigenschutz bildeten sich aber wohl erst in klassischer Zeit heraus (Rn. 175).
Die lex Falcidia aus dem Jahre 40 v. Chr. schützte die Erben vor der Aushöhlung des Nachlasses durch Vermächtnisse (Legate). Den Erben musste wenigstens ein Viertel des Nachlasses verbleiben, die sog. quarta Falcidia. Gegen Enterbungen schützte die lex Falcidia allerdings noch nicht (Rn. 180).
3. Entstehung von Rechtswissenschaft
110
Die Rechtslehre war zunächst Geheimwissen der (patrizischen) Priester (Rn. 50). Für die entwickelte Republik sind uns jedoch einzelne Juristen überliefert, vor allem durch ein Buch des Pomponius, eines Juristen aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., der offenkundig rechtshistorische Interessen hatte.[9] Aus seiner Perspektive nannte man die republikanischen Juristen veteres, die Alten. Oft werden sie heute von den späteren klassischen (= vorbildlichen) Juristen (Rn. 161) als Vorklassiker abgegrenzt. Literatur aus dieser Zeit ist nur in geringen Resten erhalten. Trotzdem dürften viele gedankliche Leistungen der römischen Juristen schon hier ihren Ursprung haben. Deshalb sprach Wieacker wohl treffender von der vorliterarischen Klassik.[10] Man kann wohl sagen, dass sich in der Republik die erste Rechtswissenschaft der Weltgeschichte entwickelte. Vor allem im letzten Jahrhundert gehörten griechische Philosophie und Redekunst nicht nur zur allgemeinen Bildung, sondern nahmen auch Einfluss auf die praktische Rechtskunde.
111
304 v. Chr. soll Flavius, der Sekretär des Appius Claudius Caecus (welcher als Zensor Erbauer der Via Appia war), seinem Meister den römischen Kalender mit den Angaben der für Rechtshandlungen und Prozesse geeigneten Tage (dies fasti) sowie die Prozessformeln entwendet und veröffentlicht haben (sog. ius Flavianum). Die Formeln müssten aber an sich durch das öffentliche Aufsagen vor Gericht bekannt gewesen sein. Es ging daher wohl eher um Besonderheiten ihrer Anwendung, und vielleicht hat Appius Claudius seinen Sekretär nur vorgeschoben, um sich nicht den Unwillen seiner Standesgenossen zuzuziehen. Flavius, angeblich Freigelassener oder Sohn eines Freigelassenen, machte aufgrund der Dankbarkeit des Volkes als Volkstribun, Ädil und Senator Karriere.
112
254 v. Chr. erteilte der erste plebejische pontifex maximus, Tiberius Coruncanius (Konsul 280 v. Chr.), öffentlich Rechtsunterricht und Rechtsgutachten. Zu nennen ist auch Sextus Aelius Paetus Catus (Konsul 198 v. Chr.), der tripertita, das sog. ius Aelianum verfasste. Tripertita bedeutet „Dreigeteiltes“, nämlich erst den Text der XII Tafeln, dann die interpretatio, den ersten bekannten juristischen Kommentar, und zuletzt die erforderlichen Spruchformeln. Marcus Porcius Cato (Zensor 184 v. Chr.) publizierte Vertragsbedingungen (Formulare) für landwirtschaftliche Arbeiten und Kaufverträge. Drei weitere Juristen – Manlius Manilius, M. Iunius Brutus und Publius Mucius Scaevola – sollen Mitte des 2. Jahrhunderts dann zusammenhängend über das ius civile im Ganzen geschrieben haben. Sie werden daher als fundatores iuris civiles bezeichnet.
113
Genauer wird die Überlieferung für das letzte Jahrhundert der Republik. Jetzt soll es weniger senatorische Adlige, dafür mehr Ritter gegeben haben, die oft schon Juristen auf Lebenszeit waren, d.h. die Gutachtenpraxis diente nicht mehr in erster Linie der Laufbahn. Besonders bedeutend wegen ihres wissenschaftlichen Beitrages sind die folgenden beiden aus alten Adelsgeschlechtern stammenden Juristen, deren Definitionen und Distinktionen (Unterscheidungen) noch ca. 200 Jahre später zitiert wurden.
Quintus Mucius Scaevola pontifex (Konsul 95 v. Chr.) schrieb eine Art Handbuch, in dem er das Zivilrecht nach dem Vorbild griechischer Systembildung nach Gattungen und Begriffen ordnete und das Vorbild für spätere Darstellungen dieser Art wurde, die sich kommentierend auf ihn bezogen. In der Literatur überliefert sind die causa Curiana (Rn. 116) und ein Gutachten.[11] Dabei ging es um die Ersitzung der ehelichen Gewalt (manus) über gewaltfreie Frauen. Konkret hatte Quintus Mucius entschieden, dass das trinoctium (Rn. 65), also die Unterbrechung der Ersitzungsfrist, unwirksam sei, wenn bereits mit der zweiten Hälfte der dritten Nacht (Tagesgrenze um Mitternacht!) ein neues Jahr beginne.