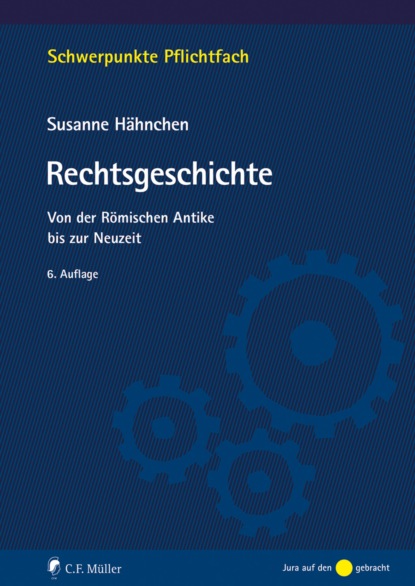- -
- 100%
- +
Servius Sulpicius Rufus (Konsul 51 v. Chr.) war ein Freund Ciceros und absolvierte wie dieser zunächst eine Ausbildung zum Rhetor, war aber nicht so erfolgreich. Sein Lehrer Quintus Mucius soll ihn wegen seiner für einen Patrizier schlechten Rechtskenntnisse getadelt und ausgebildet haben. Von Cicero wurde Servius später sehr gelobt, er habe als erster wissenschaftliche Methode in die Jurisprudenz gebracht. Der kurze Kommentar zum prätorischen Edikt von Servius begründete eine neue, in klassischer Zeit sehr stark verbreitete Literaturgattung (ad edictum).
114
Eine ihrer Aufgaben sahen die veteres in der Herausarbeitung von rechtlichen Regeln (regulae iuris). Die regula Catoniana aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. bezog sich auf Legate, also Vermächtnisse, mit denen der Erblasser einem Dritten nach seinem Tode etwas zukommen lassen wollte, ohne dass derjenige Erbe werden sollte. Diese Anordnung konnte aber aus verschiedenen Gründen unwirksam sein. Nach der regula Catoniana konnte ein bei Errichtung des Testaments unwirksames Vermächtnis nicht nachträglich wirksam werden; es kam also für die Beurteilung der Wirksamkeit ausschließlich auf den Zeitpunkt der Testamentserrichtung an. Anders geregelt ist das heute in § 2171 BGB, und auch schon die klassischen Juristen machten viele Ausnahmen von dieser regula.[12] Es ist typisch, dass die traditionsbewussten Klassiker im Prinzip an ihr festgehalten, sie aber praktisch durch die vielen Ausnahmen an die Bedürfnisse ihrer Zeit angepasst haben. Zu ihrer Zeit war die Regel nämlich noch richtig, denn das Vermächtnis wurde ursprünglich ausgesetzt im Rahmen einer Testamentserrichtung durch eine mancipatio (Rn. 68) unter Lebenden an einen Treuhänder (Rn. 169), der die Sache dem Vermächtnisnehmer nach dem Tode des Erblassers herausgeben sollte. Und über die Wirksamkeit einer solchen mancipatio entschieden natürlich die Umstände bei ihrer Vornahme und nicht die beim Erbfall.
115
Es gibt frühe Beispiele für die Ausfüllung von Lücken im Recht durch die auch uns bekannten (gegensätzlichen) Schlusstechniken Analogie und Umkehrschluss (argumentum e contrario). Im Gegenschluss zu XII tab. 4, 2 ließ man Enkel und Töchter schon nach einmaligem „Verkauf“ frei werden (Rn. 64). Eine Analogie wendete man an, wenn eine Klage nicht direkt auf einen Sachverhalt passte, aber Rechtsschutz doch geboten schien. Eine Version der legis actio sacramento (Rn. 56) hatte das Abholzen von Bäumen zum Gegenstand (actio de arboribus succisis). Die alten Juristen halfen mit ihr auch demjenigen, dem ein Übeltäter Weinreben (vites) abgeschnitten hatte, wobei der Wortlaut der Klage unverändert arbores (Bäume) nannte (Analogie).[13] Typisch für den frühen Formalismus ist es, dass man den Rechtsstreit verlor, falls man nicht das richtige Wort, also arbores, benutzte, obwohl es sich doch tatsächlich um Weinstöcke handelte. Später gab man dann aber analoge Klagen.
116
Um den Gegensatz von verba (objektive Form, reine Wortbedeutung) und voluntas (dahinterstehender, subjektiver Wille) ging es in der causa Curiana, dem berühmten Rechtsstreit des Curius.[14] Ein gewisser M. Coponius verfasste in dem Glauben, dass seine Frau schwanger sei, sein Testament: Wenn mein Kind unmündig stirbt, ist Erbe der M. Curius. Dabei handelte es sich um eine heute gem. § 2064 BGB nicht mehr zulässige sog. Pupillarsubstitution (Einsetzung eines Erben für ein Kind durch den Vater). Coponius starb, und es stellte sich heraus, dass seine Frau gar nicht schwanger war. Der Wortlaut des Testaments berücksichtigte diesen Fall nicht, aber sein Sinn war doch der, dass Curius den Nachlass erben sollte, wenn Coponius keinen eigenen Nachkommen hatte, nicht die gesetzlichen Erben. Im Prozess vertrat Quintus Mucius Scaevola (Rn. 113) die gesetzlichen Erben und verlor mit der von ihm vertretenen Bindung an den Wortlaut gegen den durch den Rhetor L. Licinius Crassus vertretenen Curius. Wir würden heute das Testament ebenfalls nach seinem Sinn zu Gunsten des Curius interpretieren. Der alten Formenstrenge entsprach hingegen die höhere Bedeutung der Form, die Rechtssicherheit gewährleistete. Mit der allgemeinen Entwicklung formfreier Geschäfte, auch unter dem Einfluss der griechischen Philosophie, vermittelt durch die Rhetorik, gewann hingegen der (als innere Tatsache schwieriger zu beweisende) Wille zunehmend an Bedeutung.
4. Rechtsbildung durch die Prätoren, insb. Formularprozess
117
Der weitaus wichtigste Teil der Rechtsfortbildung in der Zeit der Republik wurde durch die Prätoren (Rn. 80) kraft ihrer Amtsgewalt (iurisdictio) bewirkt. Da sie immer nur für ein Jahr in ihr Amt gewählt waren, ließen sie sich sicher auch von rechtskundigen Männern beraten.
Anfangs geschah die Rechtsfortbildung offenbar in der Weise, dass die Prätoren den Richtern Prozesse zur Entscheidung überwiesen, obwohl der Sachverhalt von den in iure vor dem Prätor durch die Parteien aufgesagten Klagformeln (legis actiones) gar nicht gedeckt war, so im Falle der abgeschnittenen Weinreben (Rn. 115).
Dann aber erteilten die Prätoren – wohl zuerst in Verfahren mit Nichtrömern – den Parteien auf Grund des freien Sachvortrags schriftliche Klageformeln (formulae), ohne dass es des Aufsagens einer legis actio bedurfte. Im Rahmen dieser Anweisungen hatte dann der Richter (iudex) den Prozess zu entscheiden. Die lex Aebutia erkannte dieses Formularverfahren Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. dann auch unter römischen Bürgern als ziviles Verfahren an, was die allmähliche Zurückdrängung der Legisaktionen bewirkte. Abgeschafft wurde das ältere Verfahren aber erst unter Augustus (Rn. 140).
Ähnlich wie die Prätoren wirkten die kurulischen Ädile (und in den Provinzen die Statthalter) in ihrem Amtsbereich, also auf dem Markt, wo es um das Kaufrecht ging.
118
Die von den einzelnen Prätoren (oder ihren Mitarbeitern) erfundenen Formeln wurden am Beginn des jeweiligen Amtsjahres als edictum auf weißen Holztafeln (album) publiziert. Dadurch konnte man sich informieren, welche Klagen und Einreden der Prätor anerkannte. Eine lex Cornelia de iurisdictione (67 v. Chr.) stellte klar, dass der Prätor den in seinem Edikt verheißenen Rechtsschutz im Einzelfall nicht verweigern durfte. Weitere Neubildungen waren aber möglich.
Die Nachfolger im Amt übernahmen die bewährten Formeln ihrer Vorgänger in ihr eigenes Edikt (edictum tralaticium, überliefertes Edikt). Auf diese Weise entstand allmählich eine eigene Rechtsmasse, das ius praetorium, also das prätorische oder auch Amtsrecht (ius honorarium):
Papinian Dig. 1, 1, 7, 1:
Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam.
Übersetzung:
Prätorisches Recht ist das, was die Prätoren eingeführt haben, um das Zivilrecht zu unterstützen, zu ergänzen oder zu korrigieren im Interesse des öffentlichen Wohls.
Diese Form der Rechtsfortbildung endete erst in hochklassischer Zeit (Rn. 155). Das prätorische Edikt ist (ebensowenig wie die übrigen Edikte) im Ganzen überliefert. Die moderne Wissenschaft hat versucht, es aus wörtlichen oder sinngemäßen Zitaten in der späteren Rechtsliteratur zu rekonstruieren. Die letzte und anerkanntermaßen beste Rekonstruktion ist die von Otto Lenel.[15]
119
Auch inhaltlich ergab sich das Bedürfnis für die prätorische Rechtsbildung wohl zuerst im Hinblick auf den Rechtsverkehr mit und unter Fremden (peregrini). Das römische Zivilrecht war ja auf römische Bürger und Latini, Inhaber des commercium sowie des connubium (Rn. 42) beschränkt. Fremde hatten zwar grundsätzlich ihr eigenes Heimatrecht. Die Römer gingen jedoch nicht den Weg moderner Rechtsordnungen, die sog. Kollisionsnormen schaffen, um die jeweils anwendbare Rechtsordnung zu bestimmen (sog. internationales Privatrecht, IPR, Rn. 395). Vielmehr entwickelten sie neben dem (alten) ius civile eine Anzahl römischer Rechtssätze, die von den römischen Gerichten auf den Verkehr zunächst zwischen Römern einerseits und Nichtrömern andererseits, bzw. Nichtrömern untereinander, aber schließlich auch zwischen Römern angewendet wurden. Man nennt ihre Gesamtheit das ius gentium (nicht zu verwechseln mit dem modernen Völkerrecht). Außerrömisches Recht haben die Römer nur ausnahmsweise anerkannt, z. B. die chirographa und syngraphae, griechische Schuldurkunden.
120
Besondere Bedeutung haben die aus dem Bereich des ius gentium stammenden Konsensualverträge. Das sind Verträge, die ohne weitere Formerfordernisse allein durch geäußerte Willensübereinstimmung (consensus) zustande kommen. Für uns heute ist der Grundsatz der Formfreiheit eine Selbstverständlichkeit. Er ist jedoch erst das Ergebnis einer sehr langen Entwicklung, die hier ihren Anfang nahm.
Nach römischem Recht gehörten zu den Konsensualverträgen emptio venditio (Kauf), locatio conductio (Rn. 131), societas (Gesellschaft) und mandatum (Auftrag). Im klassischen Recht erscheinen die Konsensualkontrakte dann als Bestandteil des Zivilrechts.
121
Im Sachenrecht tritt die rei vindicatio (dingliche Herausgabeklage) an die Stelle der legis actio sacramento in rem. Ihre Formel lautete:
Titius iudex esto. Si paret fundum Cornelianum (hominem Stichum) qua de re agitur, ex iure Quiritium Auli Agerii esse, neque ea res Aulo Agerio arbitrio iudicis restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato, si non paret, absolvito.
Übersetzung:
Titius soll Richter sein. Wenn es sich herausstellt, dass das Cornelianische Grundstück (der Sklave Stichus), worum es sich handelt, nach quiritischem Recht dem Aulus Agerius gehört, wenn diese Sache nicht dem Aulus Agerius nach dem Schiedsspruch des Richters zurückerstattet wird, wieviel die Angelegenheit (wert) sein wird, zu soviel Geld soll der Richter den Numerius Negidius an A.A. verurteilen. Wenn es sich nicht herausstellt, soll er freisprechen.
Zuerst wurde ein Richter bestimmt, an den die Sache im zweiten Abschnitt des Verfahrens überwiesen wurde. Aulus Agerius (A.A.) war ein Blankettname für den Kläger (wörtlich: der reiche Kläger), Numerius Negidius („der zahlen soll und sich weigert“) einer für den Beklagten. An diese Stellen wurden die Namen der tatsächlichen Prozessbeteiligten eingesetzt. Ebenso wurde das Grundstück oder die begehrte Sache bezeichnet, um die geklagt wurde. Der Richter musste dann aufgrund der vorgelegten Beweise feststellen, ob die Sache tatsächlich dem Kläger gehörte. War dies der Fall, erhielt der Beklagte die Chance, sie an den Kläger herauszugeben. Tat er dies nicht, so kam es zur Verurteilung in Geld, auch im dinglichen Prozess. Konnte der Kläger hingegen sein Eigentum nicht nachweisen, wurde die Klage abgewiesen.
122
Die Verurteilung zu einer Geldzahlung ist der Grundsatz des römischen Zivilprozesses: omnis condemnatio pecuniaria est (jede Verurteilung geht auf Geld). Seinen Ursprung dürfte er in der Ablösung der persönlichen Rache durch Sühneleistungen in Geld haben (Rn. 69). Der Geschädigte bzw. seine Familie durften mit der zunehmenden Verrechtlichung nicht mehr direkt auf die Person des Schädigers zugreifen, sondern erhielten nach einem Gerichtsverfahren (nur) materiellen Ausgleich.
123
Die Vollstreckung setzte eine neuerliche Verurteilung des Beklagten aufgrund der actio iudicati voraus. Neben der Personalvollstreckung (Rn. 60) entwickelte sich die Vermögensvollstreckung (Realexekution), die grundsätzlich als Generalexekution stattfand, also in das gesamte Vermögen ging. Sie wirkte infamierend, d.h. der zahlungsunfähige Beklagte verlor seine Ehre, wurde von allen Ämtern ausgeschlossen und verlor auch die Antragsbefugnis in Prozessen. Mit anderen Worten: er war gesellschaftlich erledigt. Sein Vermögen wurde vom Prätor beschlagnahmt und es erfolgte eine öffentliche Bekanntmachung (proscriptio), durch welche andere Gläubiger aufmerksam gemacht wurden. Sie mussten innerhalb einer kurzen Frist ihre Forderungen anmelden, wollten sie diese nicht verlieren. Concursus creditorum bedeutet wörtlich das Zusammenlaufen der Gläubiger. Daher hat das Konkursrecht (Insolvenzrecht) seine Bezeichnung.
Der erfolgreiche Kläger wurde vorübergehend als Verwalter in dieses Vermögen eingewiesen (missio in bona), was den Verkauf durch Versteigerung ermöglichte. Es wurde jedoch kein fester Kaufpreis gezahlt, sondern derjenige erhielt den Zuschlag, der bereit war, den Gläubigern die höchste Quote zu zahlen.
Die Vollstreckung in einzelne Vermögensgegenstände (Spezialexekution) war zunächst die Ausnahme. Erst nachklassisch entwickelte sie sich zum Regelfall und ist es bis heute. Nur bei Überschuldung (Insolvenz) findet ein Konkursverfahren statt.
124
Im römischen Sachenrecht gab es keinen rechtsgeschäftlichen Erwerb vom Nichtberechtigten kraft guten Glaubens wie heute gemäß §§ 932 ff BGB für bewegliche Sachen und nach § 892 BGB für Grundstücke. Dafür spielte die Ersitzung (usucapio) fremder Sachen eine wesentlich größere Rolle als heute. Wenn jemand eine fremde Sache über eine längere Zeit wie ein Eigentümer hatte, erschien es den Römern sinnvoll, die scheinbare Rechtslage mit der tatsächlichen wieder zusammen zu führen. Unser sofortiger gutgläubiger Erwerb – der den Erwerber stärker schützt, als den (ehemaligen) Eigentümer, der sein Eigentum verliert – stammt hingegen aus dem germanischen oder mittelalterlichen deutschen Recht (Rn. 414).
Die Ersitzung nach römischem Recht dauerte ein Jahr bei beweglichen Sachen (Mobilien) und zwei Jahre bei Grundstücken (Immobilien). Gestohlene Sachen waren von alters her von der Ersitzung ausgenommen. Funktional entspricht dem heute § 935 BGB: auch der gutgläubige Erwerb ist ausgeschlossen, wenn die Sache abhanden gekommen war.
Hatte beispielsweise ein ahnungsloser Käufer vom Nichteigentümer eine Sache gekauft und war daher die Übereignung unwirksam, so musste der Käufer zwar auf die rei vindicatio des Eigentümers (Rn. 121) diesem die Sache heraus geben. Gegenüber Dritten aber schützten die Prätoren den Besitzer während der Ersitzungszeit mit einer besonderen actio Publiciana:
Titius iudex esto. Si quem hominem Aulus Agerius bona fide emit et is ei traditus est, anno possedisset, tum si cum hominem eius ex iure Quiritium esse oportoret, si is homo Aulo Agerio arbitrio iudicis non restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato, si non paret, absolvito.
Übersetzung:
Titius soll Richter sein. Wenn A.A. diesen Sklaven in gutem Glauben gekauft hat und er ihm übergeben worden ist, wenn er ihn ein Jahr besessen hätte (und) dann dieser Sklave nach quiritischem Recht ihm gehören würde, wenn dieser Sklave dem A.A. nach dem Schiedsspruch des Richters nicht zurückerstattet wird, zu soviel Geld soll der Richter den N.N. an A.A. verurteilen. Wenn es sich nicht herausstellt, soll er freisprechen.
Im Laufe der Zeit bildeten sich für diesen Erwerb vom Nichtberechtigten aufgrund von Ersitzung (usucapio) die folgenden Voraussetzungen heraus: res habilis (ersitzbare, d.h. nicht „gestohlene“ Sache), titulus (Rechtsgrund für den Erwerb, z. B. ein Kaufvertrag), fides (guter Glaube), possessio (Besitz). Mit Ablauf des tempus (der Ersitzungszeit) wurde der Erwerber, wenn des commercium teilhaftig, zivilrechtlicher Eigentümer (Eigentümer nach quiritischem Recht).
Ein weiterer Fall der Anwendung der actio Publiciana war der, dass dem Erwerber eine res mancipi (Rn. 67 f) nicht manzipiert, sondern nur formlos übergeben worden war. Auch hier wurde der Erwerber zivilrechtlicher Eigentümer nach Ablauf der Ersitzungszeit. Vorher war er durch die actio Publiciana gegenüber allen Dritten, die ihm die Sache wegnahmen, geschützt. Man spricht hier von prätorischem Eigentum, d.h. nach ius civile war man zwar noch nicht Eigentümer, erhielt aber dennoch Rechtsschutz nach dem Recht der Prätoren.
125
Verlangte der Verkäufer selbst nach formloser Übergabe (traditio) einer res mancipi an den Erwerber die Sache heraus, so gewährte der Prätor dem Erwerber-Käufer eine exceptio rei venditae et traditae (Einrede der verkauften und übergebenen Sache). Mit ihrer Hilfe konnte der Käufer die Klage des Veräußerers, also die rei vindicatio, abwehren, obwohl der Verkäufer nach Zivilrecht noch Eigentümer war und ihm diese Klage theoretisch zustand. Zu einer solchen Konstellation konnte es etwa kommen, wenn der Käufer den Kaufpreis nicht bezahlt hatte und der Verkäufer „seine“ Sache zurück haben wollte. Die Einrede wurde folgendermaßen in die rei vindicatio des Verkäufers eingefügt:
Titius iudex esto. Si paret equum, qua de re agitur, Auli Agerii esse ex iure Quiritium, si non eum equum Aulus Agerius Numerio Negidio vendidit et tradidit, neque ea res Aulo Agerio arbitrio iudicis restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato, si non paret, absolvito.
Übersetzung:
Titius soll Richter sein. Wenn es sich herausstellt, dass das Pferd, worum es sich handelt, dem A.A. nach quiritischem Recht gehört, wenn nicht A.A. dieses Pferd dem N.N. verkauft und übergeben hat, und wenn diese Sache nicht dem A.A. nach dem Schiedsspruch des Richters zurückerstattet wird, wieviel diese Angelegenheit wert sein wird, zu soviel Geld soll der Richter den N.N. an A.A. verurteilen. Wenn es sich nicht herausstellt, soll er freisprechen.
Die exceptio war eine Anweisung an den iudex, den Beklagten unter bestimmten Voraussetzungen nicht zu verurteilen (Ausnahme vom Kondemnationsbefehl).
126
Aufgrund formloser traditio war der Erwerber einer res mancipi nach prätorischem Recht praktisch wie ein ziviler Eigentümer geschützt. Damit wurde die aufwendige, förmliche mancipatio (Rn. 68) bereits in der klassichen Zeit an sich überflüssig, verlor in der Praxis jedenfalls stark an Bedeutung. Trotzdem blieb sie als Rechtsgeschäft noch bis in die spätklassische Zeit hinein üblich, allerdings nur beurkundet, nicht mehr wirklich vollzogen. In dogmatischer Hinsicht wandelte sich mit dem Aufkommen des Konsensualkaufs (Rn. 120) ihre Funktion von der eines formellen Barkaufs, der Grund- und Erfüllungsgeschäft in sich vereinigte, zu der eines abstrakten Übereignungsgeschäfts, das der Erfüllung aller möglicher Grundgeschäfte dienen konnte. Hier liegt eine der Wurzeln unseres sog. Abstraktionsprinzips.
127
Weite Bereiche des zivilen Schuldrechts deckte die actio certae creditae pecuniae (condictio certae creditae pecuniae) ab, die Kondiktion (Rn. 56) im Formularverfahren, wörtlich: Klage auf einen bestimmten „kreditierten“ Geldbetrag (creditum von credere = anvertrauen, glauben):
Titius iudex esto. Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere, iudex Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia condemnato, si non paret, absolvito.
Übersetzung:
Titius soll Richter sein. Wenn es sich herausstellt, dass Numerius Negidius dem Aulus Agerius 10 000 Sesterzen (aufgrund des römischen Zivilrechts) geben muss, soll der Richter den N.N. an A.A. zu 10 000 Sesterzen verurteilen. Wenn es sich nicht herausstellt, soll er freisprechen.
Dare oportere als Verpflichtung des Beklagten ist ein technisch zu verstehender Ausdruck für das Schulden aus einem zivilrechtlichen Grunde, insbesondere aus Schuldversprechen (stipulatio, Rn. 72), Darlehen (mutuum) oder Übereignung (datio) ohne Rechtsgrund. Auch aus Verbrauch (consumptio) einer fremden Sache – die der ehemalige Eigentümer ja nun nicht mehr mit der rei vindicatio (Rn. 121) heraus verlangen konnte – stand ihm stattdessen die condictio zu (vgl. Rn. 379 f).
Die Anfänge einer Haftung wegen ungerechtfertigter Bereicherung gehen weit in die Zeit der uneingeschränkten Herrschaft des Legisaktionenprozesses (Rn. 56 ff) zurück. Allerdings ging diese Klage nicht wie heute, § 818 III BGB – auf die Herausgabe der noch vorhandenen Bereicherung, sondern grundsätzlich auf das Erlangte.[16] Einzelheiten sind nicht überliefert, aber der Ausgangstatbestand war wohl der, dass jemand quiritisches Eigentum ohne einen rechtfertigenden Grund erlangte. Durch datio erfolgte also eine wirksame, aber hinsichtlich des Behaltendürfens rechtsgrundlose Übereignung. Der Erwerber war dann auf Grund der legis actio per condictionem – kurz condictio – zur Rückerstattung gehalten.
Der Darlehensnehmer hingegen hatte nur einen zeitlich begrenzten Grund, das ihm übereignete Geld zu behalten, und war nach Ablauf der Darlehensfrist ebenfalls mit der condictio in Anspruch zu nehmen. Das mutuum ist im Übrigen ein sog. Realkontrakt, also ein Vertrag, für dessen wirksame Bindung die Hingabe einer Sache (res) nötig war. Als weitere Realverträge nennen die nachklassischen Quellen[17] commodatum (Leihe), depositum (Verwahrung) und pignus (Verpfändung). Die ebenfalls mit condictio klagbare Stipulation (vgl. auch Rn. 72) eines bestimmten Leistungsgegenstandes (certum) hingegen war ein Verbalvertrag, weil sie durch Worte (verba) zustande kam.
Das Besondere an der condictio ist nun ihre Abstraktheit, d.h. sie nennt – anders als alle anderen zivilrechtlichen Klagen – den ihr zugrunde liegenden konkreten Grund nicht. Der Richter musste die möglichen zivilrechtlichen Schuldgründe kennen, um über den Vortrag bzw. Beweis der Parteien entscheiden zu können. Die Klage enthielt auch – anders als beispielsweise die Klage aus Kauf (Rn. 131) – keinen Hinweis darauf, dass der Richter bei seiner Entscheidung das Prinzip von Treu und Glauben (heute § 242 BGB) beachten sollte. In das ursprünglich so strenge, formale, römische Recht ist dieses generelle Prinzip erst verhältnismäßig spät aufgenommen worden.
128
Cicero berichtet anschaulich anhand eines praktischen Falles, sein Kollege C. Aquilius Gallus (wohl als Prätor im Gerichtshof gegen Wahlbestechungen) habe die doli formulae (Formeln wegen Arglist) aufgebracht.[18] Dazu ist die exceptio doli (Einrede der Arglist) zu zählen, hier eingefügt in eine actio certae creditae pecuniae:
Titius iudex esto. Si paret N.N. A.A. sestertium decem milia dare oportere, si in ea res nihil dolo malo Auli Agerii factum sit neque fiat, iudex N.N. A.A. sestertium decem milia condemnato, si non paret, absolvito.
Übersetzung:
Titius soll Richter sein. Wenn es sich herausstellt, dass N.N. dem A.A. 10 000 Sesterzen geben muss, wenn in dieser Angelegenheit nichts auf Grund böser List des A.A. geschehen ist oder geschieht, soll der Richter N.N. zur Zahlung von 10000 Sesterzen an A.A. verurteilen. Wenn es sich nicht herausstellt, soll er freisprechen.
Eine Einrede – deren Voraussetzungen nicht vorliegen dürfen, damit die Klage erfolgreich ist – wurde vom Prätor im konkreten Einzelfall zum Schutz des Beklagten (vor einer ungerechten Verurteilung) in die Formel eingefügt. Hatte also beispielsweise der klagende Agerius den beklagten Negidius durch Täuschung zur Abgabe einer Stipulation veranlasst oder klagte er, obwohl der Stipulation ein Rechtsgrund fehlt, so wies der iudex (Richter im zweiten Verfahrensabschnitt, Rn. 55) die Klage ab.