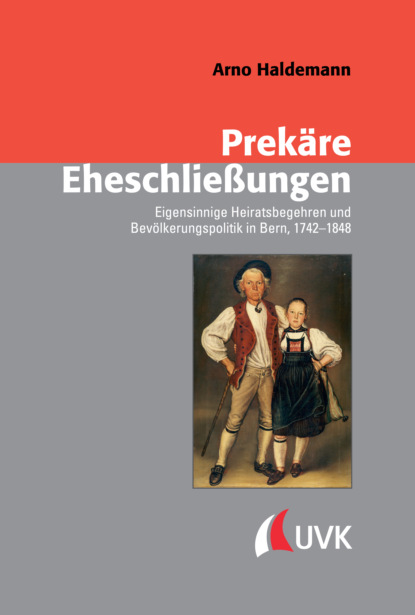- -
- 100%
- +
„nicht nur gutfunden, diss-örthige ehemalige Satzungen für die Hand zu nemmen und mit Fleiß zu durchgehen, sondern in eint- und anderem, gestalten Dingen nach, auf gegenwärtige Zeiten und Läuff selbe einzurichten, zu verbessern und in fernerem hiemit anzuordnen […].”9
In der Folge ist es interessant zu untersuchen, mit welcher bevölkerungspolitischen Intention die Berner Regenten die Chorgerichtssatzung von 1743 revidierten, um die abgenutzte Ordnung in ihrer ehemaligen Wirkung wiederherzustellen. Während die Berner Magistrate mit den christlichen Mandaten von 1628 im 17. Jahrhundert und in der Folge kontinuierlich mit weiteren Verordnungen und Gesetzen mittels Normierung der Eheschließung auf Armutsphänomene zu reagieren begannen, erreichten die Gemeinden mit der „lands-vätterliche[n]“10 Ehegesetzordnung von 1743, dass sie unabhängig vom Alter alle Almosenbezüger-Innen und Menschen mit körperlichen Gebrechen mittels Zugrecht von der Ehe und damit von der ‚reinen‘ Sexualität ausschließen konnten. Das Zugrecht war „ein Vetorecht“, das ursprünglich den Eltern oder, im Fall von deren Tod oder Unmündigkeit, nahen Verwandten oder Vögten minderjähriger Kinder zukam, wenn sie Einwände gegen deren Eheaspirationen hatten.11 Dieses Recht wurde nun in bestimmten Fällen auf Gemeinden und Korporationen ausgedehnt: Gemeindeangehörige, die zu heiraten wünschten, konnten jetzt von diesen, sogar über die Volljährigkeit hinaus, daran gehindert werden, wenn sie von ihren Korporationen oder Gemeinden Unterstützungsleistungen bezogen oder in der Vergangenheit erhalten, aber nicht zurückbezahlt hatten.12 Die entsprechenden Neuerungen fanden unter dem Titel „Artickel und Sazungen, die Ehe betreffend“ unter dem dritten Absatz Eingang in das schriftlich verbriefte Ehegesetz von Bern. AlmosenempfängerInnen und Menschen mit leiblichen Gebrechen, denen nicht zugetraut wurde, sich und allfälligen Nachwuchs zu versorgen, konnten fortan über das 25. Lebensjahr hinaus an der Eheschließung gehindert werden.13 Faktisch wurde damit ein Ehehindernis errichtet und im Gesetzestext verankert, das arme Personen und Menschen mit körperlichen Gebrechen komplett von der Reinheitsordnung ausschloss. Die Sexualität dieser Menschen wurde per se diskreditiert, indem sie das Gesetz als ‚leichtsinnig‘ verurteilte.14 Das stellte die bisher schärfste gesetzgeberische Restriktion von Armenehen in der bernischen Ehegesetzgebung dar. Sie reihte sich in jene Entwicklung „intensivierter Kontrolle von Sexualität“ ein, die mit der starken Bevölkerungszunahme und der zunehmenden sozialen Polarisierung einherging, die Joachim Eibach für das 18. Jahrhundert aus kriminalitätshistorischer Perspektive thematisiert hat.15
In Bezug auf die frühneuzeitliche Ehegesetzgebung in Bern von der Reformation bis 1824 kann von einer beachtlichen Beständigkeit gesprochen werden. An den Prinzipien der Ehedefinition, der konstitutiven Merkmale und Anforderungen, der Rolle der Kirche und der Scheidung änderte sich im Verlauf der Frühen Neuzeit relativ wenig. Offensichtlich genügten diese dem Zweck der Herrschaftssicherung nach wie vor. Hingegen fanden im Ehehindernis für besteuerte Armengenössige bevölkerungspolitische Neuerungen Niederschlag, die der Idee aufgeklärter Staatsräson folgten und das biblische Recht auf Ehe für AlmosenempfängerInnen drastisch einschränkten.16 Die Ausdehnung des patriarchalen Zugrechts auf Gemeinden und Korporationen hatte ganz offensichtlich nicht mehr viel mit reformiert-religiösen Vorstellungen vom Menschen zu tun, der sich nicht für die vollständige sexuelle Abstinenz, das Zölibat, eignete. Durch den Ausschluss armer Bevölkerungsgruppen von der Ehe hatte man seitens der Räte und Burger im Geist reformierter Anthropologie sehr sündenbewusst uneheliche Kinder, illegitime sexuelle Beziehungen und Lebensformen in Kauf genommen. Nun wuchs aber die Angst vor dem Verlust ständischer Privilegien, insbesondere in Anbetracht der Vermehrung subalterner Schichten, dermaßen an, dass man sie kurzerhand von der reinen Gesellschaft prinzipiell ausschloss.17 Dadurch wurden diese Schichten eherechtlich prekarisiert und in der Konsequenz sexuell diskriminiert: Diese zahlenmäßig große Gesellschaftsgruppe wurde somit rechtlich verunsichert, materiell noch verletzlicher gemacht und sexuell tendenziell inkriminiert.18 Die Beobachtungen von Eibach in Bezug auf den markanten Anstieg von Sexual- und Eigentumsdelikten im 18. Jahrhundert erhärten diese These.19
Die gesetzliche Normierung entwarf die reine Ordnung in der Folge in zunehmendem Ausmaß als eine immer exklusivere Gesellschaft. Außerdem war mit der Säkularisierung im Zuge der Aufklärung die Furcht vor göttlicher Kollektivstrafe gesunken, was die Bedeutung der gesamtgesellschaftlichen Reinheit aus theo-logischer Perspektive reduziert erscheinen ließ. Gleichzeitig nahm die ökonomistische Furcht vor materieller Armut und dem Zerfall des diesseitigen Wohlstands zu. Im 18. Jahrhundert wurden transzendentale Heilsvorstellungen von einer ökonomistischen Sichtweise abgelöst, die moralisch-sozialpolitisch auf diesseitige Güter fokussierte.20 Der religiöse Wert der moralischen Reinheit war einer utilitaristischen Konnotation der Reinheit gewichen, die Armut und Unreinheit miteinander verschränkte. In dieser Verquickung wurde die Reinheit mit Hygiene in Zusammenhang gebracht, wenn es hieß, dass die außereheliche Sexualität, „die verderblichsten Krankheiten nach sich zieh[e]“.21 Sexuelle und damit moralische Unversehrtheit wurden in Bern Mitte des 18. Jahrhunderts quasi als schriftlich fixiertes Privileg der besitzenden Klasse im gedruckten Ehegesetz manifestiert. Dadurch wurde sie unverhohlen als ein ökonomisches Vorrecht kodifiziert. Der von Daniel Schläppi bezüglich des Armenwesens von Bern konstatierte „Sog der Ökonomisierung“ im Verlauf des 18. Jahrhunderts offenbarte sich ebenso in der Ehegesetzgebung der Berner Obrigkeit: Er zeigte sich auch hier „in effizienterem und sparsamerem Umgang mit den vorhandenen Ressourcen“ und „beeinträchtigte [ebenfalls] das integrative Potential“ des Ehegesetzes.22
1.2 Entvölkerungsdebatte, Volkszählung und Populationismus: Berner Biopolitik
In Widerspruch zum zunehmenden gesetzlichen Ausschluss der besitzlosen Bevölkerungsschichten von der Ehe im Zuge einer allgemeinen Ökonomisierung des 18. Jahrhunderts stieg in derselben Zeit in Europa das Interesse an Fragen der korrekten Bevölkerungspolitik zur Steuerung der Gesellschaftsgröße.1 Die bevölkerungspolitischen Debatten, und als deren Gegenstand die Eheschließung, wurden zu Beginn der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – im Gegensatz zur oben skizzierten manifesten Gesetzgebung – in der entstehenden Öffentlichkeit vor allem vom sogenannten ‚Populationismus‘ geprägt.2
Dieser forderte in seinen Grundzügen das Gegenteil der Ehegesetzgebung, weil er davon ausging, dass eine florierende (Land-)Wirtschaft von der Verfügbarkeit humaner Ressourcen abhängig sei. Da im 17. und 18. Jahrhundert territoriale Macht und herrschaftlicher Einfluss in starker Abhängigkeit von der Größe der Armee gesehen wurden und dazu Menschen (Soldaten) und Kapital (Steuerzahler) erforderlich waren, ging es darum, das eigene Territorium sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus militärischen Gründen zu bevölkern: Die Wirtschaft, die das Heer finanzierte, brauchte Arbeitskräfte und sollte potente Steuerzahler generieren. Das Militär benötigte möglichst viele Soldaten. „Comme cet axiome est certain que le nombre des peuples fait la richesse des États“, wird Friedrich der Große, der als idealtypischer und mächtiger Verfechter des Populationismus betrachtet werden darf, aus seiner Geschichte des Siebenjährigen Krieges zitiert.3 Dabei war der preußische Herrscher durch Johann Peter Süßmilchs Werk Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts informiert. Die Schrift des brandenburgischen Pfarrers erschien 1741 und wurde in den 1760er Jahren in überarbeiteter Version neu aufgelegt. Sie ging im Grundsatz davon aus, dass die Bevölkerungsentwicklung einer göttlichen Ordnung folgte. Damit lagen ihr die Prämissen der sogenannten ‚natürlichen Theologie‘ zugrunde, in der Natur das Wirken Gottes zu verorten. Süßmilch übte mit seinem Werk großen Einfluss auf den zeitgenössischen bevölkerungspolitischen Diskurs aus.4
In der populationistischen Auffassung sollte sich die Bevölkerung also vermehren, weil sie das Fundament eines wirtschaftlich florierenden und militärisch schlagkräftigen Staates bildete. Sie stellte das Steuersubstrat des werdenden Staates dar und sollte daher wachsen. Wirtschaftspolitik und Machtpolitik wurden somit in der Bevölkerungspolitik verschränkt.5 Ökonomie und Demographie standen in unzertrennlicher Wechselwirkung zueinander. Diese Wechselwirkung determinierte die Macht und den Wohlstand eines Staates. Sie musste daher erfolgreich gesteuert werden, um die „Glückseligkeit“ in utilitaristischer Weise zu maximieren.6
Für Berns Bevölkerungspolitik im 18. Jahrhundert wurde bereits auf die herrschende Ambivalenz von „pronatalistischen Massnahmen im medizinisch-ökonomischen Bereich und von antinatalistischen Massnahmen im sozialen Bereich“ in den zeitgenössischen bevölkerungspolitischen Handlungslogiken aufmerksam gemacht.7 Bern litt im 18. Jahrhundert, wie auch andere Teile Europas, unter einer länger anhaltenden stagnierenden Bevölkerungsentwicklung.8 Deswegen wurden auf der einen Seite verschiedene ‚gesundheitspoliceyliche‘ Anstrengungen unternommen und Maßnahmen ergriffen, die auch in anderen Territorien Anwendung fanden, um das Wachstum zu fördern: Die Regierungen versuchten, die epidemiebedingte Sterblichkeit zurückzudrängen, indem sie Anleitungen zu Therapien und Hygieneanweisungen verbreiteten. Bern gründete 1778 eine Hebammenschule. Die professionalisierte Ausbildung der Geburtshelferinnen trug dazu bei, die Kindersterblichkeit und die Geburtsrisiken für die Mütter zu reduzieren. Gleichzeitig unternahm die Obrigkeit verschiedene Anstrengungen, der Kontrazeption und der nachgeburtlichen Geburtenkontrolle konsequent vorzubeugen. Den Versorgungsengpässen in Krisensituationen versuchte man durch das Anlegen und Bewirtschaften von Vorräten in zunehmendem Maß Herr zu werden. Gleichzeitig wurde aber auf der anderen Seite „ein rechtliches Instrumentarium gegen die unerwünschte Eheschliessung in den Unterschichten aufgebaut“, das in der Umsetzung auch „zunehmend griffiger ausgestaltet“ wurde.9 Darin konkretisiert sich für Bern exakt jene janusköpfige Entwicklung, die auch Foucault für den ungefähr gleichen Zeitraum in der Veränderung der gouvernementalen Logik im Allgemeinen beobachtet hat.10 Er hat sie als Changieren zwischen „verschiedenen Bedeutungspolen“ politischer Ökonomien charakterisiert.11 Auch Isabel V. Hull hat – für den deutschen Raum – im Übergang von der Stände- zur bürgerlichen Gesellschaft auf den Widerspruch zwischen moralischen Schriften und polizeiwissenschaftlichen Administrationsbemühungen hingewiesen.12
Im Ehegesetz fanden in dieser widersprüchlichen bevölkerungspolitischen Atmosphäre zwischen utilitaristisch geprägtem Populationismus und der Wahrung ständischer Partikularinteressen neue, zunehmend an Besitz gebundene Eheprivilegien Eingang. Dagegen beschäftigten sich die Reformer in der bevölkerungspolitischen Debatte mit der Frage, wie man Berns Agrarwirtschaft modernisieren und die Landschaft zur Beförderung des Handwerks und der Manufakturen stärker bevölkern könnte, um Wohlstand und Glück auszuweiten und stärker zu verbreiten. Einerseits hielt die Berner Obrigkeit im gedruckten Gesetz also an der ständischen Privilegienordnung fest. Andererseits regte die Oekonomische Gesellschaft Diskussionen an, in denen Gelehrte fortschrittsoptimistisch und auf die Zukunft ausgerichtet darüber debattierten, wie eine prosperierende Gesamtwirtschaft zu schaffen sei. Darin zeigt sich, wie für kurze Zeit zwei verschiedene Formen der Gouvernementalität nebeneinander existierten13 – was, wie noch zu zeigen sein wird, in der Gerichtspraxis Widersprüche und Konkurrenz zwischen gegensätzlichen Urteilslogiken produzierte.
In der europäischen gelehrten Öffentlichkeit grassierte seit den 1740er Jahren, entsprechend der populationistischen Diskussion, die spezifische Angst vor dem ökonomisch und militärisch bedrohlichen Szenario der Entvölkerung.14 Der befürchtete Rückgang der Bevölkerung nährte die Angst vor rückläufigen Soldatenzahlen,15 schwindenden Steuereinnahmen und mangelnder agrarischer Produktion zur Versorgung der Bevölkerung. In Bern wurde die Angst vor der Entvölkerung der ländlichen Gegenden anfangs der 1760er Jahre zusätzlich geschürt: Regierungsagenten, die in der Waadt Handwerker rekrutieren wollten, berichteten über die Entvölkerung ganzer Gegenden und untermauerten mit ihren Meldungen die entsprechenden Befürchtungen der Regierung.16 Realhistorisch dürfte diese Furcht vor der Entvölkerung, die auf der Grundlage heutiger Datenreihen haltlos erscheint, vor allem durch die Erfahrung der Epidemie der Roten Ruhr genährt worden sein. Sie hatte im Spätsommer 1750 5% der bernischen Bevölkerung dahingerafft und kam damit in ihren demographischen Auswirkungen einem Pestzug gleich. Betroffen waren davon vor allem Kinder und Jugendliche. Als die betroffenen Jahrgänge in den Arbeitsprozess eintreten sollten, machte sich der Mangel an Arbeitskräften bemerkbar.17 Außerdem schlug sich die demographische Entwicklung zu Zeiten des Siebenjährigen Kriegs im militärisch bedrohlichen Szenario einer sich verschärfenden Abnahme der Rekrutenzahlen in den Mannschaftsrödeln der Berner Herrschaften nieder.18 Aufgrund dieser Erfahrungen lässt sich die zeitgenössische öffentliche Meinung relativ schlüssig erklären, obwohl Bern nach der Epidemie bis 1770 ein nachholendes und danach ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum aufwies.19
Die Furcht vor der ‚Depopulation‘, die auch unter Gelehrten kursierte, weckte und beförderte das obrigkeitliche Interesse an der statistischen Erfassung der Bevölkerung. Die gute Herrschaft musste wissen, wie es um ihre Bevölkerung und somit ihre Steuereinnahmen und militärische Stärke stand.20 Deswegen wollten die Berner Magistraten „den Zustand der Ungewissheit in diesem sicherheitspolitisch sensiblen Bereich überwinden, das Phänomen intellektuell unter Kontrolle bringen und damit einer Bewältigung durch Massnahmen zugänglich machen“.21 Folglich wurden in diesem politischen Klima in Bern erste statistische Techniken zur Erhebung demographischer Daten wie Geburtenzahlen, Todesraten und Eheschließungsziffern übernommen, angewendet und entwickelt. Diese Entwicklung trug sich an verschiedenen Orten in Europa zeitgleich zu. Die Datenerhebungen und die damit gewonnenen Zahlen erhielten im hier beschriebenen Zeitraum eine ganz neue Bedeutung. Sie wurden zum Schlüssel der „Realitätserfassung“,22 mutierten zur Grundlage für politische Entscheidungen schlechthin und wurden zum Ausgangspunkt obrigkeitlicher Planungen. Demographische und ökonomische Daten, die sich in Ziffern ausdrückten, wurden zum mächtigen Mittel der Rechtfertigung in der politischen Entscheidungsfindung.23 Sie sollten fortan als rechnerische Grundlage für die gesamte weitere Planung und Umsetzung staatlicher Bevölkerungspolitik figurieren.24 Empirie und Rationalität sollten die grundlegenden Prinzipien sämtlicher politischer Reformen werden. Die erhobenen Daten zur Bevölkerung wurden zu Faktoren der Regulierung und somit Dimensionen der Macht, weshalb sie von den Obrigkeiten meistens für ein sicherheitspolitisches Risiko erachtet und geheim gehalten wurden. Verfolgt wurde das Ziel, die Leistungsfähigkeit des Staates auf sämtlichen Ebenen zu steigern. So sollten Macht und Souveränität gegen innen und außen befördert werden.25 Bevölkerung und Wirtschaft wurden in ihrer Verbindung als Gegenstand und legitimatorisches Prinzip der Regierung entdeckt.26
In diesem Licht muss auch die Volkszählung der Berner Regierung von 1764 betrachtet werden. Im Sommer dieses Jahres wurden sämtliche Pfarrer Berns von der Almosen-Revisions-Kommission aufgefordert, zwecks Datenerhebung von der Regierung zugestellte Fragebögen auszufüllen.27 Die Fragebögen umfassten unter anderem die Bezifferung der Taufen, der Todesfälle und der Eheschließungen. Aus rein statistischer Sicht hätten die erhobenen Daten die Angst vor einer drohenden Entvölkerung mildern können, da sie keine Anhaltspunkte für eine Entvölkerung lieferten.28 Dennoch ebbte die Furcht vor dem Bevölkerungsschwund keineswegs ab. Sie war größer als das Vertrauen in die Zahlen. Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und der Staatsräson publizierte der Rat, der, trotz der gewonnenen Daten, Herrschaftskritik befürchtete, die Resultate der Zählung nicht. Dadurch ließ Berns paternalistische Regierung – aus heutiger Sicht – quasi die Chance aus, die grassierende Befürchtung einer Verkleinerung der Bevölkerung zu entkräften.29
Die Oekonomische Gesellschaft von Bern und die Furcht vor der Entvölkerung
Ganz im reformabsolutistischen Geist stand auch das Programm der Oekonomischen Gesellschaft von Bern. Sie wurde im Jahr 1759 in Reaktion auf eine Missernte und die allgemein missliche Versorgungslage aufgrund des Siebenjährigen Kriegs im umliegenden Europa von Johann Rudolf Tschiffeli gegründet. Es war auch die Oekonomische Gesellschaft, die über ihre zahlreichen personellen Querverbindungen mit den Berner Räten die Volkszählung angeregt hatte und dadurch zu deren Durchführung beitrug.1 Das tat sie auf drei Wegen: erstens mit der Ausschreibung ihrer Preisfragen und den Veröffentlichungen der Preisschriften, die das Thema publik machten. Zweitens trugen Mitglieder der Gesellschaft in ihrer Funktion als Ratsherren die Diskussion mittels Vorstößen in den Großen Rat. Und drittens saßen Exponenten der Sozietät in der Almosen-Revisions-Kommission, also in genau jenem Gremium, das die Volkszählung umsetzte.2
Die Sozietät bildete in den folgenden Jahren das eidgenössische Zentrum des zeitgenössischen bevölkerungspolitischen Interesses: Sie wusste herausragende Denker ihrer Zeit in den eigenen Reihen – z. B. Albrecht von Haller, Niklaus Emmanuel Tscharner und Samuel Engel – und zählte namhafte Männer wie Hans Caspar Hirzel, Isaak Iselin, Carl von Linné, Honoré Gabriel de Riqueti, Comte de Mirabeau und Voltaire zu ihrem korrespondierenden Netzwerk.3 Damit wirkte sie über die Eidgenossenschaft hinaus. Das umfassende Reformprogramm der Sozietät sollte „‚die Lebenssäfte des Landes‘ in Gang setzen und ’dem schmachtenden Körper Nahrung, Gesundheit, Stärke und Wohlstand’ bringen“.4 Anfänglich standen die agrarwirtschaftlichen Reformbestrebungen ganz deutlich im Mittelpunkt der öffentlich ausgeschriebenen Preisfragen und damit im Zentrum des Reforminteresses. So ergänzten sie das merkantilistisch gefärbte Vorgehen des bernischen Kommerzienrats, der mittels Förderung der lokalen Heimindustrien versuchte, eine aktive Handelsbilanz zu erwirken.5 Seit den 1760er Jahren kamen vermehrt auch Zuschriften hinzu, die sich dezidiert bevölkerungspolitischen Fragen stellten, und als sich kameralistische und physiokratische Überlegungen zur Wirtschaft in spezifischer Weise zu überlagern begannen.6 Außerdem wurde in diesen Zuschriften auch die Forderung nach einem neuen, auf Gegenseitigkeit beruhenden Beziehungsverhältnis zwischen Regierung und Regierten, beziehungsweise zwischen dem sich ausbildenden modernen Staat und der Bevölkerung, laut.7
Praktisch zeitgleich mit der erwähnten Bevölkerungszählung schrieb die Gesellschaft 1764 eine Preisfrage aus. Diese forderte als Antwort einen umfassenden Bericht zum Zustand der Bevölkerung des gesamten Territoriums von Bern oder eines einzelnen Bezirks. In der Vorrede zu den publizierten Abhandlungen und Beobachtungen kam Vinzenz Bernhard Tscharner, der Präsident der Gesellschaft, auf die Entvölkerung zu sprechen. Sie war seinen Aussagen zufolge im ganzen Land beträchtlich, aber an einigen Orten stärker ausgeprägt als an anderen. Bisher wäre der Bevölkerungsrückgang aber zu wenig analysiert und berechnet worden und die Bemühungen zu dessen Verhinderung zu spärlich ausgefallen. Der Staatsräson verpflichtet, gab er in populationistischem Geist zu Protokoll:
„Ohne von diesem ersten grundgeseze aller bürgerlichen gesellschaften zu reden, daß nemlich ihre verfassung abzielen soll, so eine grosse anzahl von menschen, als immer nach den phisischen umständen des landes möglich ist, glüklich zu machen; wenn man das volk auch blosserdingen als das erste werkzeug der macht und stärke eines Staates betrachten will; so darf die erhaltung und vermehrung der einwohner nicht ohne schwächung desselben verabsäumet werden. Wir wünschten, daß das nachdenken über diese materie zu der entdekung sichrer und geschikter mittel, oder starker und dennoch der freyheit unnachtheiliger beweggründe führen möchte, diesem ausreissen so vieler unterthanen der Republik zu steuren, die der betrugliche reiz der fremden kriegsdienste, ein leichtgläubiger ehrgeiz, oder die blinde hofnung sich zu bereichern, täglich dem vaterlande entziehn.“8
Die von Tscharner hergestellten Beziehungen zwischen Bevölkerungsvermehrung, Wirtschaft und Glück sind nicht zu überlesen. Dabei kam der Vermehrung der Bevölkerung eine Vorrangstellung als ‚erstes Werkzeug der Macht und Stärke‘ des Staates zu. Um diese Ressource hatte sich der Staat zu kümmern. Damit wurde ihre – statistisch erfasste – Größe zum Maßstab für die Qualität der Regierungstätigkeit. Die Regierung musste Sorge um ihre Bevölkerung tragen. Dadurch trat sie in ein neues Beziehungsverhältnis zu ihren Untertanen. Diese Beziehung bestand fortan tendenziell nicht mehr darin, den Gehorsam der Untertanen per Disziplinierung und mittels effizienter Vollstreckung von Gesetzen einzufordern, sicherzustellen und im Gegenzug Schutz und Schirm zu gewähren. Vielmehr ging es jetzt darum, die Bevölkerung zu hegen und zu pflegen, sich mit ‚policeylichen‘ Maßnahmen um die Gesundheit und die Fruchtbarkeit des Volkskörpers zu kümmern, sodass dieser gedeihen konnte. Im Gegenzug verlangte der moderne Staat in statu nascendi quasi als Bezahlung Loyalität in Form von patriotischer Liebe und steigenden fiskalischen Einnahmen.9 Es ist hier für Bern die Geburtsstunde jener Politik zu beobachten, deren Technologie in der Regierung der Bevölkerung besteht und von Foucault mit dem Begriff ‚Biopolitik‘ bezeichnet worden ist10.
Mit ihren ausgeschriebenen Preisfragen thematisierte die Sozietät die Bevölkerungspolitik im Berner Kontext folglich explizit und öffentlich. Dadurch ergaben sich gleichzeitig zwei Gelegenheiten für die gelehrten Eliten, die zum Teil durchaus in einem Unterordnungsverhältnis zur aristokratischen Regierung der Stadtrepublik standen: Sie konnten in den Zuschriften ihre Meinungen und Einschätzungen zu vormals und eigentlich nach wie vor geheimen Staatsangelegenheiten öffentlich formulieren. Durch die Publikation dieser Ansichten flossen außerdem neuartige Informationen, insbesondere an gebildete Untertanen, was wiederum bei diesen eine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik zuließ.11 Für die vorliegende Studie sind einige Einsendungen auf die Preisfrage besonders interessant, weil sie sich explizit mit der Frage der richtigen obrigkeitlichen Ehepolitik auseinandersetzten. Diese Schriften fokussierten exakt jenen biopolitischen „Kreuzungspunkt von ‚Körper‘ und ‚Bevölkerung‘“, den Foucault „zur zentralen Zielscheibe für eine Macht“ erklärt hat, „deren Organisation […] auf der Verwaltung des Lebens […] beruht“.12 Es sind dies in chronologischer Reihenfolge die Schriften von Benjamin Samuel Carrard (1765), Jean Bertrand (1765), Abraham Pagan (1765), Jean Louis Muret (1766) und Charles-Louis Loys de Cheseaux (1766). Sie offenbaren die Diskrepanz zwischen der bevölkerungspolitischen Debatte, die „eine grosse Bevölkerung als Massstab der Glückseligkeit unter allen Umständen“ propagierte, und dem rigiden Berner Ehegesetz.13 Hier deutet sich bereits an, in welchem gouvernemental induzierten Dilemma sich die Eherichter mit ihren Urteilen über weite Strecken des Untersuchungszeitraums befanden.
Die publizierte Zuschrift, die sich am weitläufigsten mit der Eheschließung als Mittel zur Verhinderung der Entvölkerung der Landschaft auseinandersetzte, war jene aus der Feder des Theologen Benjamin Samuel Carrard. Sie verdient hier besondere Beachtung. Der Waadtländer hatte, sehr wahrscheinlich aufgrund der herrschenden kirchlichen Orthodoxie in Bern, auf eine Laufbahn als Pfarrer verzichtet und gehörte somit potenziell zu einer eher herrschaftskritischen Bildungselite in der Berner Landschaft. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung amtete er als Pfarrhelfer in Orbe, einer Gemeinde in der Waadt.14 Für seine Schrift, die das Accessit für die Publikation erhielt,15 wurde er mit einer silbernen Denkmünze ausgezeichnet.16 Dies bedeutet, dass er mit seinen publizierten, kritischen Überlegungen zumindest im genannten halböffentlichen Raum der gelehrten Elite einige Aufmerksamkeit erregte. In seiner Zusendung an die Oekonomische Gesellschaft reflektierte er den Charakter der Gesetzgebung, die eine Regierung zu erlassen hätte, um Wohlstand und Glück in der Bevölkerung zu steigern, also Fortschritt zu generieren. Die Schrift umfasste zwei Teile, die jene für das damalige Bern typische Mischung aus merkantilistischer und physiokratischer Wirtschaftspolitik widerspiegelten:17 Der erste Teil konzentrierte sich auf die Möglichkeiten der Steigerung der agrarischen Ressourcen im Ackerbau und die gesetzlichen Maßnahmen, die dafür in physiokratischer Gesinnung in die Wege geleitet werden mussten. Voraussetzung für einen florierenden Staat stellte ihm zufolge eine intakte Landwirtschaft dar. Sie erforderte die Umsetzung einer Reihe paternalistischer Reformen, damit die landwirtschaftlichen Erträge bereits vor dem Einsetzen des Bevölkerungswachstums gesteigert werden konnten. Die Fortsetzungsschrift widmete sich der populationistischen Herausforderung, das Bevölkerungswachstum anzukurbeln. Denn dieses bildete für den Autor die Grundlage eines prosperierenden Gewerbes und eines mächtigen Staats.18 Dabei spielte für den Landgeistlichen die Heiratspolitik eine zentrale Rolle: „Eine kluge politic wird also erfordern, die heyrathen zu begünstigen, und ihre fruchtbarkeit aufzumuntern, um soviel mehr, als es zugleich das sicherste mittel ist, die Bevölkerung zu befördern“, lautete sein vorweggenommenes Fazit.19