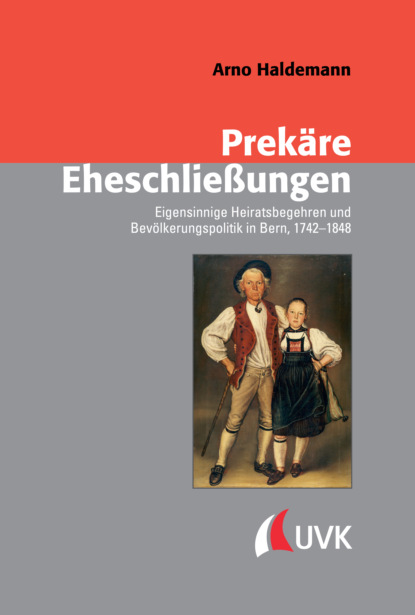- -
- 100%
- +
Zuvorderst unternahm der Theologe den Versuch, in aufklärerischer Manier zu beweisen, wieso die Ehe die populationistisch gesehen ‚nützlichste‘ Institution der Fortpflanzung sei. Als Anhänger der sogenannten ‚natürlichen Theologie‘, gewissermaßen des aufgeklärten Flügels der zeitgenössischen Theologie, verwies er dabei unablässig auf den Sinn und die ‚Nützlichkeit‘ der göttlichen Ordnung. Sie befand sich in seinen Augen in vollkommener Harmonie mit Natur und Vernunft.20 Außerhalb dieser natürlichen Ordnung waren, seiner Auffassung nach, die Frauen wesentlich weniger fruchtbar, wodurch das potentielle Wachstum der Bevölkerung nicht ausgeschöpft werden konnte.21 Die Ehe war seiner Meinung nach auch das probateste Mittel zur Reduktion der Kindersterblichkeit. Nur Kinder aus ehelichen Verhältnissen erfuhren „die ganze sorgfalt eines vaters und einer mutter“ und hatten deshalb bessere Überlebenschancen.22 Die erzieherische Vernachlässigung der Kinder hatte aber nicht nur Konsequenzen für deren Gesundheit und Sterblichkeit, sondern ließ sie in aufklärungspädagogischer Sichtweise auch zu „schlechte[n] glieder[n] der gesellschaft“ werden.23
Dem utilitaristischen Beweis der Nützlichkeit der ehelichen Ordnung folgte ein Plan zu deren Ausweitung auf immer mehr Menschen: Als erstes forderte Carrard ganz grundsätzlich den Abbau von Ehehindernissen. Damit verband er unmissverständliche Forderungen nach Gleichheit.24 Der Zugang zur Ehe sollte quasi demokratisiert werden, um „ihre freyheit auf festen fuß zu setzen“ und damit das Bevölkerungswachstum zu fördern.25 Carrard deutete die Ehe somit explizit als nützliches Freiheitsrecht. Diese Freiheitsforderung war der Gegenentwurf zum ständisch-patriarchalen Ehegesetz in Bern, das die Untertanen in zunehmendem Maß von der Ehe ausschloss. Dabei beabsichtigte Carrard mittels Eheschließungen „den wohlstand in allen classen der einwohner auszubreiten“ und „das glük aller bürger gleich zu verschaffen“.26 Im Zuge dieser Forderung verlangte der Theologe die Reduktion von Abgaben der Untertanen: „[D]urch die fehler der Regierung, durch schwere auflagen, durch einen mangel des schuzes zum vortheil der anschlägigkeit, durch vereinigung aller glüksgüter auf wenige geschlechter, durch vorzüge, die man einem allzuzahlreichen adel gestatet“, müsse die Zahl der Eheschließungen und damit die Fruchtbarkeit sinken.27 Dieser Anspruch auf Demokratisierung der Eheschließung aus der Feder eines Waadtländer Pfarrhelfers in einem Herrschaftsgebiet mit vermeintlich abnehmender Bevölkerung muss folglich als massive aufklärerische Kritik an einer patrizischen Regierung interpretiert werden – so auch wenn er schrieb: „Diese üble politic verstopft die quellen ihres reichthums sehr geschwinde: sie macht, daß die anzahl der Heyrathen abnihmt, daß das volk und mit demselben die summ der abgaben sich vermindert.“28
Auf die Grundsatzforderung nach der Demokratisierung der Eheschließung folgten in Carrards Argumentation sieben weitere Maßnahmen zur „aufmunterung zum Heyrathen und zur fruchtbarkeit“.29 Diese erscheinen aus heutiger Sicht teilweise eher disparat. Sie umfassten so unterschiedliche Anliegen wie die Förderung der Fischzucht zur Steigerung der Ernährungsgesundheit, die Steuerung des mütterlichen Stillverhaltens, die Verhinderung der Abwanderung von Bauern in die Stadt sowie typische zeitgenössische Luxuskritik, die die Verkleinerung des Dienstbotenstandes forderte und eine ‚natürliche‘ Lebensweise propagierte.30 In ihrem Kern mahnten sie aber immer die Sorgfaltspflicht der Obrigkeit gegenüber ihrer Bevölkerung an und fußten im Wesentlichen auf dem Ziel der Bevölkerungsvermehrung. Im Hinblick auf die weiter unten zu untersuchende Ehegerichtspraxis und die ehepolitische Urteilslogik der Richter interessieren insbesondere die Forderung nach der Bekämpfung der Unkeuschheit und die allgemeine Stigmatisierung von Ehelosigkeit und Witwenheiraten. Im Zusammenhang mit der Unkeuschheit kontrastierte Carrard in idealtypisch aufklärerischer Weise die leidenschaftliche mit der vernünftigen Liebe. Den Ursprung der Leidenschaft verortete er in der „sträflichen lust“ und der „anziehende[n] kraft“, die „eine unaufhörliche verschiedenheit“ auslöste.31 Ihr stellte er die „innigste […] verbindung“ gegenüber, die aus einer „gegenseitigen hochschäzung, aus einer gemeinschaftlichen dienstfertigkeit“ und der gemeinsamen Kindererziehung herrührte.32 Um die beständigen und ungleich fruchtbareren Eheverbindungen zu fördern und den außerehelichen Leichtsinn zu bekämpfen, forderte der Theologe die konsequente Durchsetzung strenger Sittengesetze mittels disziplinierender Strafen.33 Die Richter müssten unabhängig vom Stand der devianten Subjekte unparteiisch und konsequent urteilen, weil ansonsten die Gesetze wirkungslos würden.34 Im Rahmen einer „gesunde[n] staatskunst […] unter einer guten Regierung“ propagierte Carrard außerdem die allgemeine Stigmatisierung des ehelosen Standes und die Heiraten von Witwen.35 Dazu forderte er unter anderem explizit die Senkung des gesetzlichen Ehemündigkeitsalters, um „die kinder nicht allzulange der väterlichen gewalt zu unterwerfen, und dieselben vor dem unwillen der väter in sicherheit zu sezen“.36 Die Obrigkeit sollte also das patriarchale Zugrecht eindämmen, um die Ehen ihrer Bevölkerung in jüngerem Alter zu fördern. Denn Eltern würden zusehends aus „hochmuth, eigennuz, oder nur aus eigensinn“ ihre Kinder in deren fruchtbarsten Jahren am Heiraten hindern und „durch übelangewendte widersprüche für immer das heyrathen ekelhaft machen“.37 Daneben sprach er sich für die Bekämpfung von Witwenheiraten aus, weil er sie aufgrund der zum Teil großen Altersdifferenz der Ehepartner oder des hohen Alters beider involvierter Eheleute für unnatürlich und ungesund hielt.38 Deswegen „sollten die geseze mit der natur übereinstimmen, und einen ekel ab dergleichen Ehen einflössen.“39
Carrard war mit seinem detailreichen Vorschlag zur Förderung der Ehe zwecks Bevölkerungsvermehrung zwar sehr konkret und pointiert und hat hier deswegen detaillierte Erwähnung erfahren. Er war aber keineswegs allein. Mit ihm konkurrierte Jean Bertrand, der die Preisfrage gewann. Dieser war ebenfalls ein Waadtländer Theologe und der Bruder des ungleich bekannteren zeitweiligen Sekretärs der Oekonomischen Gesellschaft Elie Bertrand.40 Und auch er war der Meinung, dass „Heyrathen ohne widerspruch die versichertsten und tüchtigsten mittel sind, dem Staate kinder zu verschaffen und zu seinem nutzen zu erziehn“.41 Neben den zwei Theologen, die mit ihren Schriften um den ersten Platz konkurrierten, meldete sich auch noch Abraham Pagan, Sekretär der Zweigstelle Nidau der Oekonomischen Gesellschaft,42 auf dieselbe Preisausschreibung mit einem Beitrag, der allerdings keine Auszeichnung erhielt.43 Er teilte mit den beiden Vorgängern die populationistische Sicht und sprach sich deshalb ebenfalls für die Vermehrung der Eheschließungen aus. Allen erwähnten Autoren waren, neben geringfügigen Nuancen, zentrale Gemeinsamkeiten in ihrer Auffassung zur Bevölkerungspolitik zu eigen: Der größte Reichtum eines Staates war in ihren Augen dessen Bevölkerung. Je größer die Bevölkerung, desto mächtiger der Staat, desto prosperierender die Wirtschaft, desto größer und verbreiteter letztlich das Glück und der Wohlstand. Durch diese Spielart des Utilitarismus wurde aus Untertanen eine Bevölkerung, die ihrerseits zum zentralen Objekt der Regierung avancierte.44 Eine schwindende Bevölkerung wurde zum maßgebenden Indikator verfehlter Herrschaftstätigkeit. Eines der ‚nützlichsten‘, also in utilitaristischem Sinn effektivsten populationistischen Mittel, um die Fruchtbarkeit und Fortpflanzung zu steigern, war eindeutig die Förderung der Eheschließungen. Dadurch wurde die Institution der Ehe unmittelbar mit dem Fortschritt in Verbindung gebracht. Die Ehe, interpretiert als Ausgangspunkt der Familie, wurde zu jenem „Element innerhalb der Bevölkerung“, das Foucault in seinen Analysen zur Gouvernementalität „als grundlegendes Relais zu deren Regierung“ bezeichnet hat. Die Ehe wird in seinen Worten ein „privilegiertes Segment, weil man, wenn man, sobald man bei der Bevölkerung hinsichtlich des Sexualverhaltens, hinsichtlich der Demographie, der Kinderzahl, hinsichtlich der Konsumtion etwas erreichen will, sich an die Familie wenden muss“.45 Die Ehe war natürlich, nützlich und gesund und entsprach in der Logik der natürlichen Theologie zugleich der moralischen göttlichen Ordnung. Diese und die Natur befanden sich folglich in vollkommenem Einklang. Indes avancierte die Eheschließung damit in der Auffassung dieser Populationisten zu einem Naturrecht, das es unter den Auspizien des Fortschritts zu fördern galt. Nach physiokratischem Vorbild sollte die Natur zum Ausgangspunkt sämtlicher Beziehungen werden und deren Steuerung determinieren. Die Regenten hatten das Wesen dieser Natur zu erkennen, um demselben zum Durchbruch zu verhelfen. Der Fortschritt folgte der Natur. Insofern ging „der Ausübung der Gouvernementalität“ in dieser Auffassung „eine bestimmte Natürlichkeit, die der Regierungspraxis selbst eigentümlich [war]“, voraus.46
Eheschließungen konnten durch eine paternalistische Regierung mit verschiedenen wirtschaftlichen und gesetzlichen Mitteln gefördert werden. Am stärksten betont wurde in den Forderungen die Herabsetzung gesetzlicher und finanzieller Zugangskriterien zur Ehe. Gleichzeitig sollten Eheschließungen mittels Vorsorgefonds, Steuern und Verdienstmöglichkeiten für Mittellose subventioniert und mit dem exklusiven Zugang zu Ämtern für die Aristokratie privilegiert werden. Aber auch die Förderung bestimmter Gewerbe und die Bekämpfung des Luxus sollten die Eheschließungen vermehren. Mit diesen Maßnahmen war implizit die Forderung nach der Demokratisierung der Ehe verbunden. Die bevölkerungspolitischen Zuschriften und ihre Autoren standen somit in einem fundamentalen Widerspruch zur ständischen Eheordnung und deren patriarchalen Gesetzen. Die hier vorgestellte propagierte fortschrittsoptimistische und reformorientierte Bevölkerungspolitik verband sich außerdem mit einer spezifischen Kritik am Luxus und der ständischen Ordnung: Das standesgemäße Leben und die damit verbundene ‚Üppigkeit‘ verschlangen demzufolge finanzielle Mittel und humane Ressourcen in Form von Dienstpersonal, die man besser für Eheschließungen einsetzen konnte.
In dieser biopolitischen Logik traten Regierung und Regierte in ein spezifisches Beziehungsverhältnis. Dieses war diskursiv tendenziell von ‚Zärtlichkeit‘, ‚Zuneigung‘ und ‚Liebe‘ geprägt und fand mehr Entsprechung in der elterlichen Liebe zu den Kindern als in der strengen patriarchalen Disziplinierung. Die Sorge um die Bevölkerung zeichnete sich als oberste politische Maxime dieser Populationisten ab. Wie der liebevolle Vater seinen Kindern, sollte sich „das Vaterland“ seiner Bevölkerung zuwenden.47 Wie „eine zärtliche mutter […], die für alle die eine zärtliche sorgfalt trägt, denen sie das leben gegeben hat“, musste sich die Regierung um ihre Bürger kümmern.48 Damit benannte Carrard exakt jene Liebesanalogie, auf die Sandro Guzzi-Heeb hinweist, wenn er anführt, dass die Aufklärung die Liebe zum generellen Beziehungscode erklärt hatte. In der Überlagerung von elterlicher Liebe, Patriotismus und paternalistischer Zuneigung des Souveräns für seine Bevölkerung kam hier eine neue umfassende gouvernementale Logik zum Ausdruck: „Les politiques de reproduction, les interventions poupulationnistes sont conceptualisées en terme d’actes pour le bien-être du peuple.“49
1.3 Die politische Sprengkraft des Populationismus bei Jean-Louis Muret
Im gleichen politischen Klima wie Carrard, Bertrand und Pagan trat ein Jahr später der waadtländische Geistliche Jean-Louis Muret mit einer Zuschrift an die Oekonomische Gesellschaft von Bern auf. Auch seine Abhandlung beschäftigte sich mit dem Zustand der Bevölkerung, allerdings explizit mit derjenigen in der Waadt. Seine Feststellungen und die daraus abgeleiteten Forderungen zur Bevölkerungsvermehrung unterschieden sich höchstens geringfügig vom bisher Präsentierten. In Bezug auf die Eheschließung forderte auch er ihre Begünstigung aus den bereits bekannten ökonomischen, gesundheitlichen und moralischen Gründen.1 Die populationistische Logik dahinter glich der seiner Vorgänger.
Verbal in seiner Kritik nicht expliziter als Carrard, machte auch er die Berner Obrigkeit für den Bevölkerungsrückgang verantwortlich. Die gegenwärtige Entvölkerung erfolgte laut Muret „aus moralischen gründen“.2 Die sittlichen Zustände in Bern spiegelten in seiner Sicht die verfehlte Bevölkerungspolitik der Obrigkeit. Was seine Studie allerdings von den Darstellungen der zuvor präsentierten Populationisten grundlegend unterschied, waren die statistische Datengrundlage und die mathematische Methode, die er anwandte und die nachhaltigen Eindruck hinterließen.3 Sein Vorhaben in Bezug auf die Eheschließung exemplifizierend, formulierte er:
„Was […] den ehestand belanget, wenn solcher gegen den ledigen stande verglichen wird, so begreiffet man leicht, daß der vorzug auf der seite des standes sey, der den absichten des Schöpfers entspricht. Da Mann und Weib zum Ehestande beruffen sind, so ist es voraus zu vermuthen, daß ihnen die erfüllung dieses beruffes nicht schädlich seyn, sondern vielmehr zu ihrer gesundheit und erhaltung des lebens beytragen soll; allein das ist eine würkliche wahrheit, die sich besser durch berechnung, als durch theologische gründe erweisen läßt.“4
Schon seit 1761 arbeitete der Pfarrer Muret als Sekretär des Ablegers der Oekonomischen Gesellschaft in Vevey – dessen Gründer er auch war – an seiner Studie zur Waadtländer Bevölkerungsentwicklung. Dazu erhob er eine Reihe von Daten, die zum Teil bis ins 16. Jahrhundert zurückreichten. Er berief sich in seiner Analyse daneben auf die von der Regierung erhobenen Zahlen der Volkszählung von 1764 sowie auf Taufziffern aus 46 Kirchgemeinden. Diese hatte er sich von Pfarrkollegen liefern lassen. Das erworbene Datenmaterial breitete er auf 270 Seiten aus. Davon waren 130 Seiten Text, die gewissermaßen einen 140 Seiten langen Anhang, bestehend aus Tabellen und Bevölkerungszahlen unterschiedlichster Art, ausführlich und detailreich kommentierten.5 Auf die genannten, staatspolitisch betrachtet vertraulichen, Bevölkerungsdaten hatte er nur in seiner Funktion als Pfarrer Zugriff. Aus seinen Datenreihen zur Waadt, die er für repräsentativ für das gesamte Berner Territorium hielt,6 leitete er induktiv den Befund ab, dass sich die Bevölkerung im Rückgang befinde.7 Damit stellte er seine Herrschaftskritik auf eine Grundlage, die wesentlich mehr Sprengkraft enthielt und folglich ungleich höhere Wellen in der politischen Öffentlichkeit von Bern schlug als die bisher vorgestellten Schriften. Mit seiner umfangreichen Schrift veröffentlichte er sicherheitspolitisch sensibles Datenmaterial und stellte damit die Regierung bloß, die eine strikte Arkanpolitik verfolgte. Das oberste Prinzip dieser Politik war die Geheimhaltung von Regierungsgeheimnissen.8
Die statistisch ausgewiesene Obrigkeitskritik, die durch Murets Studie zum Ausdruck kam, wurde durch die Vorrede der Oekonomischen Gesellschaft noch verschärft. Unter expliziter Bezugnahme auf die Bevölkerungsanalysen des Pfarrers wurde im Vorwort bemerkt, dass eine erfolgreiche Regierung ihre Bevölkerung zu vermehren wissen würde:
„In diesem neuen Jahrgange erscheinet vorerst die längste angekündete Abhandlung von dem Zustande der Bevölkerung unsers Landes. Ein immer wichtiger gegenstand. Denn darauf kommt alle Staatskunst an; die kenntniß von der zahl und geschäftigkeit der Untergebenen ist einem Fürsten unentbehrlich. Sein beruf, seine vorschrift ist, die gröste mögliche zahl von menschen zu beglüken. Die Bevölkerung ist die probe der Regierung. Ist jene blühend, ist sie im anwuchse; so schliessen wir, die verfassung, und welches eine folge davon ist, die verwaltung ist gut.“9
Berns Bevölkerung schien im Rückgang begriffen. Ergo wurde hier unverhohlen formuliert, dass die Potentaten Berns die angesprochene Probe nicht bestanden und ihre Pflicht nicht erfüllt hatten. Der Erfolg einer Regierung wurde im Geist der aufgeklärten Staatsräson von den gelehrten Zeitgenossen an ihrer Bevölkerungspolitik und der Zahl der Untertanen gemessen. Murets Kritik traf die Berner Obrigkeit also im Kern ihres eigenen Herrschaftsverständnisses.10 Die Ausführungen des Geistlichen waren folglich politisch höchst brisant. Ein Untertan aus der Waadt – als Pfarrer zwar zweifellos gebildet und vor Ort eine besondere Zwitterstellung zwischen Obrigkeit und Lokalbevölkerung einnehmend, aber trotz dieses Wissens und seiner Stellung als lokaler Beamter von der politischen Partizipation ausgeschlossen11 – kritisierte mehr oder weniger öffentlich die Bevölkerungspolitik der gnädigen Herren von Bern:
„Obwohl indessen aus der vergleichung der Tauf- und Todtenregister erhellet, daß (wenn jedoch die Auswanderung ausgenommen wird) sogar bey dem gegenwärtigen zustande der sache, ein ziemlich beträchtlicher überschuß, und ein sicheres erholungsmittel vorhanden wäre, das land wieder zu bevölkern, so fehlet doch noch vieles daran, daß das land alle seine vortheile sich zu nuzen mache.“12
In Murets Argumentation erschien die restriktive Ehegesetzgebung, die eine große Zahl der Menschen von der Ehe ausschloss, nicht nur nutzlos, sondern vollkommen verfehlt. Denn sie verhinderte, dass sich die Bevölkerung vermehrte, obwohl genügend Ressourcen dazu vorhanden waren.13 Murets preisgekrönte Schrift brachte das politische Parkett von Bern zum Beben: Eine konservative Mehrheit im Rat stieß sich daran, dass Mitglieder aus den eigenen Reihen in einer privaten Vereinigung – gemeint war die Oekonomische Gesellschaft – einer Kritik Raum boten, die die Wirksamkeit der obrigkeitlichen Bevölkerungspolitik offen in Frage stellte. Albrecht von Haller, der zu dem Zeitpunkt amtierender Präsident der Oekonomischen Gesellschaft war, wurde daraufhin vom amtierenden Schultheißen Johann Anton Tillier vorgeladen. Der Regierungsvorsteher tadelte den Repräsentanten der Sozietät für die öffentliche Einmischung in staatspolitisch sensible Angelegenheiten. Haller thematisierte die Vorladung in einem Schreiben an Samuel Auguste André Tissot: Man fürchte sich in Bern vor privater Kritik an der Regierungspraxis, womit er gleich noch die Ignoranz der in seinen Augen konservativen Regierung der Kritik aussetzte.14
Murets Studie und die ebenfalls kritische Stellungnahme der Oekonomischen Gesellschaft in der Vorrede zum selben Heft der Abhandlungen führten in der Folge dazu, dass der Rat der Sozietät die Beschäftigung mit regierungsrelevanten Themen – was im zeitgenössischen gouvernementalen Verständnis bevölkerungspolitische Gegenstände waren – untersagte. Zusätzlich verbot man den Regierungsmitgliedern der Gesellschaft die Teilnahme an den Versammlungen der Helvetischen Gesellschaft.15 Es wurde befürchtet, dass durch regierungskritische Gesellschaftsglieder Bernische Staatsgeheimnisse nach Schinznach getragen würden und den Miteidgenossen zu militärischen, demographischen und wirtschaftlichen Vorteilen verhelfen könnten. In konservativen Regierungskreisen bestand die latente Angst vor politischem Einfluss aus den aufklärerischen Kreisen der Helvetischen Gesellschaft. Die Ableger der Oekonomischen Gesellschaft in Berns Landschaft wurden mittels Mandat vom 20. September 1766 fortan unter die Aufsicht der betreffenden Landvögte gestellt.16
Nach Muret meldete sich noch Charles-Louis Loys de Cheseaux mit einer populationistischen Zuschrift zum Zustand der Bevölkerung, worin die Förderung der Eheschließung wiederum eine wesentliche Rolle für das Bevölkerungswachstum spielte.17 Die Schrift war in ihrer Tonalität allerdings ausgesprochen zurückhaltend. Trotzdem wurde auch dort in der „Seltenheit der Ehen“ eine maßgebliche Ursache für den Bevölkerungsrückgang gesehen.18 Der gemäßigte Ton dürfte eine direkte Folge der vorausgegangenen Rüge von Seiten der Obrigkeit an die Adresse Murets und der Oekonomischen Gesellschaft gewesen sein. Auch die Oekonomische Gesellschaft war offensichtlich darum bemüht, die Wogen zu glätten, wenn sie im Vorwort zu Loys Schrift die Hoffnung ausdrückte, eine der Regierungsmeinung entgegengesetzte Position publizieren zu dürfen, ohne dass ihr politisches Kalkül zur Last gelegt würde.
1.4 Von der Angst vor der Entvölkerung zur Angst vor der Überbevölkerung
Schon in den 1760er Jahren gab es in der Oekonomischen Gesellschaft allerdings auch Stimmen, die dem propagierten Populationismus gegenüber kritisch eingestellt waren. Sie schlugen eine ganz andere, nämlich patriarchale Ehepolitik vor, die viel stärker „der Tradition des Hausvater-Modells“ folgte1 – so zum Beispiel der Berner Landgeistliche Albrecht Stapfer,2 der für einen prosperierenden Landbau klassisch anmutende patriarchale Maßnahmen propagierte: Die Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder eher spät heirateten, weil in seinen Augen Verehelichungen in jungen Jahren meistens unglücklich endeten.3 Wer sich dagegen im reifen Alter traute, tat das nicht „aus einem jugendlichen und hizigen triebe“, sondern „[gründet] sich zugleich auf vernunft“, woraus eine „zärtliche und unzertrennliche freundschaft“ in der Ehe resultiere.4 Diese Beziehungsgrundlage ließ auch in der Auffassung des Vikars den Nachwuchs „gesünder und stärker“ werden, weil die Erziehung in diesen kooperativen Ehen besser gewährleistet werden könne. Zudem stellte diese Freundschaft die Basis dar, um „einem hauswesen recht vorzustehen“.5 Die Verantwortung lag nach Stapfers Auffassung bei den Eltern, „dass sie ihren kindern nicht allzuviele freyheit in dieser so wichtigen sache gestatten“.6 Vätern und Müttern oblag es, ihre Kinder von „böser gesellschaft“ in „weinhäuser[n]“ fernzuhalten.7 Denn dort würde sich die ausgelassene Jugend treffen, die Söhne und Töchter verführte. Er warnte in durchaus aufklärerischem Duktus vor den ländlichen Gepflogenheiten der Eheanbahnung, die entweder zu unglücklichen Ehen oder einem zahlreichen unehelichen Nachwuchs führen würden.8 Stapfer forderte deswegen, dass die Eltern besonders die Schamhaftigkeit ihrer Söhne pflegten. Sie sollten diese fördern, indem sie den männlichen Nachwuchs abends im Haus behielten. Dadurch würden die Söhne vom nächtlichen Umherschweifen ab- und somit von den liederlichen Mägden ferngehalten, die in Stapfers Vorstellung nur listig danach trachteten, die Söhne „anzuloken“.9 Aus den elterlich unkontrollierten Verbindungen konnten nur zwei denkbar schlechte Szenarien resultieren. Entweder mussten die Eltern eine Frau in ihrem Haus aufnehmen, die ihnen missfiel, oder der Sohn musste in einer hier ständisch-patriarchal gedachten Ehrgesellschaft „für sein ganzes leben einen schandflek“ tragen, der ihn zeitlebens „an einer guten heyrath hindert[e]“.10 In Stapfers konservativer Abhandlung war es somit nicht vordringlich die Aufgabe des Staates, ehefördernde Maßnahmen zur Bevölkerungsvermehrung zu betreiben. Im Vordergrund stand die Obliegenheit der Eltern, die Eheschließungen ihrer Kinder in patriarchaler Manier zu kontrollieren, restriktiv zu verwalten und in die richtigen Bahnen zu lenken. Dazu sollten Väter und Mütter – nicht die Regierung – Rahmenbedingungen schaffen, damit sich die Kinder bei Tag treffen konnten. Die Eltern der potenziellen Eheleute sollten sich vorgängig kennen. Als einzige ehefördernde Maßnahme schlug der Pfarrhelfer von Oberdiessbach die Aufweichung der örtlichen Endogamie vor. Erhöhte eheliche Mobilität würde dazu führen, dass weiterhin standesgerecht geheiratet werden könnte. Denn aufgrund der streng eingehaltenen lokalen Endogamie war es für reiche Bauern schwierig, dem „sohne ein weib von seinem stande zu finden, weil ihm keine töchtern, als die von seiner gegend bekannt sind, und auf dem lande heyrathen sich die reichen eben so ungerne an ärmere, als in den städten.“11
Stapfers tendenziell konservative Stimme war aber trotz der Auszeichnung mit einem Preis durch die Gesellschaft in den 1760er Jahren in Bern nicht die dominante in bevölkerungspolitischen Fragen. Nachdem in dieser Zeit der bevölkerungspolitische Diskurs von der Angst beherrscht wurde, die Landbevölkerung sei in drastischer Abnahme begriffen, kamen in der Oekonomischen Gesellschaft Berns allerdings bereits gegen Ende der 1770er Jahre breiter abgestützte Zweifel an dieser Annahme auf. Die anhand sozialhistorischer Analysen konstatierte Lücke in Berns Bevölkerung, die ein nachholendes Bevölkerungswachstum nach sich zog, wurde zwischen ca. 1750 und 1770 allmählich geschlossen. Das zeitlich verschobene Wachstum führte dazu, dass um 1770 die Bevölkerung auch in Bern merklich zu wachsen begann. Denn jetzt war das Bevölkerungsdefizit, das die Rote Ruhr 1750 verursacht hatte, ausgeglichen und die Bevölkerung wuchs über den Umfang vor 1750 hinaus. Dadurch offenbarte sich im Kanton Bern dasselbe demographische Phänomen wie in der restlichen Eidgenossenschaft: Die Differenz zwischen Geburten- und Sterberate entwickelte sich zu Gunsten eines anhaltenden Wachstums.12