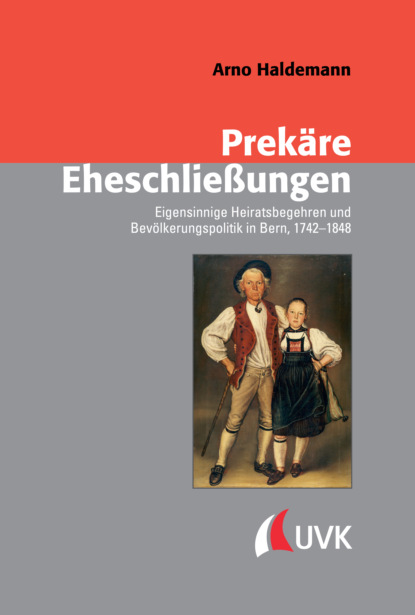- -
- 100%
- +
Das für Bern neuartige Bevölkerungswachstum, das das Trauma der Roten Ruhr, die Furcht vor drohender wirtschaftlicher Stagnation und die Angst vor schwindender militärischer Stärke in der öffentlichen Diskussion in den Hintergrund treten ließ, nahmen die Zeitgenossen etwas verzögert wahr. 1778 überlegte die Oekonomische Gesellschaft in einer ihrer Sitzungen, eine Preisfrage auszuschreiben, deren Inhalt nahelegt, dass das Wachstumsphänomen im Kreis der Sozietät durchaus registriert wurde. Man war sich in den Reihen der Gesellschaft nicht mehr sicher, ob die gegenwärtige Wirtschafts- und Bevölkerungspolitik der Regierung immer noch den aktuellen Bevölkerungszuständen im Territorium entsprach. Damit stand die Frage zur Debatte, ob eine große Bevölkerung wirklich automatisch zu einer prosperierenden Wirtschaft, militärischer Stärke und in der Folge zur maximalen Glückseligkeit im Sinne des Wohlstands eines Volks führte – oder aber eine Bedrohung für die Versorgungslage Berns darstellte. Gefährdete nicht gerade der drohende Versorgungsnotstand, den eine über die agrarischen Ressourcen hinauswachsende Bevölkerung erwarten ließ, die Zufriedenheit der Untertanen und damit die Stabilität der politischen Ordnung und Ruhe? Zwar vertagte die Gesellschaft eine Entscheidung über die Beantwortung dieser Frage.13 Die Debatte in der Sozietät offenbart jedoch, dass die zuvor von Entvölkerungsängsten genährte Stimmung aufgrund der Erfahrungen, die seit den 1770er Jahren mit dem aufholenden Wachstum in Bern gemacht wurden,14 langsam umschlug: Aus versorgungspolitischen Erwägungen begann man, sich zunehmend vor der Überbevölkerung zu fürchten. Inwiefern auch die Hungersnot von 1770/71 eine Rolle für diese Wende im bevölkerungspolitischen Diskurs spielte, darüber lässt sich hier im Zusammenhang mit Bern nur mutmaßen. In Bezug auf die gesamte Schweiz hat Rudolf Braun erwähnt, dass die Versorgungskrise zwischenzeitlich zu einer steigenden Zahl besitzarmer und -loser Menschen geführt hatte und sich deswegen die kritischen Stimmen zumindest mittelfristig mehrten.15 Fest steht, dass Karl Ludwig von Haller in seinem Gutachten zu den Wettschriften „Nahrungssorgen“ thematisierte und als Resultat einer zu stark anwachsenden Unterschicht interpretierte.16 Dieser in Bern in den 1770er Jahren vorerst angedeutete Wandel in der öffentlichen Bevölkerungsdebatte stellte keinesfalls ein lokales oder lediglich eidgenössisches Phänomen dar. Die geschichtswissenschaftliche Literatur zeigt, dass in den bevölkerungspolitischen Ansichten am Ausgang des 18. Jahrhunderts allgemein ein regelrechter „Paradigmenwechsel“ in Gang war.17 Dieser begann sich in Bern allerdings bereits zehn bis fünfzehn Jahre früher abzuzeichnen, als dies generell die Literatur veranschlagt.18
1.5 Die letzte total revidierte Ehegesetzordnung unter dem Ancien Régime (1787)
Die Bevölkerungstheoretiker in Bern nahmen während den 1760er Jahren kontroverse Positionen zur restriktiven Ehegesetzgebung ein. Dagegen stellte die oben erwähnte Auseinandersetzung der Oekonomischen Gesellschaft mit dem Bevölkerungswachstum seit den späten 1770er Jahren eine tendenzielle Annäherung zwischen Bevölkerungstheorie und Eherecht dar. Die Angst vor der Entvölkerung wich im halböffentlichen Kreis der Theoretiker allmählich Befürchtungen vor einer zu stark und zu schnell anwachsenden Bevölkerung. Ihre Versorgung, so die Angst, würde die natürlichen Ressourcen Berns in zunehmendem Maß (über)strapazieren. Physiokratische Überzeugungen gewannen im Lager der Oekonomischen Gesellschaft auf Kosten kameralistischer Ansichten an Boden. Gleichzeitig blieb die ehegesetzliche Lage unverändert und restriktiv. Sie verschärfte sich sogar mit dem letzten umfassenden Revisionsprozess unter dem Ancien Régime und der daraus resultierenden letzten Bernischen Ehegerichtsordnung von 1787. Denn diese Ordnung prononcierte die Exklusivität und damit den ständischen Charakter des ehelichen Status.1 Die Magistraten verfolgten mit dem letzten vollständigen Revisionsprozess – danach wurde die Satzung bis zur Einführung des Zivilgesetzbuchs (1824/26) nur noch partiell abgeändert oder in Teilaspekten aufgehoben – nicht nur die Intention, die Ehegesetze den zeitgenössischen Gesellschaftsverhältnissen anzupassen, sondern sie auch im Sinne ihrer Effektivität „zu verbessern“.2 Was für Schultheiß, Kleinen und Großen Rat dabei ‚verbessern‘ bedeutete, ging unmissverständlich aus der Präambel der Ordnung hervor: Es galt primär „die so schädlichen folgen des lasters der unreinigkeit, die menge der bastarden, und die den gemeinden obliegend (!) lästende erhaltung derselben“ einzudämmen.3 Uneheliche Nachkommen wurden im Geist dieser Ordnung primär als materielle Belastung der kommunalen Ressourcen identifiziert. Im Zentrum der Ordnungsanstrengungen stand aber nicht mehr die Herstellung der gesellschaftlichen Reinheit per se, sondern die effiziente Abwehr der Folgen der moralischen Unreinheit: kostspielige und ressourcenzehrende mittellose Kinder armer Eltern.4 Um den sittlichen Wandel sämtlicher Gesellschaftsglieder zu steigern, sollten entsprechend der tatsächlich sehr reformiert formulierten Vorrede, erstens, „die ehen befördert“ und, zweitens, aber die Eltern dennoch zu „sorgfältigerer aufsicht über ihre kinder“ angehalten werden.5
Die Präambel der fast ein halbes Jahrhundert zuvor revidierten Ehegesetzordnung von 1743 hatte über das Problem der überproportionalen Vermehrung mittelloser Schichten noch geschwiegen. Dagegen wurde der rasante Anstieg mittelloser Bevölkerungsgruppen in der Fassung von 1787 unumwunden thematisiert und in den Mittelpunkt der Revisionsabsichten gestellt. Um das Problem in den Griff zu bekommen, war man seitens des Berner Patriziats bereit, die Autorität der lokalen Chorgerichte und des Oberchorgerichts durch „mehrere Gewalt“ zu stärken.6 Um verheimlichte Schwangerschaften, Abtreibungen und Kindsmorde zu bekämpfen, war man außerdem gewillt, die Strafen für illegitime Schwangerschaften zu mildern. Was es für die Gesetzgeber allerdings hieß, die Eheschließungen zu fördern, erschließt sich nicht auf Anhieb und erscheint danach diffus und paradox. Zwar wurde das Alter der Ehemündigkeit tatsächlich zögerlich um ein Jahr gesenkt – was als ehefördernde Maßnahme interpretiert werden kann. Dadurch endete das Zugrecht des Vaters „oder deren, die an vaters statt sind, als der mutter, großvater, großmutter, vögten oder nächsten verwandten“, mit dem Antritt des 24. Lebensjahrs.7 Doch die Einschränkungen gegen AlmosenempfängerInnen, die 1743 Eingang in die Ordnung fanden, wurden unverändert belassen: In der Stadt genossen die Gesellschaften das Vetorecht gegen Ehen ihrer Unterstützungsbedürftigen, auf dem Land waren es die Honoratioren, die nun nach Erreichen des 24. Lebensjahrs im Namen der Gemeinden gegen Armenehen opponieren durften. Wer Almosen empfing, konnte an der Ehe gehindert werden, bis die Steuern zurückbezahlt waren. Wer während seiner Erziehung Almosen in Anspruch genommen hatte, durfte mindestens bis zum 24. Lebensjahr an der Eheschließung gehindert werden, auch wenn von Gesellschaft oder Gemeinde aktuell keine Unterstützungsleistungen mehr bezogen wurden. Somit ist anzunehmen, dass einerseits das bevölkerungspolitische Interesse der Herrschaft an der Eheschließung wuchs, weil man die Zahl der unehelich Geborenen zu verringern wünschte. Doch andererseits bestand dieses Interesse keinesfalls darin, prekäre Eheschließungen generell zuzulassen. Vielmehr galt es, diese laut der Zentralaussage der Präambel unbedingt zu verhindern. Oberstes Gebot war es, der rasch anwachsenden Schicht armer Menschen und unterstützungsbedürftiger Familien Einhalt zu gebieten.8 Ökonomistische Überzeugungen ließen in immer ausgeprägterer und offenkundigerer Weise religiös akzentuierte Sittlichkeits- und Moralvorstellungen in den Hintergrund treten. Während 1743 die „fortpflanzung wahrer gottesforcht, christlichen lebens, handels und wandels“ noch an oberster Stelle der Chorgerichtssatzung stand,9 „erwarte[te]“ die Berner Obrigkeit 1787 nur noch abschließend und sogar etwas selbstgefällig „zuversichtlich den göttlichen segen“ für ihre unter wirtschaftlichen Vorzeichen revidierten Ehegesetze10. Illegitimität wurde dadurch ein verhältnismäßig kleineres Problem, sobald die materielle Versorgung der Kinder gewährleistet war. Heiraten mit unzureichendem Auskommen hingegen wurde im Zuge der bereits konstatierten allgemeinen Ökonomisierung stärker problematisiert. Und so erstaunt es wenig, dass gerade kirchliche Funktionsträger diese gesetzlichen Entwicklungen kritisierten.
Die verzögerte Ausschreibung der Preisfrage
Die Rhetorik der Ehegerichtsordnung und der Geist der zeitgenössischen bevölkerungspolitischen Diskussion kamen sich immer näher und überlagerten sich 1791. Denn jetzt schrieben die Verantwortlichen der Oekonomischen Gesellschaft explizit eine Preisfrage aus, deren Beantwortung sich mit den Vorzügen und Nachteilen einer Bevölkerungsvermehrung auseinanderzusetzen hatte. Die Bevölkerungszunahme war in der Wahrnehmung der Zeitgenossen mittlerweile eine unbezweifelbare Tatsache geworden, die selbst in den Kreisen der Oekonomischen Gesellschaft nicht mehr positiv bewertet wurde.1 Karl Ludwig Haller stellte als Sekretär der Gesellschaft 1796 in der Neuesten Sammlung von Abhandlungen der Berner Sozietät den in den 1760er Jahren noch gelobten Populationismus durchaus tendenziös in Frage:
„Schon seit einiger Zeit hatte man in verschiedenen Staaten, und auch in dem hiesigen, zu bemerken angefangen, daß die besonders seit König Friedrich II. so sehr in Umlauf gekommene, und fast von allen Regierungen befolgte Maxime, die Bevölkerung ihrer Staaten so sehr immer möglich zu befördern, nicht unbedingt richtig sey, und daß der beständige Anwachs einer nur durch unzureichende oder unsichere Erwerbungsarten sich ernährenden, meistentheils eigenthumslosen Volksmenge, dem Staate in mancherley Rücksichten nachtheilig und beschwerlicher werden könne. Durch diese und andere Betrachtungen ward demnach die ökonomische Gesellschaft veranlasset, im Jahr 1791 mit einem Preis von 20 Dukaten die Beantwortung der Frage auszuschreiben: In wiefern die zunehmende Bevölkerung für den Canton Bern und seine verschiedenen Distrikte vortheilhaft oder nachtheilig sey?“2
Auf die Ausschreibung der Frage gingen zwei Antworten ein, wobei die eine von der Redaktion aber wegen mangelnder Gründlichkeit nicht publiziert wurde. Die andere, bereits 1792 eingereichte und schon damals von der Versammlung preisgekrönte, aber erst vier Jahre später publizierte Antwort, wurde wiederum von einem Pfarrer verfasst.3 Allerdings handelte es sich nun nicht um einen waadtländischen Landgeistlichen, sondern um einen noch in der Ausbildung befindlichen Pfarrvikar, der laut einem Nachruf in der Eidgenossenschaft weit herumgekommen war.4 Gottlieb Siegmund Gruner, der noch im Jahr der Publikation das Amt des scheidenden Sekretärs Karl Ludwig von Haller übernahm und bis 1807 innehaben sollte, bezog eingehend Stellung zur Frage, ob es die Bevölkerung zu vermehren galt oder ob man sie davon abhalten sollte.5
Der traditionelle Geist dieser Schrift wird schnell ersichtlich, wenn man sie vor dem populationistischen Hintergrund der Waadtländer Geistlichen liest, die ihre Einschriften rund ein Vierteljahrhundert früher formuliert hatten. Gruners Publikation war geradezu eine Abrechnung mit dem merkantilistisch geprägten Populationismus. Laut dem Autor entsprach die populationistische Bevölkerungstheorie einer Täuschung, die den unbescheidenen „Launen“ Einzelner entsprang.6 Sie schenkten seiner Meinung nach abstrakten Größen wie Volksmenge, Reichtum, Handel, Manufakturen etc. aus egoistischen wirtschaftlichen Motiven mehr Glauben als der materiellen Realität des Gemeinwesens, die es für Gruner primär zu berücksichtigen galt. Den Merkantilisten warf er deswegen in diskreditierender Weise Spekulation vor, während er sich der empirischen Faktizität rühmte. Nur tyrannische Despoten könnten sich eine uneingeschränkte Vermehrung ihrer Untertanen wünschen, weil ihnen deren Wohl gleichgültig wäre, so Gruner. Eine menschenliebende und landesväterliche Regierung müsse sich wegen der uneingeschränkten Bevölkerungsvermehrung über die Grenzen der natürlichen Ressourcen hinaus hingegen Sorgen machen, weil die Versorgung ihrer geliebten Untertanen auf dem Spiel stünde.7 Damit verriet der Antwortende unverhohlen seine physiokratische Gegenposition: Das wahre Wohl lag für ihn nicht in merkantilistischen Einbildungen, sondern erschöpfte sich in den Grenzen der durch den Menschen zu steigernden Fruchtbarkeit und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, die der Boden hergab. In dieser bevölkerungspolitischen Logik waren also vor allem Landarbeiter nötig, die die natürlichen Ressourcen bewirtschafteten und optimal ausnutzten. Wo die Bauern ihren Beruf gegen vermeintlich lukrativere und scheinbar bequemere Erwerbsarbeit eintauschten, würden sie die durch die Landwirtschaft garantierte Nahrungssicherheit aufgeben.8 In Gruners Schrift lässt sich somit die pessimistische Interpretation des Übergangs von einer ständisch organisierten Gesellschaft hin zu einer Klassengesellschaft finden. Wenn der Bauer „seinen Stand verlässt“, beginnt die dystopische Klassengesellschaft, weil er die Produktionsmittel aus der Hand gibt und zum abhängigen Arbeiter oder Händler wird.9 Daraus resultierte ein System, in dem immer weniger produzierende Bauern eine wachsende Schicht handeltreibender Spekulanten und über ihre Verhältnisse lebender Konsumenten ernähren müssten.
„Wenn dieser Stand mit seinen Sitten der sich mehrenden Volksmenge weichen muß, so wird er von einer Klasse verdrängt, die, was er uns verschafte, in viel geringerem Maße hervorbringt und hingegen in grösserm verzehrt.“10
Gruner erachtete folglich nur ein den organischen Ressourcen entsprechendes Bevölkerungswachstum als für den Staat wünschenswerte Entwicklung. Zudem sollte dieses von den hofbesitzenden Bauern ausgehen.11 Im Zuge seiner bevölkerungspolitischen Überlegungen spielten zur Regulierung der Gesellschaftsgröße deshalb auch ehepolitische Erwägungen eine zentrale Rolle. Dabei unterschied sich der Physiokrat in seiner Argumentation von den kameralistisch inspirierten Populationisten darin nicht, dass die Ehe als einzige legitime Ordnung der Sexualität und Fortpflanzung gelten sollte. Doch die daraus abgeleiteten heiratspolitischen Forderungen waren komplett verschieden. Während die Populationisten mit der Herabsetzung der Volljährigkeit versuchten, junge Männer und Frauen der väterlichen Gewalt zu entwinden, galt es für Gruner im Umkehrschluss, den Zugang zur Eheschließung durch die Stärkung der patriarchalen Kontrolle zu erschweren. Die Ehe sollte restriktiv verwaltet und an Besitz, Arbeit und Vermögen geknüpft werden. Sie sollte bestimmt nicht demokratisiert und breiteren Schichten zugänglich gemacht werden. In Bezug auf die ehepolitischen Folgen kritisierte Gruner ganz besonders die in Bern weitverbreitete Realteilung. Dagegen hob er die Vorzüge der Primogenitur hervor: Wo Väter nicht jedem Sohn, sondern nur dem Erstgeborenen ihren Besitz hinterließen, da wären die Ehen rarer, stabiler und glücklicher, aber auch fruchtbarer.12 Dass in diesem Erbschaftssystem einige Söhne unverheiratet bleiben mussten, war Gruner gerne bereit hinzunehmen. Denn dadurch blieb der Besitz zusammen und band die ledigen Söhne an den elterlichen Hof. Sie mussten in der Theorie des Vikars deshalb nicht in jungem Alter verkostgeldet werden, weil sie auf dem elterlichen Hof gebraucht wurden. Das hatte den positiven Effekt, dass sie ortsansässig und der Aufsicht und Kontrolle der lokalen Gemeinschaft unterstellt blieben. Auf diese Weise konnte „daher jedem Hange zum Leichtsinne, zur Liederlichkeit oder Verschwendung beyzeiten vorgebeugt […] werden“.13 Wo hingegen die Grundgüter durch Realteilung kontinuierlich verkleinert würden, stellten dem Vikar zufolge Heim- und Fabrikarbeit eine verführerische Alternative zum Getreideanbau dar. Das Resultat war in den Augen Gruners Sittenzerfall und die ungebremste „Vermehrung armseliger Haushaltungen und unnützer, unglücklicher Menschen“.14 In seiner Abhandlung war es deswegen auch eine besondere Qualität kommunaler agrarischer Verfassungen, hohe Einzugsgelder für Neuankömmlinge und Einheiratende zu verlangen. Gruner interpretierte es geradezu als einen Akt der landesväterlichen Güte, Eheschließungen von Armen, die bei ihm per se leichtsinnig waren, mit diesem Mittel zu verhindern. Denn der Pfarrvikar stellte Armutsphänomene in einen kausalen Zusammenhang mit sexueller Unreinheit. Das tat er, indem er den Tatbestand des Leichtsinns zum Normalfall des sexuellen Kontakts in den unteren Bevölkerungsschichten erhob. „Der die Armuth gewöhnlich begleitende Leichtsinn“ und „besonderer niedriger Eigennuz“ dieser spezifischen Bevölkerungsschicht gingen für ihn einher. Es war in seinen Augen der sexuelle Leichtsinn der Armen, der sämtliche Solidarität in den Gemeinden lähmte und die gemeinnützigen Institutionen bedrohte.15 Bei Gruner erschienen moralischer Zerfall und sexuelle Promiskuität als logische Konsequenzen von wirtschaftlichem Abstieg und materieller Armut. Hiermit wurde eine direkte Kausalität zwischen Prekarität und Sittenlosigkeit hergestellt.16 Die armen Gesellschaftsschichten stellten damit ein permanentes Sicherheitsrisiko für die Wohlfahrt und die Sitten der Gesellschaft dar.17
Folglich redete der Vikar, nach der populationistischen Konjunktur, mit seiner Zuschrift also wieder einer dezidiert disziplinarischen Ehepolitik das Wort, der es um die Verknappung der Eheschließungen und die Stärkung patriarchaler Macht ging. Dagegen tadelte er den in seinen Augen in der zeitgenössischen Ehepolitik nach wie vor beobachtbaren „zu starken Einfluß“ des populationistisch-merkantilistischen „Bevölkerungsgrundsaz“, der seiner Ansicht nach nichts anderes besagte, als „dass die Vermehrung des Volks, besonders der Armen, ohne Einschränkung zu begünstigen seye“.18
Bezogen auf die Normen und bevölkerungspolitischen Debatten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lässt sich also abschließend sagen: Während man sich in den 1760er Jahren in den Reihen der Oekonomischen Gesellschaft von Bern vor einer Entvölkerung fürchtete und daher die Lösung staats- und wirtschaftspolitischer Herausforderungen, die unentwirrbar zusammengedacht wurden, in der Peuplierung der Landschaft erspähte, kippte der Diskurs gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Bern allmählich ins Gegenteil. Sowohl die 1787 revidierte Ehegesetzordnung als auch Gruners exemplarische Preisschrift verraten, dass man die Bevölkerungsvermehrung zunehmend als Ursprung allen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und moralischen Übels sah. Beiden Diskurspositionen war bei aller Widersprüchlichkeit allerdings gemein, dass wirtschafts- und staatspolitische Fragen fortan über die Steuerung der Bevölkerung gelöst werden sollten und die Ehepolitik dabei die Rolle eines Scharniers in der Herrschaftspolitik einnahm. Das zentrale politische Handlungsmotiv bildete die Sorge um die Bevölkerung. Die skizzierten Positionen innerhalb dieses biopolitischen Diskurses werden weiter unten in Bezug auf die Urteilssprechung im Oberchorgericht erneut in Betracht gezogen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.