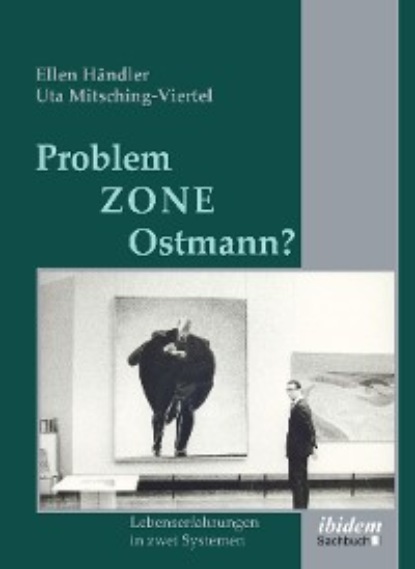- -
- 100%
- +
Große Hilfe erhielten wir von Oma Zuber, Inges Großmutter. Sie schlief neben dem Baby. Oma Zuber war die wichtigste Person in Inges Leben. Die Familie war aus Tschechien ausgewiesen worden, im Rahmen des Beneš-Dekret*. Inge trat als junge Kommunistin in die Fußstapfen von Opa und Vater und wurde jung Mitglied der Partei. Im gleichen Betrieb wie Vater arbeitete sie als Kernmacherin. Das war eine schwere Arbeit in der Gießerei. Auf der Kreisparteischule erwarb sie sich 1948 nicht nur erste Kenntnisse in den Gesellschaftswissenschaften, sondern verliebte sich auch noch in ihren Lehrer. Ergebnis: Edith, geboren am 21. Mai 1949. Dumm nur, dass der Herr Papa nicht der Papa sein wollte. So bot ich mich später an, Edith zu adoptieren. Inges Mutter war dagegen, nahm Edith zu sich. Sie hat nicht eine Nacht bei uns geschlafen. Entsprechend war die Bindung meiner Kinder zu ihr.
Unvergesslich waren für mich die III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin vom 5. August bis zum 19. August 1951. Sie standen unter dem Motto: »Für Frieden und Freundschaft – gegen Atomwaffen«. Teilnehmer: 26.000 Jugendliche aus 104 Ländern, Ehrenpräsident war Prof. Joliot-Curie aus Frankreich, Präsident des Weltfriedensrates. Trotz vieler Repressalien durch die Polizei nahmen mehr als 35.000 junge Menschen aus der BRD und aus Westberlin am Festival teil. Danach wurde ich Instrukteur in der Stadtleitung der FDJ* Dresden. Wir bereiteten das erste Pioniertreffen im August 1952 in Dresden vor. Besonders viel Kraft steckten wir in die Vorbereitung der Pionierparade, die Pionierfeste im Großen Garten und im Pionierpalast, die Auftritte von Kulturgruppen, die Wettkämpfe der jungen Sportler im Rudolf-Harbig-Stadion. Martin Andersen Nexö, der dänische Romancier und Novellist, feierte seinen Geburtstag in seiner Villa auf dem Weißen Hirsch in Dresden. Ich durfte ihm mit einigen Pionieren unsere Glückwünsche überbringen.
Und meine Inge hatte es wieder einmal eilig. Sie schaffte es nicht ins Krankenhaus, und so kam unser Sohn Jürgen in unserem Schlafzimmer zur Welt und ich fiel in Ohnmacht. Oma Zuber kümmert sich bis zu ihrem Tode liebevoll um ihre Urenkel und starb in unseren vier Wänden. Sie hatte sich in der Woche, wenn wir arbeiteten, um die Kinder gekümmert. Aber am Wochenende gehörten wir den Kindern. Oft spazierten wir durch den Großen Garten und besonders gern begleiteten wir die Kinder in den viertältesten Zoo Deutschlands, in Dresden gegründet 1861. Dorthin führten mich schon als Kind meine Eltern. Jetzt zeigte ich meinen Kindern und meiner Frau den 13 Hektar und damit 26 Fußballfelder großen Tierpark am Rande des Großen Gartens.
Nach dem Tod der Uroma gingen unsere Kinder in ein Wochenheim der VP*. Inge war mit der Pflege der Kranken in der Untersuchungshaftanstalt Dresden beschäftigt und ich trieb mich als Instrukteur in den Schulen der Stadt herum. 1956 wurde ich Lagerleiter für ein Winterlager der Kinder der Reichsbahnangestellten. Höhepunkt sollte ein Feuerwerk sein. Im Lager für Pyrotechnik in Pirna sollte ich das Zeug abholen. Im Knallerlager packte mir der Mitarbeiter den Rucksack voll. »Aber Vorsicht, das Zeug ist gefährlich!« Vorsichtshalber sagte ich nicht, dass ich mit dem Bus unterwegs war. Ich hockte auf der Rückbank und merkte, wie sie heiß wurde. Ich saß auf der Heizung – und mir wurde noch heißer. Den Rucksack hatte ich nun auf dem Schoß. Alles ging gut. Für die Kinder war das Feuerwerk eine wahnsinnige Überraschung, sie hatten so etwas noch nie erlebt. Für mich war es ein schweißtreibendes Erlebnis.
Im Frühjahr 1956 musste ich wegen meines fehlenden Hochschulabschlusses zur ›Runderneuerung‹ an die Jugendhochschule Wilhelm Pieck an den Bogensee für fünfeinhalb Monate. Und schon war ich Lehrer!
In meiner politischen Arbeit spielte natürlich der Kalte Krieg gegen die DDR eine große Rolle. Wirtschaftlich litt die Volkswirtschaft der DDR unter dem vielseitigen Embargo. In Vietnam versuchten die USA, das vietnamesische Volk seit 1955 in die »Steinzeit zurück zu bomben«. Der Krieg dauerte bis 1975! Das war die Zeit, als die Kinder aufwuchsen, von denen mir ein Teil anvertraut war. Wenn die Generationen, die heute in Deutschland leben, keinen Krieg mehr am eigenen Leibe erfahren haben, so ist das auch den jüngsten Friedenskämpfern zu verdanken, die zum Beispiel 1958 auf dem Friedensmarsch nach Halle waren. Das darf man nie vergessen!
Von September 1958 bis zum August 1959 musste ich als Vorsitzender einer Kreisorganisation der Pioniere wieder zu einer ›Runderneuerung‹, diesmal als Student an die Bezirksparteischule der SED in Dresden. Zurück von der Parteischule wurde ich Stellvertretender Leiter des Pionierpalastes in Dresden, der in einem der Albrechtsschlösser über der Elbe 1951 eröffnet wurde. Zu meinen Aufgaben gehörten die Abteilungen Sport/Touristik, Naturwissenschaft (NAWI), Kunst und die Abteilung Massenarbeit. Nach Ideen und Vorschlägen der Kinder erstellten wir die Monatspläne und das Monatsplakat für das Kinderparadies, das die Kinder Dresdens an allen Litfaßsäulen der Stadt lesen konnten. Der Palast war für alle offen. Und vom Pionierpalast aus wurden Kinderfeste im Haus, im Park oder im Großen Garten für durchschnittlich 5.000 Kinder gestaltet. Bei den Kindern besonders beliebt waren Ostereiersuchen im Park oder die Märchenstunden im Türkischen Bad. Übrigens: Die Teilnahme am Pionier- oder Betriebsferienlager, 21 Tage, kostete einheitlich zwölf DDR-Mark. Da konnten selbst Arbeiterkinder aus der Bundesrepublik erholsame und interessante Ferientage verleben.
In meiner wenigen Freizeit spielte die Kultur eine große Rolle. Wir besaßen ein Theaterabonnement und jeden Monat war einmal Theatertag. Kultur gehörte zu unserem Leben wie das tägliche Brot.
Während des Pioniertreffens in Halle im August 1961 stand Inge kurz vor der vierten Entbindung. Jahre quälte sie sich mit der Erinnerung an die Geburt unseres Sohnes Lutz 1958. Er starb am gleichen Tag. Inge hatte ihn nicht sehen können. Als ich mich von ihm in der Pathologie verabschiedete, sah ich in ihm die Kleinausgabe von Jürgen, unserem zweiten gemeinsamen Kind. Ich werde das Bild nie vergessen. Sein Hals, er hatte sich mit der Nabelschnur bei der schweren Geburt selbst erdrosselt, war verbunden. Inge habe ich zu ihren Lebzeiten nie davon erzählt. Sie trug schwer daran – bis mir nichts Besseres einfiel, als ihr zu einer neuen Schwangerschaft zu verhelfen. Jetzt hatte sie wenigstens die Hoffnung, dass alles gut gehen würde. Unsere Tochter Annette wurde gesund geboren.
Für meine weitere Entwicklung benötigte ich nach Ansicht meiner Bezirksleitung der FDJ* einen Hochschulabschluss. Meine Abschlüsse als Pionierleiter und Lehrer der Unterstufe und bei der Partei hatten nur den Wert von Fachschulabschlüssen. An der Karl-Marx-Uni Leipzig stand ab September 1963 ein Platz im Fernstudium auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften für mich bereit. Mein Problem war Russisch. Auf diesem Gebiet war ich eine absolute null. Also nahm ich Nachhilfeunterricht bei einer rüstigen Frau, mindestens 80 Jahre alt, in einer piekfeinen Villa in Radebeul. An unseren Milchglasscheiben in unserer Wohnung, an Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer schrieb ich mit Kreide die Vokabeln des Tages, die ich jedes Mal, wenn ich die Tür öffnete, erst übersetzte, bis sie saßen. Inge ermahnte die Kinder, das Geschreibsel nicht weg zu wischen, weil »Papa das braucht!«. Die Russisch-Prüfung endete in einem Blutbad – das ganze Blatt rot, aber bestanden. Ich wusste damals noch nicht, dass der Mann meiner Lehrerin der Vorsitzende Richter im Reichstagsbrand-Prozess von 1933 gewesen war. Seine Witwe meinte: »Mich belastet das sehr und ich möchte wenigstens an einem Kommunisten etwas gut machen. Deshalb möchte ich von ihnen kein Geld nehmen. Ich würde mich freuen, wenn sie mir ein paar Aufbaumarken besorgen könnten. Körperlich kann ich in meinem Alter nicht mehr beim Aufbau helfen.« Der Prozess endete mit einem »Freispruch aus Mangel an Beweisen«. Ihr Mann hatte die Erwartungen der Hitlerleute damit nicht erfüllt. Er starb 1937 in Leipzig aus Schmach, »Werkzeug gewesen zu sein«.
Die Jahre des Studiums wurden zu einer großen Belastung für die ganze Familie und natürlich für mich. Ich musste die Ferien von 800 Kindern aus dem Bezirk Dresden in einem Zentralen Pionierlager retten. Die bisherige Leitung war überfordert. Aus dem einem Jahr wurden zwei Jahre, und dann pendelte ich zwischen Dresden (Wohnort), Leipzig (Studienort) und Güntersberge (Arbeitsort) hin und her. Zugabteile und Bahnhofswartesäle wurden meine Studierzimmer. Man kann sich leicht vorstellen, dass das für die Familie zu einer Festigkeitsprobe wurde. Das Fernstudium musste ich 1966/67 unterbrechen. Die Belastung war zu hoch. Im Februar 1968 legte ich in Leipzig noch das Staatsexamen in Russisch ab. Aber während der Schreiberei an meiner Diplomarbeit war ich gesundheitlich am Ende. Alfred ging zu Boden. Am 1. Oktober 1968 erfolgte meine Exmatrikulation.
Während meines Fernstudiums begann für mich bereits am 1. Dezember 1966 ein vollkommen neuer Lebensabschnitt. Mir wurde die Verantwortung über die größte Jugendherberge der DDR, die Jugendburg Ernst Thälmann in Hohnstein/Sächsische Schweiz, übertragen. Damit endete meine hauptamtliche Tätigkeit in der FDJ* und Pionierorganisation. Nach 17 Jahren wurde ich aus dem Verband verabschiedet und mit der höchsten Auszeichnung »Freund der Jugend« geehrt. Die Burg Hohnstein spielte in meinem Leben eine ganz besondere Rolle. Sie war eines der ersten Konzentrationslager in Deutschland, wurde im März 1933 eröffnet. Konrad Hahnewald hatte sie 1926 zur Jugendburg umgestaltet und wurde ihr erster Jugendherbergsleiter. Er war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und weigerte sich, auf der Burg die Hakenkreuzfahne zu hissen. Er wurde dort einer der ersten Häftlinge. Meine Lehrmeister im Sachsenwerk/Niedersedlitz waren Überlebende dieses KZ und schlugen mich 1966 als Herbergsleiter vor. Diese große Herberge verfügte über 290 Plätze im Winter und 420 Plätze im Sommer. Das waren circa 5.600 Übernachtungen im Jahr. Auf einem internationalen Seminar der Jugendherbergsleiter in Warschau im Jahr 1969 stellte die DDR erneut den Antrag, Mitglied der internationalen Jugendherbergswerksföderation zu werden. Bis dahin waren alle Anträge auf Drängen der Bundesrepublik abgelehnt worden. Als Leiter der größten Jugendherberge sollte ich das Jugendherbergswesen der DDR vorstellen. Ich kannte ja nur meine Herberge und über unsere Jugendburg Hohnstein berichtete ich, wie wir das vielfältige Herbergsleben gestalteten, aber auch das antifaschistische Vermächtnis hochhielten. Die internationale Skepsis, vor allem die der anderen Deutschen, blieb. Daraufhin lud ich deren Generalsekretär ein, sich persönlich zu überzeugen. Er war Engländer, kam mit seiner Frau, blieb nicht wie geplant zwei Stunden, sondern einen ganzen Tag. Er hat für die Aufnahme der DDR gesorgt. Von da an war unsere Jugendherberge Treffpunkt für viele internationale Ereignisse. Hier waren wirklich Jugendliche aus der ganzen Welt.
Leider war die Jugendherberge immer eine große Baustelle und ich der Bauchef. Das hat mir die letzte Kraft genommen. Als mir mein Arzt sagte, dass ich aufhören müsste, sonst gebe es für mich nur noch Grab oder Klapsmühle, zog ich die Reißleine. In einer Abschiedsrunde mit all meinen Freunden, Mitarbeitern, Bauarbeitern ließ ich diese wichtigsten Lebensjahre Revue passieren. Dabei waren auch meine wissenschaftlichen Ratgeber der beiden Ausstellungen über das KZ und die Naturkunde, die wir gemeinsam dort gestaltet hatten. Wir packten unsere Koffer und stürzten uns in das nächste Abenteuer: die bedeutend kleinere Jugendherberge in Chorin. Der bisherige Leiter hatte nach dem Tod seiner Frau zu trinken begonnen. Die Jugendherberge war verwahrlost. Innerhalb weniger Wochen sollte ich sie in einen vorbildlichen Zustand bringen. Man gab mir 480.000 Mark, damit die Herberge für die Weltfestspiele im Sommer 1973 in Berlin als Reservequartier für ausländische Touristen bereitstand. Dazu musste eine Zufahrt für Busse gebaut werden. Ich schaffte es wieder. Die ersten Gäste wurden die normale Belegung, die Reserve wurde nicht nötig. Ausgelegt war die Herberge für 99 Betten. Ab 100 Betten hätte dem Herbergsleiter ein höheres Gehalt zugestanden. Nach unserer Silberhochzeit 1975 reichte es meiner Frau. Wir hatten seit 1966 nie mehr in einer eigenen Wohnung, sondern immer in Zimmern der Herberge gelebt. In den zurückliegenden zehn Jahren machten wir zweimal Urlaub, davon einmal in einer Herberge, in der wir die 14 Tage doch gearbeitet hatten. Sie stellte mich vor die Wahl: »Entweder, wir ziehen zusammen von hier weg, oder du bleibst allein hier.« Daraufhin habe ich das erste Mal in meinem Leben aus persönlichen Gründen gekündigt.
Ich schaute ins Protokoll des Parteitages, um nach einem Neubauwohngebiet zu suchen, in dessen Nähe ich Arbeit finden könnte. So kam ich auf Marzahn und die dortige Berliner Werkzeugmaschinenfabrik. Beim Kaderleiter fragte ich, ob er einen Werkzeugmacher gebrauchen könne. Als er hörte, wie lange ich aus dem Beruf war, schlug er mir vor, für die Produktionsvorbereitung die Produktionslenkung zu übernehmen. Die Erfüllung meiner zweiten Bitte, eine Wohnung zu bekommen, dauerte noch sehr lange. Schneller als alles andere wurde ich Innendienstleiter der Kampfgruppe* des Betriebes. Endlich, nach einem Jahr und Krach mit dem Kaderleiter, nahmen sie mich in die AWG* auf. Für eine Wohnungszuweisung war es notwendig, selbst Arbeitsstunden zu leisten. Die durfte ich nach Feierabend im Betrieb ausführen. In der Abteilung Feinmechanik habe ich nach meinem ersten Feierabend oft bis spät abends entgratet, und das ein halbes Jahr lang. Ich habe darüber Buch geführt. Ich bekam die Wohnung und suchte mir eine Zweizimmerwohnung mit Balkon aus. Wir dachten, dass unsere Tochter irgendwann ausziehen und es für uns reichen würde. Wichtig war der Fahrstuhl. Hier wohne ich noch heute. Ich hatte die Wohnung noch nicht bezogen, da kam die Partei und meinte: »Jetzt, wo du in der Nähe eine Wohnung in Aussicht hast, brauchen wir dich unbedingt für das Gebiet um das Dorf Marzahn als Parteisekretär.« Ich ließ mich breitschlagen und startete mit 18 Genossen verstreut über ganz Marzahn und Hellersdorf. Das habe ich bis 1990 gemacht. Dann waren wir 420 Genossen und ich schlug eine Teilung vor. Nachdem ich geholfen hatte, drei Leitungen zu bilden, vergaß mich meine Partei. Keiner war hier, niemand wollte meinen Parteibeitrag, lud mich zu Parteiversammlungen ein. Sie waren so sehr mit sich selbst beschäftigt, vielleicht auch aus Selbstschutz. Mich sprechen die Leute bis heute an. Niemals ist mir einer blöde gekommen.
Anfang April 1995 kam Inge vom Briefkasten mit einem Schreiben vom FFO-Reiseclub. »Ich habe dir doch gesagt, dass du noch einmal nach Italien kommen wirst.« Sie erinnerte sich daran, dass ich 14-jährig ein paar Wochen im Postkinderaustausch in Pesaro und in Rom war. Alt war mein gehegter Wunsch, noch einmal an der Adria spazieren zu gehen. In Rimini kamen wir beim Strandspaziergang an einem Gebrauchtwagenhandel vorbei. Inge bemerkte als erste einen roten Opel Corsa Swing. »Das ist ein schöner Wagen: Fünftürer, Automatik-Getriebe ... Den müssen wir haben.« Im Autohaus in Marzahn fanden wir den Bruder. Mit unserem OCSI machten Inge und ich schöne Reisen. Gerade hatten wir die letzte Rate an die Bank bezahlt, da musste sich meine Inge für immer verabschieden. Der Krebs hatte zugeschlagen. Die Fahrt zum Balaton in Ungarn sollte die letzte sein. In den Folgejahren führte mich mein OCSI unfallfrei durch halb Europa. »Zoo-Safari« hießen die meisten Unternehmungen. Dazwischen, von 2001–2010, war er mein Transportmittel zur Arbeit in den Tierpark Berlin-Friedrichsfelde. 380-mal brachte er mich allein zu Einsätzen als Tierparkbegleiter in den größten Landschaftstierpark Europas. Zwischendurch klaute mir jemand auf dem Parkplatz die Kennzeichen und ›kaufte‹ dafür billig Sprit. 2013 sollte OCSI endgültig in Rente gehen, also in die Schrottpresse. Mein Nachbar hatte etwas dagegen: »Verkaufe uns doch den Wagen. Der Bruder in Armenien würde sich freuen.« Die Nachbarn sorgen sich liebevoll wie die eigene Familie um Opa Alfred. Ihre Angehörigen gehören zu meinem Freundeskreis. Es ist schön, dass solche Inseln des Zusammenlebens in der Gesellschaft mit den Ellenbogen erhalten blieben. Verschenken ging nicht, also verkaufte ich OCSI für einen Euro. Und er bekam ein zweites Leben. Im Container reiste er von Berlin über Hamburg mit dem Schiff bis ins Schwarze Meer nach Batumi (Georgien). Jetzt musste er nur noch 500 Kilometer mit eigener Kraft fahren. In der bergigen Gegend um Arteni in Armenien kann OCSI noch einmal so richtig zeigen, was in ihm steckt.
Von meiner Arbeit als Tierparkbegleiter sprach ich bereits. Begonnen hatte es mit einem Kleingartenfest in Marzahn, das der Tierpark Berlin unterstützte mit einem Stand, hinter den man mich stellte. Ich hatte doch keine Ahnung von Zoologie. Also bin ich einfach bei einer Führung mitgelaufen. Kurz darauf bat man mich, eine Führung selbst durchzuführen. Es war jemand erkrankt. Ich habe alles notiert, die Anlässe, die Teilnehmer und die Tiere, die wir besuchten. Von 2001 bis 2010 waren es 380 Einsätze mit 3.421 + X Personen, davon 2.099 plus X Kinder. Das Plus X steht für die, die ich nicht zählen konnte. Größter Renner waren die Kindergeburtstage. Die 171 Kindergeburtstage bei den Elefanten machten nur einen kleinen Teil aus. Das Geburtstagskind konnte sich sein Lieblingstier aussuchen, das wir besuchten. Die Runde dauerte immer eineinhalb Stunden. Am Anfang sagte ich immer: »Kinder, nehmt mir das nicht übel, aber ich habe keine Ahnung, fragt ruhig weiter. Wenn ihr morgen wiederkommt, kriegt ihr die Auskunft.« So fuhr ich jedes Mal vom Tierpark nach Hause und vervollkommnete mein Wissen über das Internet und Bücher. Im Jahr 2001 kam ich auf die Idee, eine Kollektion zum Anfassen aufzubauen. Die Kinder konnten dabei die unterschiedlichen Felle fühlen und streicheln. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich persönlich 135 Zoos in vielen Ländern besucht habe. Heute helfe ich im Norden von Berlin noch einem Wildkatzenzentrum, schreibe die Schilder für die einzelnen Gehege. Jetzt fahre ich mit meinem Rollator. Nachdem meine Betreuerin mich morgens duscht, mache ich ein kleines Nickerchen. Danach setze ich mich täglich für ein paar Stunden an den Computer und arbeite vor allem an unseren Familienstammbäumen. Und da kann ich noch viel beisteuern.
Wolfgang, Jahrgang 1956 | 2 Kinder, verheiratet in erster Ehe
Ost: Lehrer, Schallplattenunterhalter, West: Lehrer, DJ
Mitarbeiter Kreiskabinett für Kulturarbeit, Heizer
Seit meiner Schulzeit
lege ich als DJ Musik auf
Ich bin in N. geboren und lebte bis auf die Jahre meines Studiums immer hier. Direkt nach dem Abitur ging ich nach Berlin an die Humboldt-Uni, um Lehrer für Mathe und Physik zu werden. Der Kelch der Armee ging zum Glück an mir vorbei. Anfänglich war ich sehr unsicher, was ich studieren sollte, Lehrer oder etwas Technisches. Dass meine Wahl gut war, merkte ich während meines ersten Praktikums. Ich konnte gut mit Kindern arbeiten und bekam ziemlich schnell ein Vertrauensverhältnis zu ihnen. Nach dem Studium kehrte ich an meine eigene Schule zurück und spürte bereits in der Vorbereitungswoche und im Gespräch mit dem Schulleiter Ablehnung wegen meines Äußeren. Er sagte: »So fangen Sie nicht an zu arbeiten. Die Haare sind zu lang, der Bart muss ab, und Sie ziehen etwas anderes an – keine Westjeans und Parka.« Das kümmerte mich wenig und ich erschien am ersten Schultag unverändert. Meine Auseinandersetzungen mit dem Direktor und später dem Schulrat waren völlig absurd.
Interessant war für mich nach der Wende, dass dieser Schulleiter IM* war. Immer wieder versuchte man, mich zu drangsalieren, und sei es, mich auf »freiwilliger Basis zur sozialistischen Hilfe« zu schicken. So lernte ich in meinen ersten zwei Jahren zehn Schulen im Umland von innen kennen, was eigentlich damals nach dem Absolventengesetz nicht zulässig war. Ich war also ständig zu Feuerwehreinsätzen unterwegs, wenn irgendjemand für längere Zeit erkrankte. Manchmal war ich an meiner Stammschule nur drei Tage in der Woche.
Seit meiner Schulzeit war und bin ich in meiner Freizeit in Sachen Musik unterwegs. In der DDR war ich als DJ staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Seitdem lege ich fast ohne Unterbrechungen auf. Als Anfang der 1980er Jahre der städtische Jugendklub in unser eigentliches Kulturhaus umziehen sollte, sahen wir, zwei Freunde und ich, die riesige Chance, die Jugendkultur in der Stadt mitzugestalten. Zu dritt erarbeiteten wir eine ausführliche Konzeption für die Gestaltung, die Nutzung der Räumlichkeiten und die Programminhalte. Wir holten sogar Kostenvoranschläge von Firmen für den Umbau ein. Einige Gewerke konnten die später aktiven Jugendlichen nicht selbst erledigen. Völlig außergewöhnlich in der ansonsten zentralistisch durchorganisierten DDR wurde diese privat erstellte Konzeption als Vorlage in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und einstimmig beschlossen.
So erhielten wir drei Privatpersonen den Auftrag, die Konzeption mit Jugendlichen umzusetzen. Völlig ohne die FDJ* begannen wir, Jugendliche zu gewinnen. Bei einer Werbeveranstaltung für das neue Projekt trugen sich fast 100 Jugendliche in Listen ein, um bei der Schaffung eines eigenen Jugendzentrums fernab des verordneten Kulturbetriebes mitzuarbeiten. Es galt, Wände rauszureißen, zu stemmen, diverse Farbschichten zu entfernen, Möbel und Lampen, eine Bühne zu bauen und und und. Nach einem Dreivierteljahr war am 1. Mai 1983 die Schlüsselübergabe. Ab dem Tag begann der Stress. Eine Woche später sollte in dem Kulturhaus eine DDR-weite Tagung zur Sozialistischen Fest- und Feiergestaltung stattfinden. Für diese Großveranstaltung sollten die Jugendlichen, die nun Mitglieder eines FDJ-Jugendclubs waren, Karten abreißen und die Garderobe besetzen. Das fiel aus und sorgte so für den ersten Konflikt.
Bis 1986 arbeitete ich als Lehrer. Wegen der vielen Querelen innerhalb der Schule mit Schulleiter, Schulamt, aber auch mit einigen aus dem Kollegium quittierte ich nach sechs Jahren meinen Dienst. Statt einer Kündigung musste ich allerdings eine Formulierung finden, die es mir erlaubte, nach dem Bruch mit der Schule überhaupt noch eine Arbeit zu bekommen und in der Jugendkulturarbeit weiterzumachen. Zur damaligen Zeit waren wir ein anerkannter Kulturträger in der Stadt mit ständig vollem Haus. Unsere diversen Veranstaltungen waren über die Kreis- und Bezirksgrenzen hinaus bekannt. Aufgrund der langjährig guten Erfahrungen in der inhaltlichen Arbeit mit der Jugendkultur wurde ich Mitarbeiter im Kreiskabinett für Kulturarbeit. Dort war ich verantwortlich für die Schulung ehrenamtlicher Jugendklubleiter, organisierte Beispielveranstaltungen und Lehrgänge. Ziemlich viel Kraft investierten ein Vertreter der FDJ-Kreisleitung* und ich in eine Untersuchung über die Durchsetzung des Jugendgesetzes in unserem Landkreis. Wir prüften, ob wirklich, wie es das Jugendgesetz der DDR verlangte, in jeder Gemeinde ein Jugendklub oder ein Jugendzimmer existierte. Das Ergebnis war ernüchternd. Von 72 Gemeinden fanden wir nur in 18 einen Jugendclub. Das Resultat dieser Untersuchung hat mein Vorgesetzter, der vordem mein Schuldirektor war, allerdings radikal verfälscht. Er drehte es einfach um und berichtete, dass nur noch in 18 Gemeinden etwas Nachholbedarf bestünde. Das reichte mir und ich kündigte diesmal – von heute auf morgen.
Es wäre durchaus möglich gewesen, von den Einkünften als Schallplattenunterhalter zu leben, jedoch benötigte man in der DDR als Amateur-DJ noch einen Hauptberuf. Die Hürden, als Diskjockey hauptberuflich arbeiten zu dürfen, waren hoch. Ganz besonders musste man politisch makellos und möglichst Parteimitglied sein. So fand ich als Hauptberuf einen Job als Heizer. In den Monaten von Oktober bis März oder April musste ich morgens in vier Verkaufsstellen des Konsum anheizen, damit die Kunden und die Angestellten es bei Verkaufsbeginn warm hatten.
Als Jugendclub im Stadtgarten waren wir in vielerlei Hinsicht abhängig vom Wohl und Wehe der dort tätigen Angestellten. Ein Rockkonzert musste um 23:45 Uhr beendet sein, sodass die letzten Gäste um Mitternacht raus waren. Bei einem Heavy-Metal-Konzert 1985 konnten wir das nicht durchsetzen. Die Musiker spielten und die Zuschauer forderten Zugaben. Um 23:55 Uhr sagte mir der Mitarbeiter: »Wenn nicht sofort Schluss ist, schraube ich die Sicherung raus.« Und er tat es. 250 bis 300 Leute standen in einem völlig dunklen Saal ohne Ton. Da kam Panik auf. Daraus wurde eine unglaubliche Story gesponnen und unter den Mitarbeitern und in den Parteigremien weitergetragen: In dieser brenzligen Situation wäre ich mit meinem Freund aus Protest auf die Bühne gesprungen, hätte den rechten Arm gehoben und begonnen, das Deutschlandlied zu singen. Absurd. Dennoch erhielten wir aufgrund dieser fingierten Vorwürfe Hausverbot – im eigenen Laden. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Versuche von offizieller Seite, uns als Jugendzentrum zu schaden. So hätten während eines Rockkonzerts bei uns im Saal angeblich Gäste einer anderen Veranstaltung, die räumlich direkt unter dem Saal an einer Bar saßen, sich durch die im Rhythmus unserer Musik schwingende Decke bedroht gefühlt und die Bar fluchtartig verlassen. Man ließ ein Gutachten erstellen, nach dem Einsturzgefahr bestünde. Fortan durfte in unserem Saal nicht mehr getanzt werden. Sämtliche Rockkonzerte und Veranstaltungen, bei denen es zu Bewegungen kommen konnte, wurden gestrichen. Wir machten aus der Not eine Tugend und entwickelten verschiedenste Formate für sogenannte sitzende Veranstaltungen. Wir suchten und fanden später einen Sachverständigen in der Bauakademie der DDR, der das Gutachten überprüfen sollte. Er vermutete spontan, dass das Gutachten falsch sei und wollte dafür den fachlichen Nachweis erbringen. Ihm könne man nichts mehr, er stehe kurz vor der Rente. Das Gutachten kam genau zu diesem Schluss. Demnach war es unbedingt notwendig, dass solche Böden schwingen konnten, das mussten sie sogar. Im Ergebnis konnten wir nach circa drei Jahren wieder tanzen. Das waren nur zwei von vielen Versuchen, uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen und unser Jugendzentrum immer wieder an den Rand der Existenz zu bringen. Wir waren eine ziemlich verschworene Gemeinschaft. Ich bin sehr froh und auch stolz, dass der Laden trotz all dieser Versuche heute noch existiert, 30 Jahre nach der Wende – wenn doch mit vielen Höhen und Tiefen. Und sehr stolz sind wir, dass nachwachsende Generationen unseren Staffelstab übernommen haben und vor allem nach der Wende die Überführung eines FDJ-Jugendclubs in einen allseits anerkannten Verein gelang.