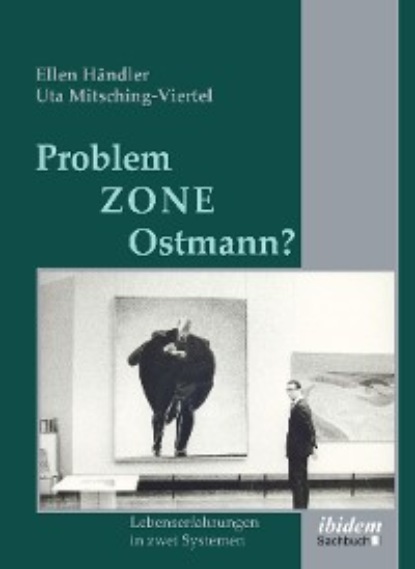- -
- 100%
- +
Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich immer frei meine Meinung gesagt habe. Ich habe dadurch nie Probleme bekommen, fühlte mich nie unterdrückt, oftmals jedoch ohnmächtig und hilflos. Man spürte in den letzten Jahren der DDR, dass so vieles nicht funktionierte, dass so viele unzufrieden waren. Ich habe mir eingebildet, dass die da ›oben‹ nicht wüssten, was ›unten‹ abläuft. In der Wendezeit, als so manches öffentlich wurde, war ich schockiert und konnte es nicht fassen. Trotz allem hatte ich die Hoffnung, dass man die DDR verbessern und verändern könnte. So trat ich in die Partei ein, weil ich dachte, man muss und kann konkret die Probleme vor Ort anpacken. Im Chemiewerk habe ich zum Beispiel vorgeschlagen, einen Meckerkasten anzubringen, in den die Leute ihre Sorgen und Nöte, auch anonym, einstecken können. Aus heutiger Sicht war dieser Vorschlag vermutlich etwas weltfremd und naiv.
Wirkliche Existenzängste hatte ich damals nicht, eher Sorge, wie alles weitergehen wird. Wie viele Leute würden durch die Roste fallen und in dem neuen System nicht bestehen? Unser aller Leben hat sich fast über Nacht völlig verändert. Wenn Birgit Breuel, die Chefin der Treuhand, rückblickend sagt, dass die meisten Westdeutschen diesen Umbruch vermutlich nicht verkraftet hätten, ist das zwar löblich, hilft all den Gestrandeten aber nicht. Diese Gedanken haben mich damals sehr beschäftigt. Meiner Familie ging es früher nicht schlecht und auch heute geht es uns gut. Ich denke, dass alle, die willens und in der Lage sind, sich ständig weiterzubilden, auch heute zurechtkommen. Leider kann das aber nicht jeder, und genau diese Leute bleiben auf der Strecke.
Große Sprünge, wie man so sagt, können eh die Wenigsten machen. Aber ob man wirklich glücklich ist und ein erfülltes Leben führt, hängt nicht allein von der Fülle des Bankkontos ab. Wer sich mal mit dem Easterlin-Paradox befasst hat, weiß, dass ab einem gewissen durchschnittlichen Einkommen pro Kopf die durchschnittliche Zufriedenheit der Menschen nicht mehr ansteigt. Mehr Wohlstand führt also nicht automatisch zu mehr Lebensqualität. Wichtig ist vor allem, dass man gesund bleibt. Im Moment, in Zeiten der Coronapandemie, habe ich nicht so sehr Angst vor dem Virus, sondern vor den wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die sich daraus ergeben werden.
Meiner Meinung nach unterscheiden sich Männer aus den alten und den neuen Bundesländern. Verallgemeinerungen möchte ich vermeiden. Die meisten Ossis stellen nur das nach außen, was sie definitiv können – das packen sie an, und damit fertig. Viele Wessis legen immer noch eine Schippe drauf und machen eine riesige Brühe um alles. Wir im Osten haben es nicht gelernt, uns zu vermarkten. Aber vielleicht trägt das zu einem gesünderen Leben bei. Ich denke, dass die Aufschneider stets im Hinterkopf haben, dass sie der Aufgabe eigentlich nicht gewachsen sind, und das kann auf Dauer nicht gesund sein. Die vielen psychischen Erkrankungen in unserem Land sind vermutlich ein Spiegelbild davon. Einer meiner Handballer, der mittlerweile 36 Jahre alt ist, hat mir mal gesagt: »Das Wichtigste in meiner ganzen Schul- und Abiturzeit war eigentlich die Belegung des Fachs Darstellendes Spiel. Dort habe ich gelernt, wie man sich verkauft. Damit komme ich gut durchs Leben.« Diese Aussage bringt es eigentlich auf den Punkt.
Wir Männer aus den neuen Bundesländern können oft viel mehr, als wir nach außen tragen. Dadurch, dass wir in der DDR so viel improvisieren mussten, spielen wir handwerklich in einer ganz anderen Liga. Da unsere Frauen meistens berufstätig waren, sind Hausarbeit und Kinderbetreuung für uns nichts Ungewohntes. Unsere Freundschaften beruhen auf Ehrlichkeit und gegenseitigem Vertrauen. Man erzählt sich wirklich alles, redet auch über unangenehme Dinge offen. Bei Männerfreundschaften gilt das Gleiche wie in einer Beziehung. Wichtig ist, dass man auf Augenhöhe agiert und ehrlich zueinander ist. Ich brauche Freunde zum Diskutieren und zum Gedankenaustausch. Dabei muss man am Ende nicht immer der gleichen Meinung sein. Eine wirkliche Freundschaft hält sowas aus, egal wo jemand herstammt. Die Männer aus den alten Bundesländern im gleichen Alter sind uns beim Einkommen, beim Eigentum und beim Besetzen der Posten in Wirtschaft und Verwaltung voraus. Auch dadurch kommt bei vielen im Osten ein gewisser Frust auf und bei einigen leidet das Selbstwertgefühl. Unsere Zurückhaltung ist vermutlich ein Hindernis für den beruflichen Aufstieg in der heutigen Zeit.
Die deutsche Wiedervereinigung war für mich keine Vereinigung. Es war nur ein Anschluss. Ich denke, einiges wäre erhaltenswert gewesen. Nur den grünen Pfeil und das Ampelmännchen zu übernehmen, war mit Sicherheit falsch. Auch wenn in der DDR große Fehler begangen wurden und viele Menschen gefrustet waren, so ist für viele trotzdem ihre Heimat verloren gegangen. Diese Pauschalverurteilungen nach der Wende, der Vorwurf, dass wir alle Systemtreue waren und deswegen nun an den Rand gedrängt werden sollten, sitzt bei vielen Betroffenen noch immer tief. Auch dadurch liefen und laufen viele den rechten Rattenfängern hinterher. Wenn ich mir die Führungskräfte der AfD anschaue, die fast alle aus dem Westen stammen und zur Wende 2.0 aufrufen, bekomme ich die Krise.
Die meisten DDR-Bürger hatten gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Man las die Zeitung, meistens von hinten, dort war der Sportteil. Man sah die Aktuelle Kamera und anschließend die Tagesschau und daraus bildete man sich sein eigenes Urteil. Bei mir läuft die Meinungsbildung heute ähnlich. Oftmals geht die Warnleuchte an, dann denke ich: Das hatten wir doch schon mal, dass sich die offizielle Darstellung in den Medien von der Realität entfernt. Die Realität, gut recherchiert, erlebt man meiner Meinung nach zum Beispiel in der ZDF- Sendung Die Anstalt. Ich bin froh, dass es die Zeitung Junge Welt gibt. Sie wirbt mit dem Slogan: »Sie lügen wie gedruckt, wir drucken, wie sie lügen.« Der Spruch »Wer die Macht hat, hat die Medien, und wer die Medien hat, hat die Macht« gilt nach wie vor. Schlussendlich muss man sich immer fragen: Wem nutzt diese Art der Berichterstattung?
Es gibt einige Erfahrungen aus dem Arbeitsleben der DDR, die ich gerne in das Heute herübergerettet hätte. Im Betrieb konnte man seine Meinung sagen, Verbesserungsvorschläge einbringen oder sich über den Chef beschweren. Heute kann man sich zwar auf den Marktplatz stellen und jeden Politiker öffentlich kritisiere. Aber in der Firma konkrete Probleme deutlich ansprechen, ist kaum möglich. Als kritischer Geist bin ich vermutlich genau deshalb selbstständig tätig.
In der Wendezeit wurde auch ich, obwohl ich selbst noch keine 30 Jahre alt war, für 40 Jahre DDR verantwortlich gemacht. Das waren manchmal sehr skurrile Situationen, mit denen ich erst mal schwer umgehen konnte. Heute ist es anders. Meine Stimme hat ein anderes Gewicht als direkt nach der Wende. Die Bürger wissen, dass sie mich jederzeit ansprechen können und dass ich mich für sie einsetze. Vermutlich trug das bei den Kommunalwahlen immer dazu bei, dass ich viele Stimmen erhalten habe. Ambitionen, mich politisch auf höherer Ebene zu engagieren, habe ich nicht. Egal in welcher Partei man sich engagiert, wer Karriere machen will, muss sich letztendlich verbiegen, teilweise die eigene Meinung verleugnen. Das ist nicht mein Ding.
Zu DDR-Zeiten wurde körperlich schwerer gearbeitet. Es fehlte oft die notwendige Technik. Die Umwelt-Sauereien waren deutlich gravierender. Allerdings gibt es heute auch noch genügend Umwelt- und Lebensmittelbelastungen. Wir versuchen als Familie gesund zu leben. In der Freizeit sind wir viel im Wald und am Wasser unterwegs, mal zu Fuß und mal mit den Rädern. Mehr und mehr bin ich ein Grüner geworden. Ich sammle Wildkräuter und bereite daraus Smoothies, Salate und Suppen zu. Das macht mir Spaß und hält uns fit und gesund. Mittlerweile essen wir deutlich weniger Fleisch, dafür aber qualitativ hochwertigeres. Leider gibt es in der näheren Umgebung keinen Bauernhof, auf dem man sich sein Stück quasi schon am lebenden Tier aussuchen kann. Auch wenn es anfangs lange Zähne gab, machen mittlerweile alle in der Familie bei der grünen Ernährung mit.
Kulturell sind wir vielseitig interessiert. Wir gehen ins Theater, in die Oper und gelegentlich zu Konzerten. Ins Kino eher selten. Da ich nicht so der Fernsehgucker bin, liegt das vermutlich an mir. Ich habe nie an einen Vaterschaftstest gedacht. Über so etwas habe ich mir, wie vermutlich die meisten, damals nie Gedanken gemacht. Unserem Sohn sieht man ohnehin an, dass er von mir ist. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu ihm, meistens reicht ein Blick, und wir wissen genau, was der andere meint. Sicherlich liegt es daran, dass wir immer Zeit für ihn hatten und sie uns genommen haben. Die ersten Jahre sind doch die entscheidenden in der Erziehung. Und du erziehst durch dein Vorleben. Ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, am Wochenende als Installateur zusätzlich arbeiten zu gehen. Lieber bin ich mit ihm, oft auch mit seinen Freunden, im Wald oder am Wasser unterwegs gewesen. Viele Jahre war ich sein Trainer beim Handball. Das war bestimmt nicht immer leicht für ihn, da man an den eigenen Sprössling meist höhere Ansprüche stellt als an den Rest der Mannschaft. Auf sein Lernen haben wir, zumindest wissentlich, nie Druck ausgeübt. Auch dadurch ist er ein lockerer und offener Typ geworden, der bei den meisten gut ankommt. Kurz gesagt, der Junge ist uns gut geraten, und wir sind wahnsinnig stolz auf ihn.
Ich hoffe, dass es für die Generationen, die nach uns kommen, keine Rolle mehr spielt, ob sie im Osten oder im Westen des Landes geboren wurden. Bei unserem Sohn ist das bereits jetzt der Fall. Da er so weit weg wohnt, kann man sich leider nicht einfach mal auf die Schnelle besuchen. Das ist zwar schmerzlich für uns, aber wichtiger ist, dass er glücklich ist.
Bei Familientreffen mit seinen Schwiegereltern ist es für uns manchmal etwas schwierig. Wir wollen den Familienfrieden wahren und die Kinder nicht in einen Zwiespalt bringen. In den Unterhaltungen merkt man manchmal, dass sie sich als Sieger der Geschichte fühlen. Zum Teil ist das verständlich, haben sich doch die Bilder verfestigt, dass in der DDR alles grau und kaputt war. Auch wenn wir in den Gesprächen versuchen, einiges vom Kopf auf die Füße zu stellen, geraten wir dabei in eine Verteidigungs- bzw. Rechtfertigungsposition. Wir wollen keine Ostalgie betreiben, wenn wir darauf hinweisen, dass das eine oder andere aus unserer Sicht besser geregelt war als heute. Es kann doch nicht richtig sein, wenn einem andere erzählen wollen, wie man selbst gelebt hat.
Matthias, Jahrgang 1953 | 3 Kinder, verheiratet in zweiter Ehe
Ost: Dipl.-Ingenieur für biomedizinische Kybernetik, West: Oberbürgermeister von Potsdam,
Direktor für Ökonomie und Technik im Krankenhaus, Umweltminister und Ministerpräsident des
Umwelthygieniker, Minister in der Modrow*-Regierung Landes Brandenburg
Die Seele der Demokratie
ist die Liebe zum Kompromiss
Ich bin in Potsdam geboren und habe dort in der Berliner Vorstadt meine ersten 20 Lebensjahre verbracht. Wir haben in Potsdam in einer Gegend gewohnt, in der heute nur noch wenige alte Potsdamer leben, nämlich da, wo jetzt eher die Neupotsdamer zu Hause sind, es ist mittlerweile ein sehr teures Pflaster. Von meinen alten Nachbarn und Klassenkameraden wohnt so gut wie keiner mehr dort. Es ist auch damals ein sehr schönes Stadtviertel gewesen, war aber runtergekommen, wie alles in der DDR, aber so schön gelegen am Wasser zwischen Heiliger See und der Havel, gerade rüber vom Babelsberger Park, nicht weit von der Glienicker Brücke. Und wenn man als Kind Garten, Steg und Ruderboot hat, dann kann nur noch wenig fehlen. Es gab viele Nachbarskinder. Das Großwerden damals hatte einen gravierenden Unterschied zu heute, denn wir waren fast nur draußen. Ich kann mich erinnern, wenn wir abends nach Hause kamen, waren wir ausgepowert. Unsere Eltern mussten sich nie Gedanken darüber machen, wie sie uns beschäftigen können.
Meine Familie war für DDR-Verhältnisse eine sehr christlich-konservative. Meine Mutter Pfarrerstochter, mein Großvater einer der ersten Rundfunkpfarrer bei Radio DDR. Er hat dort oft die Morgenfeier sonntags um 9:00 Uhr gehalten. Mein Vater arbeitete am katholischen Krankenhaus in Potsdam als Arzt. Es ging uns gut, bürgerlicher ging's kaum. Wir hatten keine materielle Not, sondern eine sehr behütete Kindheit. Ich habe nur gute Erinnerungen. Ein Spezifikum unserer Kindheit war, dass um uns herum viele Russen in den Häusern lebten, weil der alliierte Grenzübergang Glienicker Brücke auf der Potsdamer Seite von Russen und auf der Westberliner Seite von Amis bewacht wurde. Nicht weit weg waren die Kommandantur und das russische Magazin, hier konnten wir einkaufen. All das prägt natürlich und gehörte zum Alltag. Das hat man gar nicht mehr bemerkt. Ich weiß aber auch, dass es sehr unterschiedliche Erlebnisse gab, denn nicht weit weg war das Gefängnis in der Leistikowstraße, wo u.a. der Bürgermeister von Potsdam 1952 verschwand und nie wieder auftauchte. Ich habe später, nach 1990, sein Grab auf einem Friedhof in Moskau besucht, er ist ermordet worden. Aber ich war damals Kind und zu uns Kindern waren die Russen immer sehr, sehr freundlich.
Ich habe zwei Schwestern und natürlich gab es den üblichen Streit zwischen Geschwistern, wir mögen uns aber bis heute sehr. In den ersten sechs Jahren besuchte ich in Potsdam die POS* Nadeschda Krupskaja*. Dann habe ich die Schule gewechselt. Walter Ulbricht hatte in den 1960er Jahren weiterführende Spezialschulen initiiert, denn er wollte der DDR einen technologischen Sprung verschaffen. Für seine Großforschungszentren, die er plante, benötigte er Leute, die eine fundierte mathematisch-physikalische Ausbildung hatten. Und so ließ er in jedem Bezirk eine sogenannte Spezialschule für Mathematik und Physik errichten. Und die für Potsdam war in Kleinmachnow, sie ist das heutige Weinberggymnasium. Um dort aufgenommen zu werden, musste man – und das war eine Novität – in der 6. Klasse eine Aufnahmeprüfung ablegen. Wir lernten dort von der 7. bis zur 12. Klasse. Diese Aufnahmeprüfungen waren schriftlich und mündlich und einige Tempoabfragen ganz schön heftig. Sie legten dabei sehr viel Wert auf logisches Denken. Es gab ein Internat, aber wir Potsdamer Schüler wohnten noch zu Hause, fuhren als Crew gemeinsam täglich mit dem Bus. Die Schule war richtig gut, die Klassen relativ klein. Die jungen und sehr gut ausgebildeten Lehrer haben sich viel Mühe gegeben. In den Hauptfächern Mathe, Physik und Chemie gab es geteilten Unterricht nur mit der halben Klasse. Das war sehr intensiv. Man kam permanent dran, konnte sich hinter niemandem verstecken. Wir hatten einen tollen Klassenlehrer. Allerdings war die Schule sehr jungslastig, für die Entwicklungsphase nicht ganz so schön. Aber das wurde dadurch ausgeglichen, dass in dem Gebäude noch eine normale Schule war. Wir legten schon in der 11. Klasse die Abiturprüfung ab. In der 12. Klasse bekamen wir Zusatzstoff. Von dieser guten Ausbildung habe ich lange gezehrt. Das erleichterte auch meinen Start im Studium deutlich. Ich habe biomedizinische Kybernetik und Bionik in Ilmenau an der heutigen Technischen Universität studiert.
Während der Schulzeit hatte ich mit meinem Vater viele intensive Debatten über sehr unterschiedliche Sichten auf die Welt, es waren sehr politische Diskussionen. Ich habe ihn bestimmt oft genervt, aber er hatte viel Geduld. Ansonsten haben wir uns immer gut verstanden. Das ist vielleicht so ein Reflex, wenn das Elternhaus konservativ ist, tickt man als 14- und 15-Jähriger erst mal anders. Dazu kam, dass ich die Schule gut fand und an den Sozialismus glaubte; mein Vater war aber anders drauf.
Am 21. August 1968* zum Beispiel, in den Schulferien, lag ich früh noch im Bett. Er musste aber ins Krankenhaus, riss die Tür zu meinem Zimmer auf und sagte: »Mach mal das Radio an, damit du hörst, was deine Kommunisten gerade in Prag anrichten.« Als ob ich daran schuld wäre. Andererseits hat er dafür gesorgt, dass ich alles erhielt, was es in der DDR zu lesen gab, Horizont, Sonntag, Junge Welt bis hin zur Neuen Zeit. Er kaufte das alles. »Du sollst alles wissen und irgendwann wird dir schon ein Licht aufgehen.« Hinzu kommt, dass meine beiden Großväter sehr prinzipientreu waren. Der eine aus Nordhausen, überzeugter Sozialdemokrat, ist 1933 arbeitslos geworden, war dadurch bis 1945 ein verfemter in Nordhausen, hat dort 1945 für den Landtag kandidiert, ist als Sozialdemokrat Chef der Arbeitsverwaltung geworden, Nachdem er sich mit Ulbrichts Leuten überwarf, war er ab 1952, 1953 wieder verfemt. Das prägt natürlich. Uns hat er als Kinder damals in den 1960er Jahren sehr beeindruckt. Zu seinem Geburtstag wollte sich die Kreisleitung*, weil er immer noch einen Namen hatte, wieder versöhnen nach dem Motto: »War ja alles nicht so gemeint« und stand mit einem Präsentkorb vor der Tür. Er hat durch seine Frau ausrichten lassen: »Ulbrichts Leute kommen mir nicht über die Schwelle, schick die wieder weg.« Meine Eltern erstarrten und wir Kinder waren über einen so renitenten Großvater stolz.
Ich habe meine erste Frau im Studium kennengelernt. Sie kam aus Thüringen und hatte auch diese Studienrichtung gewählt. Wir bekamen im letzten Studienjahr Zwillinge. Weil es noch keine Kita und Krippenversorgung gab, bekamen wir einen Sonderstudienplan und eine Studienverlängerung. Das Studium organisierten wir nach einer Art Wechselmodell. Immer einer blieb bei den Kindern, der andere ging zum Studium, und so wechselten wir uns ab. Das ging gut und hat dazu geführt, dass wir in dieser Zeit sehr intensiv mit den Kindern zusammen waren. Später zogen wir über die Absolventenvermittlung nach Karl-Marx-Stadt. Der Anreiz war, dass es dort eine Vierraumwohnung gab. Ich fand im Bezirkshygieneinstitut Arbeit im Bereich der Lufthygiene. In Karl-Marx-Stadt ist unsere dritte Tochter geboren, die heute in Schweden lebt und noch ganz stolz ist, dass in ihrem Ausweis als Geburtsort Karl-Marx-Stadt steht. Damit kann sie die Leute immer sehr erheitern. Unsere Kinder waren dort leider sehr oft krank, Bronchialkatarrh, der HNO-Arzt sagte: »Kein Wunder, bei der Luft hier.« Es hieß nicht umsonst Ruß-Chemnitz*. Wir sind nicht mehr nach dem Kriterium Wohnungsgröße, sondern nach Luftreinheit umgezogen und fanden auf der Landkarte Bad Freienwalde. Dort konnten wir mitten im Wald wohnen. Ich hatte mich eigentlich im dortigen Kreiskrankenhaus als Medizintechniker beworben. Beim Einstellungsgespräch schlug man mir jedoch vor, Direktor für Ökonomie und Technik zu werden. In so jungen Jahren bin ich das geworden, weil das so weit draußen, jwd*, lag und kein großer Andrang war.
Dann zog es uns aber wieder nach Potsdam. Dort arbeitete ich von 1982 bis 1990 als Abteilungsleiter für Umwelthygiene. In den 1980er Jahren bin ich auch immer mehr zur Politik gekommen. Der erste und deutliche Riss in meinem an sich gut gefügten Weltbild kam 1976 mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann. Übrigens nicht, weil ich ein Fan seiner Lyrik oder Lieder gewesen wäre, sondern weil mich mein Land enttäuschte. Ich habe die Ausbürgerung als ein Zeichen von Schwäche gesehen, nach dem Motto: »Wenn man so einen nicht aushält, wie ist dann die innere Verfassung?« Einem zu verweigern, in sein Land zurückzukommen! Der endgültige Riss entstand für mich, als 1979 im Dezember die Sowjetunion in Afghanistan einmarschierte. In Prag hieß es noch: »Wir müssen hier in Europa den Sozialismus verteidigen.« Obwohl das auch vorgeschoben war. Aber der Einmarsch in Afghanistan war blanke Geo- und Machtpolitik und nichts weiter.
Nachdem meine Eltern ausgezogen waren, wohnten wir wieder in unserem Elternhaus in Potsdam, am Wasser. Das war sehr schön, vor allem für unsere Kinder. Nach unserer Scheidung habe ich eine Wohnung in Babelsberg gefunden und sie Ende der 1980er Jahre ausgebaut. In der Wohnung lebe ich heute noch. Hier saß ich oft mit Freunden zusammen; wir hatten damals irgendwie viel mehr Zeit als heute. Es gab weniger Ablenkung und wir saßen abends im Küchenraum, aßen, debattierten und tranken schlechten Rotwein, was wir aber damals nicht wussten. Und wir verbesserten dabei natürlich immer die Welt. Alle hatten zwei, drei oder vier Kinder und fragten sich, was werden uns unsere Kinder in zehn oder 15 Jahren einmal fragen, genauso wie wir unsere Eltern löcherten, was sie gemacht, wie sie sich verhalten hatten und ob sie alles geschehen ließen.
Auf der Basis solcher Diskussionen teilte sich in gewisser Weise unser Freundeskreis. Eine Spaltung in diejenigen, die sagten, wir sehen für unsere Kinder keine Perspektive mehr in diesem Land, das zerfällt, wird knöchern, Mehltau breitet sich aus. Das fühlte man. Die haben Ausreiseanträge gestellt, Botschaften mit besetzt, was damals so anfing. Die anderen, zu denen gehörte ich, protestantisch geprägt, sagten: »Da, wo man hingestellt ist, da sollte man bleiben.« Und wir wollten versuchen, was zu ändern. Einer unserer Freunde hatte 1987 gerade eine Abschlussarbeit über die Geschichte des Belvedere in Potsdam geschrieben. Ein Schloss, ohne Kriegsschäden, was völlig verfallen war, nur weil es mitten im russischen, abgegrenzten Teil lag. Außerdem konnte man von da oben nach Westberlin gucken, sodass man es wie das Dornröschenschloss zuwachsen ließ. Das war ein Kulturschatz. Also machten wir uns einfach daran, trafen uns jede zweite Woche am Wochenende, stellten die Parkanlage wieder her und dachten: »In 20 Jahren bauen wir das Ding wieder auf.« Das hat zur Gründung der ersten Interessengemeinschaft Pfingstberg* geführt mit 25 jungen Leuten, die sich immer wieder trafen und dort arbeiteten. Das Verrückte war, dass ich das bis heute als ein Zeichen empfinde, was in unserem Land eigentlich los war. Wir fühlten und verstanden uns nicht als Opposition im klassischen Sinne, sondern wir wollten was verbessern. Die Staatssicherheit hat daraus, »politisch negative Elemente« gemacht. Die sind ab und zu hochgekommen und haben komische Fragen gestellt. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass Leute freiwillig und ohne Geld so etwas machten. Ein Teil dieser Truppe und andere junge Leute haben 1988 im April die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz und Stadtgestaltung in Potsdam gegründet. Das war schon etwas politischer gemeint. Bei mir kam hinzu, dass ich beruflich viele Daten für Boden, Wasser und Lärm hatte. Und wir stellten immer mehr fest, wie unsere Lebensgrundlagen den Bach runtergingen, wie die Bausubstanz unserer Heimatstadt teilweise unwiederbringlich zerfiel. Und dann sollte noch die barocke Innenstadt abgerissen und durch Plattenbauten ersetzt werden. Da haben wir, die ›Hierbleiber‹, gesagt: »Das kann es nicht sein.« Es war wie ein Signal. Die erste Straße ist ja auch noch abgerissen worden. 1989 konnten wir den Fortgang der Dinge stoppen. Bürger fingen an, sich zu artikulieren und zu wehren. Wir haben in dieser Arbeitsgemeinschaft im April 1989 ein erstes DDR-weites Treffen veranstaltet. Das war damals sehr mühsam. Es gab kein Internet, kaum Telefon. Über 20 Gruppen aus der ganzen DDR, die ähnliches gemacht haben, aus Schwerin, Erfurt, Leipzig, Dresden, hatten wir nach Potsdam eingeladen. Das erregte viel Aufsehen und wurde strengstens beobachtet. Daraus bildete sich ein Netzwerk, aus dem sich ein halbes Jahr später, im Herbst, die Grüne Liga* gründete. Meine erste Aufgabe in diesem Verbund war es, ein Informationsnetzwerk aufzubauen. Das sah man damals als sehr verdächtig an, weil nur der Staat verantwortlich für Information war und niemand anderes. Ihr Denkmodell war: »Wenn die Potsdamer glauben, dass es in ihrer Stadt bergab geht, ist das schon nicht gut. Wenn die aber erfahren und diskutieren, dass es in den 20 anderen Städten ähnlich läuft, dann wird daraus was Gefährliches.«
Die Dinge nahmen ihren Lauf. Wir haben am 7. Oktober 1989 zum 40. Jahrestag der DDR ein zweites DDR-Treffen angemeldet. Das ganze Dachgeschoss unseres Besprechungsgebäudes war von der Staatssicherheit besetzt, um uns zu beobachten. Das bekamen wir mit. Sie konnten aber das Zusammentreffen von Abgesandten aus den Städten nicht verhindern, obwohl sie es versucht hatten. Nur die Leipziger kamen nicht, denn die hatten zu Hause eine Menge mit der Vorbereitung der großen Demonstration am 9. Oktober zu tun. Unsere in der Nacht verfasste und von allen verabschiedete Erklärung hat die Oberen sehr beunruhigt, weil sie mit dem Satz begann: »In einem solchen Land wollen wir nicht länger leben.« Wir wollten immer noch einen anderen Sozialismus, an anderes wurde noch gar nicht gedacht. Die Resolution schafften wir nach Berlin zu dieser und jener Zeitungsredaktion. Später konnte man in den Stasiakten lesen: »feindlich negative Elemente heizten die Stimmung an.« Dabei war die Debatte so ernsthaft, so gründlich, so ehrlich, aber das war schon zu viel. Am 7. Oktober wurden in Potsdam bei einer Demonstration sehr viele, auch einige unserer Gäste, festgenommen. Es war brutal, sodass wir dachten: »Das kann es nicht sein, so kann es nicht gehen. Warum reden die nicht mit uns?« Wir waren alles junge Leute und keine doofen, arbeiteten alle. In diesen Tagen hat die DDR ihren letzten Kredit verspielt. Bei mir kam noch ein persönliches Ereignis hinzu. Ich hatte Freunde in Ungarn und die haben wir Anfang September besucht. Man konnte dort bereits freier atmen, offen debattieren und zum Beispiel alle denkbaren Zeitungen kaufen. Als wir in Budapest ankamen, summte und wimmelte es von DDR-Bürgern und abgestellten Trabants – keiner von denen wollte mehr nach Hause zurück. Der ungarische Außenminister Horn sprach am 10. September im ungarischen Fernsehen und unsere Freunde übersetzten: »Ihr könnt ab 24:00 Uhr mit euren Personalausweisen nach Österreich fahren.« Plötzlich standen wir vor einer grundsätzlichen Entscheidung, denn wir wussten ja nicht, ob wir jemals wieder zurückkommen konnten. Das hatte etwas von endgültigem Abschied. Erstmalig dachte ich so, mit Mitte 30, über den Begriff Heimat nach. Und da habe ich gesagt: »Nein, wir gehören da hin, wo wir hingehören.« Wir sind ins Flugzeug nach Hause gestiegen, das war fast leer, weil so viele geblieben sind.