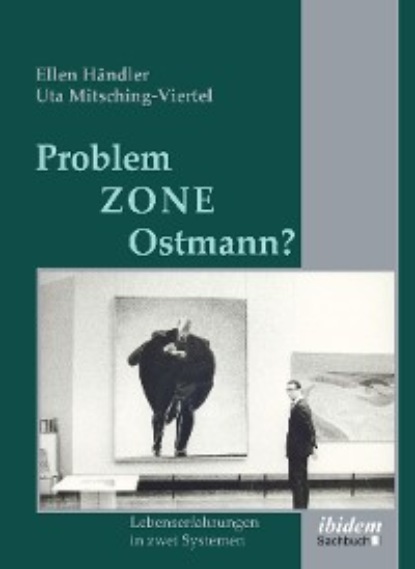- -
- 100%
- +
Drei Tage später wussten wir, dass wir alles richtig gemacht haben, denn es fingen die Unterschriftensammlungen für das Neue Forum* an. Wir machten mit und waren am 4. Oktober auf dem Weberplatz in Babelsberg bei der ersten großen Kundgebung mit mehr als 3.000 Leuten dabei. Das war noch vor Berlin, vor Leipzig. Die Bereitschaftspolizei wusste, dass sie stattfindet, und wollte die Kundgebung auflösen, hatte allerdings nur mit 300 bis 400 Leuten gerechnet. Als die Meldung kam, dass bereits 3.000 Leute da waren, hat der Einsatzleiter die Leute in die Kaserne zurückgeschickt. Bei nicht wenigen Funktionären gab es da wohl schon die Gedanken im Kopf, dass es so nicht weitergehen könne.
Dann ging es Schlag auf Schlag. Wir konstituierten im November die Grüne Liga*. Ich wurde einer ihrer Sprecher und an den Zentralen Runden Tisch in Berlin delegiert. Das war eine sehr spannende, eine sehr demokratische, aber auch sehr wilde Phase. Hier kam alles zusammen: die alte Macht und die noch nicht formierte neue Macht, die neuen Bewegungen und die alten Parteikader. Auf der dritten Seite saß Hans Modrow* mit seiner Übergangsregierung, irgendwie in einer schwierigen Zwitterstellung. Der Runde Tisch hatte drei sehr gute Kirchenvertreter als Moderatoren, die immer wieder dämpften und ordneten. Das war sehr bewegend, weil es über diesem Tisch eigentlich nur ein einziges übergreifendes gemeinsames Motto gab: einen Übergang ohne Gewalt und Blutvergießen zu schaffen. Alles andere war different, auch die Ziele. Das rechne ich heute Hans Modrow noch hoch an, dass er das mit organisiert hat. Es waren immerhin noch 400.000 Menschen unter Waffen in der DDR. Und das so zu regeln, nicht wie in Rumänien und anderswo, das fand ich eine beeindruckende Motivation, bei mir sicher auch geprägt durch meine Großeltern.
Der Runde Tisch lief noch, wir bereiteten die Wahlen vor. Dann kamen die Verhandlungen mit Hans Modrow, der dachte, ihm schwimme das Land langsam weg, als er sagte: »Das geht so nicht mehr. Ich erwarte von den neuen Bewegungen, dass sie sich an der Verantwortung beteiligen, sonst könnt ihr das ohne mich machen.« Modrow* hatte damals bei allen hohe Reputation, man wollte auf ihn nicht verzichten. Der Deal war, die für den Mai geplante Wahl in den März vorzuziehen und das Zugeständnis der Bewegung war, dafür mit in die Regierung zu gehen und Verantwortung zu übernehmen.
Ich bin dann in den Westen gefahren, erst zum zweiten Mal. Das erste Mal war ich im Dezember 1989 bei Klaus Töpfer in Bonn. Jetzt ging es an die Evangelische Akademie nach Tutzingen – in eine Traumgegend –, um mit Leuten wie Genscher und Brandt zu diskutieren. Ich freute mich sehr darauf. Man hatte einige DDR-Leute dorthin eingeladen, von denen man dachte, aus denen könnte mal was werden. Ich war ein großer Willy-Brandt-Fan, nun sollte ich ihn aus der Nähe erleben – für mich ein Hochamt. Bevor es losging, wurde ich dort aber an die Rezeption, ans Telefon geholt, denn Handys gab es ja noch nicht. Die junge Grüne Partei der DDR hatte angerufen. »Du musst zurückkommen. Wir haben beschlossen, dass jede Bewegung einen Minister stellen soll. Du sollst für uns Minister werden.« Da habe ich gesagt: »Nein, ich bin gerade angekommen, ich will Willy Brandt hören, versucht, wen anderes zu finden«, habe also rumgezickt. Hinter mir stand ein Journalist vom ZDF, der bekam das alles mit und sagte: »Ich weiß nicht, was dich bewegt, aber auf so einen Anruf wartet man im Westen 30 Jahre und muss dafür hart arbeiten.«
Ich bin zurückgeflogen, habe das schöne Seminar nicht mitgemacht und wurde am nächsten Tag in der Volkskammer vereidigt. Ich hatte noch nicht mal einen passenden Anzug, bin zu nichts gekommen. Vorher brauchte ich keinen, hatte also einen Pullover an. Im DDR-Fernsehen wurde das alles übertragen. Abends rief mich meine Mutter an. »Klar«, dachte ich, denn es war das erste Mal, dass aus unserer Sippe einer Minister wurde. Aber sie sagte nur: »Junge, musste das sein, im Pullover!«
Plötzlich war ich Minister ohne Geschäftsbereich, eine spannende Zeit, in der ich mich u.a. um umweltpolitische Belange kümmerte. Wir besuchten auch die neue Regierung in Polen. Was mich besonders beeindruckte, war, mit Hans Modrow* zu Gorbatschow nach Russland zu fahren. Ich war früher schon mehrmals dort, habe auch mal ein Austauschpraktikum gemacht. Aber was ich dann sah, hat mich erschüttert. Viele arme Menschen auf den Straßen, die Versorgung war inzwischen miserabel, man sah, wie die Menschen in den U-Bahnhöfen den eigentlich verbotenen Alkohol tranken, und der Schwarzhandel blühte. Man hatte das Gefühl, dass das nicht mehr lange gut geht. Ein Jahr später war es ja auch vorbei.
Am 18. März 1990 bin ich für die Grüne Partei in das erste und letzte freigewählte Parlament der DDR gewählt worden. Dass alle Bürgerbewegungen zusammen bei dieser Wahl nur auf fünf Prozent kamen, war ein Schock. Aber viele Menschen hatten sich längst auf einen anderen Weg gemacht, sie wollten die schnelle Wiedervereinigung. Und wir hatten den Draht zu ihnen verloren.
Letztlich bildeten das Bündnis 90, die Grünen, die Frauenbewegung und andere eine kleine Fraktion in der Volkskammer mit 20 Leuten. In ihr fanden sich herausragende Köpfe der friedlichen Revolution wie Wolfgang Ullmann oder Jens Reich*. Ich wurde zum Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt und gehörte so dem Präsidium der Volkskammer an.
Die Regierung unter de Maizière bildete sich und es waren fast alle Parteien vertreten, Liberale, SPD, CDU, DSU, aber zwei Gruppierungen nicht: die PDS* und die Bürgerbewegung. Die eigentlichen Antipoden der Revolution fanden sich also in der Opposition wieder. Ich saß in der Volkskammer neben Gregor Gysi und wir lernten uns dadurch gut kennen. Wir haben viel gearbeitet, viele Gesetze verabschiedet, hatten jeden Tag große Stapel auf dem Schreibtisch. Aber man merkte in Ansätzen, Stück für Stück, dass die Aufbauhelfer aus dem Westen nicht selten sagten: »Lasst uns das mal machen, wir wissen, wie es geht.« Bei uns merkte man das nicht so, aber bei anderen Parteien sehr wohl.
Die Volkskammerzeit war vorbei und wir mussten uns überlegen, was wir mit unserem gerade angefangenen politischen Leben weiter machen. Ich bin in den Bundestag kooptiert worden, fuhr nach Bonn und wusste schnell, egal, was du politisch mal machst: Bonn wird es nicht. Ich kam aus einer Stimmung im Osten mit täglichen Demonstrationen, die Luft brannte, nach der Währungsunion brachen die Betriebe zusammen, die Leute waren auf 180 und manchmal auf 200 – und in Bonn plätscherte ruhig der Rhein vorbei, alles ging seinen normalen Gang. Mein Gefühl war, dass man hier in einer anderen Welt lebte.
Wir, eine Crew aus der Volkskammerfraktion – Günter Nooke, Marianne Birthler und ich –, überlegten uns: »Wir gehen in unser Stammland Brandenburg und treten da in den Landtagswahlkampf ein. Wir machen Wahlkampf als Bündnis 90 für unsere Vorstellungen aus der friedlichen Revolution.« Wir verabredeten uns für den Wahltag abends in einem Café. Wir wollten uns verabschieden und jeder in sein berufliches Leben zurückgehen, nur eben nicht kampflos, sondern einen Schlusspunkt setzen. Dann kam das Wahlergebnis, und siehe da: Die Grünen, sie kandidierten gegen uns, kamen nicht in den Landtag, aber das Bündnis 90. Also mussten wir uns am Abend wieder umorientieren. Wir stellten eine Fraktion mit sechs Leuten im neugewählten brandenburgischen Landtag. Wir gingen in Koalitionsverhandlungen mit der SPD unter Manfred Stolpe und der FDP. Daraus wurde die erste Ampelkoalition von 1990 bis 1994 und ich wurde Minister für Umweltschutz und Raumordnung.
Jedes Bundesland hat ein Partnerland, wir Nordrhein-Westfalen. Und NRW hatte alles für Brandenburg durchgeplant. Vor allem das Personelle. Ich hatte mich als Umweltminister in den ersten Tagen nach einem Staatssekretär umgetan, der sich in der EU und ihren Regularien auskannte. Vor Monaten hatte ich jemanden kennengelernt, der Sekretär des Umweltausschusses des Parlaments war, wir verstanden uns, und ich fragte ihn, ob er nicht für vier Jahre Lust hätte, mein Staatssekretär zu werden. Er sagte zu, war allerdings in der CDU. Der frischgebackene Chef der Staatskanzlei holte mich zum Gespräch. Er wählte dabei schon den falschen Anfang: »So, junger Mann, nun setzen Sie sich mal.« Ich sagte: »In dem Duktus wollen wir mal nicht weitermachen, wir sitzen hier auf gleicher Augenhöhe.« Wahrscheinlich war ich ihm suspekt. Er sagte: »Du kannst es ja machen, wie du dir das politisch vorstellst, aber ein CDU-Staatssekretär in der SPD-Regierung, das geht gar nicht. Und außerdem haben wir da bereits jemanden vorgesehen.« Ich habe gesagt: »Mein Lieber, das kann alles sein. Ich berufe diesen Staatssekretär, und der Ministerpräsident muss entscheiden, ob er das anders will. Dann muss er sich aber einen anderen Minister suchen.« Ich habe den Staatssekretär berufen. Heute würde ich natürlich auch sagen, dass Parteibindung eine Rolle spielt. Damals war ich eben trotzig.
Meinen Startvorteil bildeten die gute Ausbildung in der DDR und acht Jahre Arbeit im Umweltschutz. Ich war also fachlich recht gut vorbereitet. Die 1990er Jahre waren vom ersten Tag an eine unheimlich spannende, aufregende Zeit. Wenn ich früh kam, wusste ich nie, was abends war. Die Zeit hielt für unzählige Menschen große Härten bereit. Wir haben oft im Kabinett besprochen, welche Betriebsschließungen wieder zu verkünden seien und wer dorthin fahren würde. Es war frustrierend, weil man als Politiker den Menschen Hoffnung geben will. Man musste zu vielen Gelegenheiten sagen: »Es tut mir leid, ich kann euch nicht mal sagen, dass etwas Neues entsteht.« Und wir sagten auch: »Wenn ihr noch jung seid, sucht euch im Westen etwas, hier wird so schnell nichts Adäquates da sein.« In dieser Zeit verlor ich einen Teil meiner Haare. Für Fragen von Umwelt- und Naturschutz war zwar die Zeit nicht geeignet, weil die Leute andere Sorgen hatten, andererseits konnten wir sehr viel für den Landschafts- und Naturschutz in Brandenburg tun, was in einer nur mit Juristen besetzten Verwaltung vielleicht gar nicht mehr so gelungen wäre. Damals ging das noch.
Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich zwei Systeme erlebt habe, weil das Leben sich in Relationen abspielt und der Mensch Alternativen braucht und sie kennen sollte. Da ich 35 Jahre in dem einen System und bereits 30 Jahre in dem anderen gelebt habe, fällt mir der manchmal nötige Perspektivwechsel nicht so schwer.
Das Fazit für mich ist klar: Ein System, das aus Menschen quasi per Verordnung bessere Menschen machen will, kann nicht funktionieren. Einer meiner Hauptvorwürfe an die DDR ist: Freiheitsbeschneidung und Kreativitätsbegrenzung. Das macht jedes Land am Ende kaputt. Damit hat man auch den Grundgedanken einer sozialistischen Gesellschaftsordnung, Gerechtigkeit für alle, Verteilung der Güter nach Möglichkeiten und Bedürfnissen, kaputt gemacht. Ich schätze heute an unserer Gesellschaft sehr, dass sie Liberalität aufweist, dass Menschen so, wie sie sein wollen, es materiell auch sind, sein können. Ich schätze nicht, dass wir zunehmend zulassen, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr öffnet und deshalb die Freiheitsmöglichkeiten, die die Gesellschaft bietet, viele gar nicht nutzen können. Ich finde den Grundgedanken einer sozialen Markwirtschaft richtig, zu balancieren, wie man die Triebkräfte der Gesellschaft voranbringt. Die Menschen brauchen die Möglichkeit, eigene Ideen anzugehen. Auf der anderen Seite muss eine Begrenzung da sein. Helmut Schmidt hat einmal gesagt: »Ein Kapitalismus, der keine Begrenzung hat und nicht kontrolliert wird, wird automatisch zum Raubtierkapitalismus.« Gesellschaftsorganisation unter freiheitlichen Bedingungen ist eine Sisyphusarbeit. Der Stein ist unten, du musst ihn wieder hoch rollen, dann rollt er wieder runter, und du musst ihn wieder hochrollen. Bis vor kurzem hatten wir die neoliberale Phase, zum Beispiel die Privatisierung vieler öffentlichen Güter. Vieles davon bereuen wir heute wieder. Es ist bedauerlich, dass wir so eine Phase immer wieder brauchen. Ich glaube, der Kapitalismus hat sich durch den gefühlten Mitbewerber, das sozialistische Lager, besser benommen, weil er wusste, dass er sich beweisen muss. Als das weg war, konnte man noch mal dem neoliberalen Affen richtig Zucker geben. Das hat sich nicht unbedingt positiv ausgewirkt.
Dass ich 1995 Sozialdemokrat wurde, war durch Vater und Großvater mitgeprägt. Mein Vater war mit seinen DDR-Erfahrungen an sich dagegen, dass ich in eine Partei gehe. Er sagte: »Aber wenn du das schon machst, versuche wenigstens, ihr Vorsitzender zu werden.« Habe ich versucht. Es hat im Land Brandenburg für 13 Jahre geklappt. Im Bund gab es leider gesundheitliche Begrenzungen. An der Sozialdemokratie finde ich so faszinierend, dass es, wie Willy Brandt einmal sagte: »Hier ein donnerndes Sowohl-als-Auch gibt.« Nichts Extremistisches, immer neu denken an den sich wandelnden Interessen möglichst vieler Menschen entlang – schwierig, aber sinnvoll.
Was mir in unserer gesellschaftlichen Entwicklung im Moment fehlt, ist die Liebe zum Kompromiss. Wir sind sehr absolut geworden. Es gibt viele widerstrebende Interessen, und wenn Demokratie einen Sinn haben soll, hat sie ihn dann, wenn man aus den vielen Interessen versucht, am Ende einen Kompromiss zu formulieren, mit dem alle einigermaßen leben können. Der Hauptvorwurf, der immer gemacht wird, ist, dass das alles so lauwarm ist. Da entgegne ich als Naturwissenschaftler: Der Mensch lebt bei 37 Grad Körpertemperatur, bei 42 Grad ist er tot, bei 32 Grad auch.
Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass die Seele der Demokratie die Liebe zum Kompromiss ist. Bei allem, was ich jetzt mache, die Beziehungen zu unserem russischen Nachbarn im Deutsch-Russischen Forum zu pflegen, Aufgaben in der Kohlekommission oder in der Einheitskommission wahrzunehmen, versuche ich immer zu vermitteln. Das Leben spielt sich meist in der Mitte von allem ab. Wir müssen versuchen, uns diese Fähigkeit zu erhalten. Die Fähigkeit des Zuhörens- und Verstehen-Wollens nicht zu verlernen, ist nicht lapidar. Ich möchte, wenn ich in eine Diskussion gehe, danach an zwei, drei Stellen klüger geworden sein – sonst war es Verschwendung von Lebenszeit.
Eduard, Jahrgang 1953 | 2 Kinder, verheiratet in erster Ehe
Ost: Gießereitechniker, West: Selbstständig, Inhaber einer Versicherungsagentur
Dipl.-Gießereiingenieur, Parteifunktionär
Geschäft und Geld sind im Westen
immer das Wichtigste
Ich bin Eddi, geboren 1953 in Döbeln in Sachsen. Heute lebe ich in einer anderen Stadt, aber auch in Sachsen. Ich bin verheiratet in erster Ehe und habe zwei Kinder. Nach der Grundschule machte ich eine Lehre als Gießereitechniker, arbeitete ganz normal in einem Betrieb, und bin nach fünf Jahren Fernstudium Gießereiingenieur geworden. In der Zeit als Technologe war ich in der FDJ* ehrenamtlich tätig. Ich bin zur FDJ-Kreisleitung* gegangen und wurde dort Sekretär. Ich war für die Arbeiterjugend zuständig. Nach zwei Jahren delegierte man mich zur SED-Kreisleitung* mit Zuständigkeit für Jugend und Sport. Später kam die Parteihochschule in Berlin dazu, und ich machte noch mal ein Direktstudium für drei Jahre. Das war kurz vor der Wende. Ich wurde zum sogenannten Kreisbeschleuniger* für den Kreis G. ernannt.
Ich war oft auf Foren, da wurde im Osten in den letzten Jahren auch über die Umwelt gesprochen. Vor allem bei jungen Leuten. Ebenso spielte die körperliche Arbeit eine größere Rolle. Sie war hoch anerkannt, vor allem der Arbeiter. Der hat auch mehr verdient. Als ich Technologe war, verdiente ich weniger als der Arbeiter, das war so gewollt. Alkohol wurde an allen Orten getrunken und war gesellschaftlich weit verbreitet – aus heutiger Sicht zu viel. Ich hatte damit kein Problem und lag so im Durchschnitt. Heute sieht man das bewusster. Ich liebe einen guten Rotwein, auch einen guten Kognak oder Whisky, aber zum Genießen und nicht zum Betrinken.
Man merkte, dass die Wende im Gange war. Es gab Demos, das Neue Forum* existierte und war sehr aktiv. Als das Sekretariat der Kreisleitung der SED zurücktrat, gab es eine große Versammlung, und es wurde über das Neue Forum geredet: Was das ist, was für Leute dazu gehören. Von den alten Parteimitgliedern konnte keiner darüber Auskunft geben – oder sie wollten nicht. Ich habe mich zu Wort gemeldet, vor allem, da ich vieles wusste. Und so bin ich dann der letzte erste Sekretär der Kreisleitung* geworden. Ich bin sozusagen über Nacht wie die Mutter zum Kind in diese Funktion gekommen. Dann kamen die Sonderparteitage in Berlin, und es kam zur Gründung der PDS*. Nun wurde ich hier im Kreis deren erster Vorsitzender. Nach zwei Jahren gab es eine große Gebietsreform, in der die Kreise zusammengelegt wurden. Unser Kreis verschwand von der Landkarte. Meine Aufgabe war damit beendet, ich baute Bestände und Personal ab. Als Abgeordneter sah ich recht schnell, dass hauptamtliche Mitglieder der SED keine Chance mehr hatten.
Ich überlegte lange, was ich machen sollte. Es war eine wilde Zeit. In die alten Räume zog eine Videothek ein, und ich dachte, dass das nicht schlecht sei und ich so immer genügend Filme gucken könnte. So bin ich Videotheksbetreiber geworden. Die Videothek war zwar gut besucht, denn nach der Wende wollte jeder erst mal Videos schauen, das war neu. Aber die Filme waren oft durchwachsen. Ich stellte deshalb relativ schnell fest, dass das nicht mein Ding war und ich das nicht bis zur Rente machen wollte. Ich wohnte weiter weg und fuhr täglich mehrere Kilometer bis nach Hause. In der Videothek hatte ich immer viel Zeit zum Nachdenken, und so fragte ich mich: »Was braucht man in dieser neuen Gesellschaft, was ist wichtig? Was interessiert die Menschen?« Ich kam zu der Erkenntnis, dass dies vor allem Geld war, darum geht es immer. Banker konnte ich nicht werden, denn dazu hatte ich keine Ausbildung. Aber was passierte? Nach der Wende kamen gleich die ersten Versicherungsvertreter, sagten: »Wir sind die Größten und ihr könnt bei uns arbeiten.« Die haben gezielt die Leute gesucht, die wieder viele andere kannten, und ich kannte viele. Versicherung klang also nicht schlecht, fast so gut wie Bank, und so machte ich jetzt einfach das. Ich habe bei einer Versicherung, einem Strukturvertrieb, angefangen, leider einem der übelsten Sorte. Da fängt man ganz klein an und muss sich hocharbeiten. Das habe ich circa zwei Jahre gemacht. Die Materie hat mich interessiert, ein weites Feld, und ich kam mit vielen Menschen zusammen, das hat mir gefallen.
In der Arbeit hatte ich ein sehr offenes, sachliches Verhältnis mit den Wessis. Ich hatte nicht das Gefühl, jemand dritter Klasse zu sein. Natürlich musste ich lernen, und man hat versucht, mir etwas beizubringen. Aber es hat mich damals verwundert und auch abgestoßen, dass das Geschäft und das Geldverdienen am wichtigsten war – noch bevor man uns erklärt hat, wie zum Beispiel eine Hausratversicherung funktioniert. Zwei Stunden wurden zu Beginn darauf verwendet, uns beizubringen, wie viel Geld wir eigentlich verdienen könnten, wenn wir es denn wollten.
Der Spruch »Ihr werdet alle eure Freunde verlieren, aber ihr werdet Millionäre werden« ist in diesem Geschäft eine Grundhaltung. So hat man uns versucht, zu motivieren, bei Laune zu halten. Meine damalige Vorgesetzte hat mich einmal eingeladen und wir haben zusammen eine Fahrradtour gemacht. Wenn ich unterwegs war, konnte ich bei ihr übernachten, im Kinderzimmer. Wir frühstückten zusammen, also ein recht ordentliches Verhältnis. Ich war nie Bürger zweiter Klasse, aber dennoch immer sehr auf das Geschäft ausgerichtet. Direkt gesagt, dass wir erst einmal richtig arbeiten lernen müssten, hat man nicht. Aber: »Die Ossis müssen sehr viel lernen, sie müssen in dieser neuen Gesellschaft ankommen, die sind nicht geeignet, können das nicht wissen, sie kommen aus der Diktatur heraus in eine freie Gesellschaft. Das ist für jeden schwer und für den Ossi besonders«, das sagten sie schon. Da war immer der Hintergedanke: Wir wollen mit ihm Geschäfte machen, er soll für uns Geld verdienen. Insofern hat man nicht gesagt: »Du bist ein Doofer«, sondern: »Du musst lernen.« Ich habe das erwartet, mich aber auch nie unter den Tisch verkrochen. Ich hatte ein gewisses Selbstbewusstsein. Man kann nicht alle Wessis über einen Kamm scheren. Es gab arrogante Menschen, von sich eingenommen, die haben genauso über uns Ossis geredet, und es gab Wessis, mit denen konnte man gut und vernünftig zusammenarbeiten, die haben den Wessi nicht raushängen lassen. Die haben versucht, zu helfen, uns zu verstehen, aber das waren die wenigsten. Die meisten haben gesagt: »Wir sind hier und ihr müsst euch anpassen. Nicht umgekehrt.«
1980 habe ich geheiratet. Meine Frau war immer voll berufstätig. Sie hat am Anfang in der Sparkasse gearbeitet, dann beim Rat des Kreises* in der Kultur und nach der Wende ist sie im Rathaus in der Verwaltung geblieben, wurde übernommen. Das war für mich gut, denn in der Zeit, in der ich die Videothek hatte, hat sie mehr verdient als ich. Zu DDR-Zeiten habe ich immer mehr verdient als sie. Arbeiter, drei Schichten sowieso und als Technologe auch. Nach der Wende hat sie lange die Familie getragen. Für mich war das kein Problem. Die Männer in der DDR hatten nie eine Ernährerrolle. Wir waren gleichberechtigt. Meine Frau hat das Meiste gemacht. Als ich in Berlin zum Direktstudium war, lag alles auf ihren Schultern. Ich war nur am Wochenende da. In der übrigen Zeit holte ich auch mal die Kinder ab und wir versuchten, uns die Dinge einzuteilen. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass das Meiste auf ihren Schultern lastete. Ich war auch zu DDR-Zeiten abends und an den Wochenenden viel unterwegs. Meine Frau hat sich nie benachteiligt gefühlt, wir besprachen alles gemeinsam. Ich habe nichts gemacht, was meine Frau nicht hätte mittragen wollen. Es waren nicht nur Entbehrungen, das wäre falsch. Wir haben Vorteile gehabt. Ich hatte Arbeitszeiten, bei denen ich zwischendurch auch mal einkaufen gehen konnte. Das war eine schöne Arbeitsteilung. Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, dass wir noch jung waren, vorankommen wollten. Meine Frau hat sich nie beschwert, aber es war manchmal hart. Meine Kinder haben auch nie gemault. Wir haben Wochenenden und Urlaube gemeinsam verbracht. Wir empfanden in dem Augenblick den Stress nicht so. Es war immer nur die Frage, mache ich das oder mache ich das nicht. Mich hat in der DDR niemand zu etwas gezwungen. Wenn ich heute noch mal alles so machen sollte, würde ich es wahrscheinlich gar nicht hinkriegen.
Meine Kinder sind immer gerne in den Kiga gegangen, und meine Enkel tun das heute auch. Man kann natürlich nicht alles 1:1 im Verhältnis damals zu heute umsetzen. Aus meinen Kindern ist was geworden, die waren nie auf der schiefen Bahn, die haben ordentliche Berufe und Studium, haben Familie, Kind und Karriere, sind beide voll berufstätig. Sie bekennen sich dazu, dass ihre Kinder in den Kiga gehen. Mein kleiner Sohn hat drei Kinder und viele Dienstreisen durch die ganze Welt. Seine Frau ist Ärztin. Die stehen beide also voll im Beruf. Auch wenn wir als Großeltern unterstützen. Wichtig ist, dass die Kinder solche Werte wie Zuverlässigkeit leben, sich nicht verbiegen, zu dem stehen, was sie machen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Ostmänner etwas wehleidiger sind, aber das ist nur ein Gefühl. Wir haben früher gemeint, dass wir gesund sind und gesund bleiben. Das ändert sich mit dem Alter und weniger mit der Gesellschaft. Wir haben früher über die Gesundheit nicht viel nachgedacht. Der Westen denkt mehr darüber nach. Zumindest heute. Früher wurde mehr Fleisch gegessen. Der Fleischkonsum war bestimmt gigantisch. Das schmeckt ja auch gut und war immer eine Delikatesse. Die Essgewohnheiten waren andere. Das hat sich angenähert. Wenn ich in den Westen fahre, wird da genauso gegrillt wie bei uns.
Der Westmann, ich habe immer mit ihnen zu tun, ist heute ein anderer. Wenn ich an die erste Zeit nach der Wende denke, war es üblich, dass der Wessimann der Ernährer war, das Familienoberhaupt, das Geld verdient. Das war weit verbreitet, ist aber heute nicht mehr so. Da gab es Annäherung. Eine Wandlung ist auf beiden Seiten erfolgt. Die Wessis sind von uns beeinflusst worden. Ganz spurlos ging die Entwicklung bis heute auch nicht an ihnen vorbei. Der Ostmann hat nach der Wende viel in den Westen eingebracht.
Seit 2004 habe ich eine eigene Firma. Wir arbeiten mit vielen westdeutschen Versicherungen, da ist das Verhältnis jetzt auf Augenhöhe. So wie wir uns dort einbringen, kommt es zurück. Das Verhältnis hat sich total verändert gegenüber der ersten Zeit, als ich dabei war. Die Akzeptanz unter Geschäftspartnern ist heute vorhanden. Nicht mehr von oben herab, mehr wohlwollend, großväterlich.