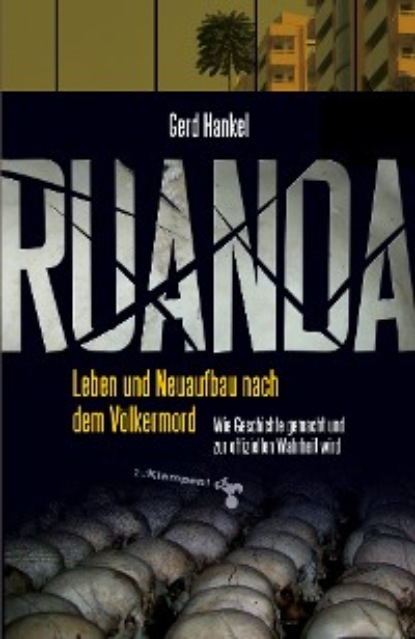- -
- 100%
- +
Der Sekretär notiert die Namen der eben Beschuldigten, um sie später mit den Listen Inhaftierter abgleichen zu können. Die Frau in Alltagskleidung sitzt immer noch neben den drei Angeklagten, als der Gerichts-Vorsitzende sich ihr zuwendet, ihren Namen – Agnès A. – nennt und sagt, dass sie an der Ermordung von fünf Tutsi beteiligt gewesen sein soll. Er verliest die Namen der Ermordeten – sie scheinen in Gishamvu bekannt gewesen zu sein – und fragt, wer zu einem der Fälle etwas sagen könne. Das können sehr viele. Etliche Zeugen melden sich und erzählen, was sie von den Morden wissen. Niemand jedoch beschuldigt Agnès A. Andere Namen fallen und werden wieder von dem Gerichtssekretär notiert, der von Agnès A. ist nicht darunter. »Ich bin unschuldig«, sagt sie. »Ich bin nicht mal in der Lage, rohes Fleisch zu kaufen und zuzubereiten, wie soll ich dann einen Menschen getötet haben. Was mir vorgeworfen wird, ist falsch. Ich kann schon deshalb nichts gemacht haben, weil mein rechter Arm während des Völkermords gebrochen war.«
Vereinzelt ist zustimmendes Murmeln zu hören, das aber folgenlos bleibt. Weder wird Agnès A. freigelassen, noch ist von den Richtern ein Hinweis auf einen in dieser Sache zu treffenden Entschluss zu hören. Über vier Stunden Verhandlung in der nachmittäglichen Hitze fordern ihren Preis. Einige Richter haben erkennbar Mühe, wach zu bleiben oder konzentriert zu wirken. Überhaupt ist die Atmosphäre ganz anders, als man angesichts der zur Sprache gebrachten Tatvorwürfe vermuten sollte. Schon vor Beginn der Verhandlung findet ein reger Austausch zwischen den Angeklagten und Männern und Frauen aus der Dorfbevölkerung statt. Auch während der Verhandlung gibt es Zurufe und Gelächter, und was aus den Gesichtern der vielen spricht, die schweigend zusehen, kann nur gemutmaßt werden. Sie sitzen dort und lassen keine Gefühlsregung erkennen. Es ist, als ob sich vor ihren Augen ein Spektakel abspielt, das ein fernes Ereignis betrifft und in dem nur der Zufall darüber entscheidet, wer in anderer Kleidung auf der anderen Seite sitzt. So gesehen passt es zum Gesamteindruck, dass plötzlich ein heftiger Regen einsetzt und alle, ohne Instruktionen des Gacaca-Vorsitzenden abzuwarten, nach Hause eilen.
Fragte man Zoulfaty M. nach den Gründen für diese eigenartige Atmosphäre in Gishamvu, die auch bei den nächsten wöchentlichen Gacaca-Verhandlungen festzustellen war, antwortete sie ohne zu zögern, dass in Gishamvu wohl Täter, Mitläufer und Gaffer über sich selbst zu Gericht gesessen hätten. Überlebende des Völkermords dürften nicht dabei gewesen sein, denn dann wären die Verhandlungen anders verlaufen. Zoulfaty M. ist Tutsi, knapp über 30 Jahre alt und Gacaca-Richterin in der Gemeinde Huye in der Nähe von Butare. Den Völkermord hat sie in Kigali überlebt, in einem Kellerraum, zusammen mit ihrem Mann, einem Hutu, der der Opposition zugerechnet wurde und darum in Lebensgefahr schwebte, und drei Geschwistern. Der Kellerraum gehörte einer befreundeten Hutu-Familie, die während der fast zwei Monate, die die fünf Personen in dem engen Versteck ausharren mussten, für sie sorgte. Mehrfach seien sie nur knapp der Entdeckung und damit dem sicheren Tod entronnen. Aber sie hätten es geschafft, im Gegensatz zu den Eltern und vielen Verwandten, die getötet worden seien.
Zoulfaty M. weint häufig, als sie mir von der schwierigen Zeit des Überlebens erzählt und von den Toten, die sie auf dem Weg zurück in ihr Heimatdorf gesehen hat. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gacaca funktioniert«, sagt sie beinahe trotzig, und: »Die Wunden sind viel zu tief, die Erinnerung noch viel zu frisch. Der Hass der Häftlinge in den Gefängnissen ist mit den Händen zu greifen, der Schmerz der Überlebenden endlos. Wie soll da eine Versöhnung zustande kommen? Ich weiß, dass viele Opfer die Strafen, die Gacaca-Gerichte verhängen können, als zu gering empfinden. Sie fühlen sich noch einmal erniedrigt, zumal es ihnen auch wirtschaftlich schlecht geht. Sie haben Hunger und leiden und es gibt keine Aussicht auf Besserung.«79
Mit dieser Meinung steht Zoulfaty M. nicht allein. Viele Überlebende denken wie sie, scheuen sich aber, ihre Meinung zu sagen, erst recht gegenüber einem Fremden. Niemand möchte sich gegen das große staatlich betriebene Versöhnungsprojekt stellen, für das Gacaca der offizielle Schlüssel ist. Eine Ausnahme ist hier nur die Opferorganisation Ibuka, die regelmäßig eine stärkere Berücksichtigung der Belange Überlebender fordert. Ihnen müsse die Hauptsorge der Politik gelten, nicht den vielen Tätern und deren eventueller Geständnisbereitschaft.
Durchdringen konnte sie mit dieser Forderung bislang offensichtlich nicht, ebenso wenig wie mit ihrem Verlangen, die Verbrechen des Jahres 1994 und davor allein auf die eigentlichen Völkermordverbrechen im Sinne der Völkermordkonvention zu beschränken und daher in den Gesetzestexten zur Einsetzung der Sonderkammern und Reaktivierung der Gacaca-Justiz nur von itsembabwoko zu sprechen (ethnische Säuberung, Völkermord) und nicht auch von itsembatsemba (Massaker). Itsembabwoko sollte sich ausschließlich auf den Völkermord, das heißt auf die an den Tutsi begangenen Verbrechen beziehen, während itsembatsemba auch politisch motivierte Massaker, das heißt die Massenmorde an den der Opposition zugerechneten Hutu umfasste.80 Gewählt wurde schließlich der Begriff itsembabwoko n’itsembatsemba, also eine Verbindung von beiden Verbrechensmodalitäten, um das gesamte verbrecherische Geschehen mit seinen unterschiedlichen Opfergruppen abbilden zu können.
»Diese Entscheidung war genau richtig«, versichert mir Odette Nyiramilimo in einem Gespräch wenige Tage später.81 Einer größeren Öffentlichkeit war sie durch das Gourevitch-Buch über den Völkermord in Ruanda bekannt geworden, in dem sie dem Autor über die Umstände der ihr und ihrer Familie zugedachten Vernichtung berichtet hatte. Jetzt ist sie, eine ausgebildete Ärztin, Staatsministerin für soziale Angelegenheiten und sitzt mir in ihrem Büro gegenüber. »Ein Land kann nicht auf offenen Wunden aufgebaut werden«, fährt sie fort, »das ganze Unrecht muss zur Sprache kommen. Und natürlich muss dabei ein Unterschied gemacht werden zwischen den an Tutsi und Hutu begangenen Verbrechen. Tutsi wurden Opfer eines Völkermords, niemand sollte überleben. Einen Völkermord an den Hutu hat es jedoch nicht gegeben. Getötet wurden Hutu, die als Oppositionelle galten, nicht ganze Familien. Das darf nicht vergessen werden.«
Sie greift zu dem Buch von Alison Des Forges über den Völkermord, das im Regal steht, legt es zwischen uns auf den Tisch und weist anklagend darauf: »Hier, vieles von dem, was darin steht, ist richtig. Aber Alison Des Forges macht alles kaputt, wenn sie am Ende der Befreiungsarmee FPR82 vorwirft, systematisch Verbrechen an Hutu begangen zu haben. Das ist falsch. Und ich sage das mit der gleichen Überzeugung, mit der ich sage, dass nicht alle Hutu Völkermordtäter gewesen sind. Ich habe mal gesagt, dass 90 Prozent der Überlebenden nur überlebt haben, weil sie von Hutu gerettet worden sind. Dafür bin ich heftig kritisiert worden. Gut, dann waren es eben 80 Prozent.« Odette Nyiramilimo hält kurz inne, schaut mich an und bemerkt dann: »Wissen Sie, das ist der Grund, warum das friedliche Zusammenleben von Hutu und Tutsi in unserer Gesellschaft wieder möglich ist. Meine Kinder haben mich kürzlich gefragt, ob Tutsi wieder Hutu heiraten könnten. ›Natürlich‹, habe ich geantwortet, ›warum denn nicht? Wir leben doch wieder zusammen.‹« Mein Gesichtsausdruck scheint Überraschung oder Erstaunen zu zeigen, denn mit Nachdruck fährt sie fort: »Doch, doch, wir haben gemeinsam das Böse erfahren und jetzt müssen wir es gemeinsam überwinden. Es gibt keine Alternative dazu.« Dann, nach einer Pause: »Gacaca wird uns helfen, wieder zueinander zu finden, und ich hoffe, auch das Ausland hilft uns. Es hat die Pflicht, uns zu helfen, weil es den Völkermord nicht verhindert hat.«
Unter ruandischen Politikern, Juristen und Journalisten scheint die Forderung weit verbreitet, dass die Welt, die 1994 beim Völkermord tatenlos zugesehen habe, moralisch und vielleicht auch rechtlich verpflichtet sei, Ruanda bei seinen Versuchen zu unterstützen, die Folgen des Völkermords zu überwinden. Kaum ein Gespräch über den Völkermord – und ein solches Gespräch 2002, acht Jahre danach, nicht zu führen, war letztlich unmöglich –, in dem nicht an die Verantwortung des Auslands für den friedlichen Wiederaufbau Ruandas appelliert wird. »Die Deutschen kennen sich doch aus mit Versöhnung«, stellt Odette Nyiramilimo noch am Ende unseres Gesprächs fest, und in der Tat neigen diejenigen unter meinen Gesprächspartnern, die sich in der Geschichte ihres ehemaligen Kolonialherren auskennen – Ruanda war von 1898 bis 1916 deutsche Kolonie – dazu, Deutschen pauschal eine gewisse Expertise im Umgang mit Völkermord zu unterstellen. »Es wäre gut, wenn sich Deutschland stärker in den ruandischen Versöhnungsprozess einbringen könnte«, wünscht sich auch Célestin G., ein promovierter Sozialwissenschaftler, der längere Zeit in Deutschland gelebt und den Völkermord in einem Flüchtlingslager nahe der burundischen Grenze überlebt hat. Und er fügt hinzu: »Der Versöhnungsprozess, wenn man ihn denn so nennen will, wird schwierig werden. Gacaca ist zwar Teil unserer Tradition und schlechter als in Arusha kann es nicht laufen, aber die Probleme sind für den, der sie sehen will, riesengroß. Die Wahrheit ist selten so eindeutig, wie sie zunächst scheint. Wie soll die Zerrissenheit unserer Gesellschaft überwunden werden? Wie soll die Gewalt, der die Menschen ausgesetzt waren, aus den Köpfen verschwinden?«83
2.1 Zwischen Verheißung und Zumutung – Aspekte einer widersprüchlichen justiziellen Herausforderung
Ende 2002 hätte es in Ruanda wohl nur sehr wenige gegeben, die vom Internationalen Strafgerichtshof in Arusha eine effektive Hilfe für die innere Entwicklung des Landes erwartet hätten. Die meisten hätten ohne zu zögern dem abfälligen Pauschalurteil von Célestin G. zugestimmt. Dass die offizielle Politik des Landes dem Gerichtshof mit unverhohlener Ablehnung begegnete, hatten schon der Besuch im Gefängnis von Nyankenke und der dort vorgeführte Film gezeigt. Das vergleichsweise komfortable Leben der Angeklagten im Gefängnis des Gerichtshofs und dessen Desinteresse für die Opfer der Verbrechen, die er ahnden soll – beides mehrfach plakativ herausgestellt –, legitimierten im Nachhinein, so die Botschaft des Films, die ruandische Gegenstimme bei der Entscheidung des Sicherheitsrats über die Einsetzung des Gerichts.
»Arusha«, wie der Internationale Gerichtshof in Ruanda oft in verächtlicher Kürze genannt wurde, war keine Einrichtung, an die sich Hoffnungen knüpften. Sogar zu behaupten, dass der Gerichtshof schon in den ersten Jahren seines Bestehens von den Ruandern, ob Hutu oder Tutsi, nicht nur als Enttäuschung, sondern als Zumutung empfunden wurde und die politische Führung in ihm entweder eine souveränitätsfeindliche Bevormundung oder eine arrogante Einmischung in die inneren Angelegenheiten Ruandas sah, wäre sicherlich keine Übertreibung.84 Als das Gegenstück zum Gericht wurde Gacaca präsentiert, die ruandische, der Tradition verhaftete Antwort auf die angeblich seelenlose internationale Justiz, die nicht mehr als nur das Hintergrundszenario für ein einzigartiges Versöhnungsunternehmen darstelle und hauptsächlich dazu geeignet sei, den Völkermord in der außerruandischen Welt nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Diese skeptische bis rundweg ablehnende Reaktion auf die Tätigkeit des Gerichts kann als bruchlose Fortsetzung der Kritik an seiner Einsetzung gelesen werden. Nicht nur auf das Jahr 1994, sondern auf die gesamte Kriegsdauer, also vom 1. Oktober 1990 bis zum 4. Juli 1994, müsse sich die zeitliche Kompetenz des Gerichts erstrecken, hatte seinerzeit Manzi Bakuramutsa, der Vertreter Ruandas im UN-Sicherheitsrat, gefordert. Schon zu Beginn des Krieges habe es Massaker an der Tutsi-Bevölkerung gegeben. 8000 Tutsi seien Anfang Oktober 1990 willkürlich inhaftiert, Hunderte von ihnen umgebracht worden. Immer wieder sei es danach zu Massenmorden an Tutsi gekommen, die in einzelnen Fällen 300, einmal sogar mehr als 400 Opfer gefordert hätten. Die »Endlösung nach ruandischer Art« sei der internationalen Gemeinschaft nicht verborgen geblieben, viele Diplomaten und internationale Organisationen seien im Land gewesen. Ein Gericht aber, das die Vorgeschichte des Völkermords ausblende und die vorherigen »Experimente« in Form einer ganzen Reihe von Massakern nicht zur Kenntnis nehme, sei für Ruanda völlig nutzlos. Es werde die Kultur der Straflosigkeit nicht beenden und in keiner Weise zur Versöhnung beitragen.85 Auf derselben Linie des Desinteresses liege die Konzeption des Gerichts als bloßes Anhängsel des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien, hatte der ruandische Delegierte noch hinzugefügt. Es seien nur zwei Strafkammern mit je drei Richtern vorgesehen, die fünfköpfige Berufungskammer müsse sich das Gericht mit dem Jugoslawien-Tribunal teilen, und das gelte auch für den Leiter der Anklagebehörde. Dessen Aufgabenbereich werde einfach nur um Ruanda erweitert.86 Und schließlich: Abgesehen davon, dass das Gericht nicht in Ruanda, dem Schauplatz der Verbrechen, seinen Sitz haben, und es nicht einmal mit ruandischen Richtern, die sich in der Geschichte und Kultur des Landes auskennen, besetzt werden solle, sei es ein Affront für die Opfer, dass das Gericht nicht die Todesstrafe verhängen dürfe. Nach ruandischem Strafrecht sei für Mord die Todesstrafe vorgesehen, doch das internationale Gericht könne als Höchststrafe lediglich eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängen. Planer und Organisatoren des Völkermords bekämen also eine geringere Strafe als die kleinen Täter, die sich vor ruandischen Gerichten zu verantworten hätten. Das würde dem Grundgedanken der Versöhnung in Ruanda zuwiderlaufen.87
Die Kritik des ruandischen Delegierten blieb bekanntlich ohne Wirkung. Folglich stimmte Ruanda gegen das Gericht, das in zeitlicher Hinsicht nur für das Jahr des Völkermords, vom 1. Januar 1994 bis zum 31. Dezember 1994, zuständig sein sollte, das im Ausland, im tansanischen Arusha tagte, das keine ruandischen Richter hatte und das die Todesstrafe nicht verhängen durfte. »Seit 30 Jahren«, erklärte in diesem Zusammenhang der Delegierte Neuseelands im UN-Sicherheitsrat, »bemüht sich die UNO um die Abschaffung der Todesstrafe, und es wäre ein großer Rückschritt, würden wir sie jetzt in das Gerichtsstatut aufnehmen.«88 Die einzige Konzession, die die UNO Ruanda machte, sollte die Schaffung einer eigenen Anklagebehörde sein. Das geschah jedoch erst gut neun Jahre später, im September 2003, und unter Umständen, die die Verflechtung von Recht und Politik schlaglichtartig demonstrierten. Bis dahin gab es ein internationales Gericht, das sich mit großer Sympathie mit Ruanda beschäftigte, von diesem aber mit äußerstem Argwohn beobachtet wurde.
Korruption, Vetternwirtschaft, Inkompetenz und Missmanagement lauteten die Vorwürfe, die regelmäßig auf ruandischer Seite zu hören waren, wenn das Gespräch auf das Arusha-Tribunal kam. Gänzlich unbegründet waren sie keineswegs, wie UN-Berichte konstatieren mussten.89 Als die Gerichtsverhandlungen 1997 begannen, kamen vor allem dann, wenn es um den Anklagepunkt der Vergewaltigung ging, noch Vorwürfe hinzu, die den Richtern mangelnde Sensibilität und fehlendes Aufklärungsinteresse unterstellten.90
Das erste Urteil des Gerichts, zugleich das erste Urteil eines internationalen Gerichts wegen Völkermords überhaupt, wurde allerdings in Ruanda mit beinahe grimmiger Befriedigung aufgenommen.91 Endlich hatte das Gericht am 2. September 1998 das festgestellt, was in Ruanda jede und jeder wusste: dass es einen Völkermord gegeben hat, dass zu den zahlreichen Abscheulichkeiten, die ihn möglich gemacht hatten, das Verbrechen der Vergewaltigung gehörte und dass der Völkermord auch hochrangige Täter hatte wie Jean-Paul Akayesu, den ehemaligen Bürgermeister von Taba, einer Gemeinde zirka 50 Kilometer südwestlich von Kigali.92 Die gewundenen dogmatischen Überlegungen, die das Gericht anstellte und die erstmals auf einen konkreten, lebenswirklichen Zusammenhang übertragen wurden – sind die Tutsi, die mit den Hutu eine Kultur teilen, eine nationale, ethnische oder rassische Gruppe; wie ist das subjektive Merkmal der Zerstörungsabsicht zu verstehen und nachzuweisen? –,93 quittierte man in Ruanda im Gestus des »wir wissen genau, wer wen warum umgebracht hat« mit ausgeprägter Indifferenz. Entscheidend war allein die Verurteilung Akayesus zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Völkermordverbrechen.
Zwei Tage später, am 4. September 1998, folgte bereits das zweite Urteil. Jean Kambanda, der Premierminister zur Zeit des Völkermords, hatte sich in allen Anklagepunkten schuldig bekannt.94 Damit war innerhalb kurzer Zeit und nun von allerhöchster, »kompetenter« Stelle erneut vor der Weltöffentlichkeit bestätigt worden, dass in Ruanda ein Völkermord stattgefunden hatte und dass dieser möglichst vollständig durchgeführt werden sollte.
Ohne ein Minimum an Kooperationsbereitschaft, das war allen Beteiligten von Anfang an klar,95 würde das Gericht nicht arbeiten können. Und da Kooperation eine Tätigkeit voraussetzt, war sie aus ruandischer Sicht immer dann gut und förderungswürdig, wenn das Gericht tätig war, das heißt Urteile verhängte, die den Horror des Völkermords und das Leiden der Opfer aller Welt deutlich vor Augen führten. Mehrfach schon hatte Ruanda wegen schleppender Gerichtstätigkeit oder vom Gericht nicht monierter, zynischer Zeuginnenbefragung damit gedroht, nicht mehr mit dem Tribunal in Arusha zusammenzuarbeiten. Zuletzt Ende 1999, als die Berufungskammer des Gerichts beschlossen hatte, die Anklage gegen Jean-Bosco Barayagwiza zurückzuweisen und seine umgehende Haftentlassung anzuordnen. Er war über 300 Tage in Haft gehalten worden, ohne den Grund für seine Inhaftierung erfahren zu haben, was nach Meinung der Kammer einen eklatanten Verstoß gegen die aus dem Habeas-Corpus-Grundsatz resultierenden Verfahrensgarantien zugunsten des Beschuldigten darstellte.96 Der Beschluss war jedoch von der Kammer wenige Monate später wieder aufgehoben worden, weil, so die Begründung, neue Tatsachen aufgetaucht seien, die den Verstoß gegen den Habeas-Corpus-Grundsatz als längst nicht so gravierend erscheinen ließen und die Haftentlassung daher nicht zu rechtfertigen vermochten. Ruanda, das von der Schuld Barayagwizas überzeugt war,97 hatte sich offensichtlich durchgesetzt. Obwohl die Kammer dem Beschuldigten in ihrer korrigierenden Entscheidung für den Fall seiner Verurteilung noch eine Strafmilderung versprochen hatte,98 liegt der Eindruck nahe, dass eine ernsthafte Belastung des Verhältnisses zu Ruanda unbedingt vermieden werden sollte. Das ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, was zu jener Zeit zunehmend in den Fokus der Anklagebehörde geriet und mit dem Namen ihrer Leiterin, Carla Del Ponte, zu verbinden ist. Denn während ihre Amtsvorgänger bis September 1999, der Südafrikaner Richard Goldstone und die Kanadierin Louise Arbour, ihr Mandat so verstanden hatten, dass es sich ausschließlich auf Verbrechen extremistischer Hutu, begangen an Tutsi und oppositionellen Hutu, bezieht, verstand es die Schweizerin Del Ponte als einen in alle Richtungen gehenden Ermittlungsauftrag. Das schloss Verbrechen der FPR, die diese mutmaßlich bei der Eroberung des Landes 1994 begangen hatte – Zahlenangaben bewegen sich zwischen 25 000 und 45 000 Getöteten, Zeugenaussagen zufolge liegen sie noch bedeutend höher99 – mit ein. »Für mich ist ein Opfer ein Opfer«, bemerkte Del Ponte dazu. »Jedes Verbrechen, das in meine Zuständigkeit fällt, ist ein Verbrechen, unabhängig von der Identität, der Ethnie oder den politischen Vorstellungen der Täter. Die Justiz gehorcht keinem politischen Opportunismus.«100
In den Ohren ruandischer Regierungsvertreter klang das, 2002 als Selbstverständlichkeit formuliert, wie eine Kampfansage und fügte sich nahtlos ein in die Empörung über neuerliche Opfer- und Zeuginnenbefragungen, die in einer entwürdigenden Weise vorgenommen worden waren.101 »Jedes Verbrechen, das Angehörige der RPA [= APR, G. H.] begangen hatten, wurde untersucht und geahndet«, erklärte kategorisch der ruandische Übergangspräsident Paul Kagame und fügte an die Adresse der internationalen Gemeinschaft und des Ruanda-Tribunals hinzu: »Sie wissen das ganz genau. Wir haben nicht so agiert wie die Kräfte, die den Völkermord verübt haben. Von der damaligen Regierung bestrafte niemand diejenigen, die die Verbrechen begingen, im Gegenteil, es war so, als ob sie für ihre Verbrechen noch belohnt worden wären. Wie kann es da der Strafgerichtshof in Arusha wagen, die RPA, die den Völkermord beendet hat, auf dieselbe Stufe zu stellen wie die génocidaires, die wirklichen Täter des Völkermords. Wir wehren uns gegen diese Art des Denkens.« Und direkt auf das Tribunal bezogen sagte er noch, einen alten Vorwurf wiederholend: »Man muss doch nur die Mittel, die dem Gericht zur Verfügung gestellt werden, mit den Ergebnissen vergleichen. Dutzende Millionen US-Dollar werden ausgegeben, und doch dauern die Prozesse so lang und sind einige Fälle schon so lange anhängig.«102
Nach ruandischem Verständnis war jede Kritik an »Arusha« zugleich ein Grund mehr für die Reaktivierung von Gacaca. In der Summe wurde Gacaca damit zu einer Verheißung von Versöhnung und Frieden gegen einen institutionalisierten Missstand, der als Zumutung empfunden werden musste. »Er hat nicht die geringste moralische Autorität«, fasste Kagme die ruandische Position zusammen, als er auf die Kritik am internationalen Gerichtshof angesprochen wurde.103 Die Moral, das Recht der Entscheidung, liegt auf unserer Seite, bedeutete das. Aber konnte die Gacaca-Gerichtsbarkeit, Kernpunkt dieser Entscheidung und Gegenmodell, die in sie gesetzten Erwartungen überhaupt erfüllen? War sie nach ihrem ursprünglichen Inhalt und später hinzugefügtem Konzept das geeignete Instrument, um über alle Beschwörungsformeln hinaus Annäherung und inneren Frieden in Ruanda zu ermöglichen?
So weit wie die Quellen aus präkolonialer Zeit Auskunft geben, war Gacaca eine Einrichtung, die der einvernehmlichen Streitschlichtung diente. Sie gehorchte keinen festen Regeln, unterstand keiner zeitlichen Vorgabe und kannte weder ein individualisiertes Verständnis von Täterschaft noch eine klare Unterscheidung zwischen Verfahrensbeteiligten, Zeugen und Zuhörerschaft. Sie war eine partizipative Justiz, die unter dem Vorsitz eines Inyangamugayo und in einem Prozess von Rede und Gegenrede einen Konflikt so zu lösen versuchte, dass der Frieden innerhalb der Gruppe – gewöhnlich eine Großfamilie oder ein Clan – wieder hergestellt war. Das war möglich, weil die Autorität von Gacaca auf der Einsicht in die Notwendigkeit einer intakten Gemeinschaft gründete. Ubuntu wurde diese wechselseitige Abhängigkeit zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft genannt, ihre Beachtung genoss unbedingten Vorrang vor einer Bestrafung. Das bezog sich auch auf schwerwiegendere Verbrechen, wenngleich Gacaca meist bei kleineren Delikten wie Beleidigung oder Körperverletzung oder bei Streitigkeiten über Grundstücks-, Erb- und sonstige Vertragsfragen Anwendung fand. Bei Mord oder vergleichbaren Straftaten (dazu zählte auch Diebstahl) hatten der Verletzte beziehungsweise dessen Gemeinschaft zunächst das Recht der Rache (nur an den männlichen Mitgliedern der Gemeinschaft des Rechtsverletzers), es sei denn, der König (Mwami) machte sein Recht geltend, ein Urteil zu fällen, oder er verwies den Fall an ein Gacaca-Gericht, das daraufhin eigenständig und unabhängig tätig wurde. Statt der Leistung von Schadenersatz oder von tätiger Wiedergutmachung, die mit dem gemeinschaftlichen Trinken eines Krugs Bananenbier besiegelt wurde, konnte dann – und bei einem Tötungsdelikt war das die angestrebte Ideallösung – eine Heirat zwischen den betroffenen Gemeinschaften arrangiert werden. Kinder aus dieser Verbindung galten als »Ersatz« für die Getöteten.104
In der Kolonialzeit verlor Gacaca erheblich an Bedeutung. Mit der Durchsetzung des kolonialen Gewaltmonopols erhielten staatliche Gerichte, die in ihren Instanzen der Herrschaftsstruktur des Landes nachgebildet waren, die Zuständigkeit für die Ahndung von Gewaltkriminalität und größere zivilrechtliche Angelegenheiten. An die Stelle des restaurativen, auf sozialen Ausgleich bedachten Elements, trat das retributive, das auf Vergeltung und die abschreckende Wirkung der Strafe setzte. Die informelle Gacaca-Justiz befasste sich nur noch mit dem, was vor allem in ländlichen Gebieten – und das waren die bei weitem größten Teile Ruandas – an kleineren sozialen Konflikten aufbrach, wie in der Vergangenheit mit vornehmlich restaurativer Zielsetzung.105 Die Verfassung von November 1962, die sich das zum 1. Juli desselben Jahres unabhängig gewordene Ruanda gegeben hatte, versuchte den Rechtsdualismus zwischen staatlichem und traditionellem informellen Recht zu beenden, indem Letzteres »kodifiziert und mit den Prinzipien der Verfassung in Einklang gebracht wird«.106 Dennoch blieb Gacaca nachweislich bis in die 1980er Jahre hinein eine verbreitete Praxis der Streitschlichtung.107