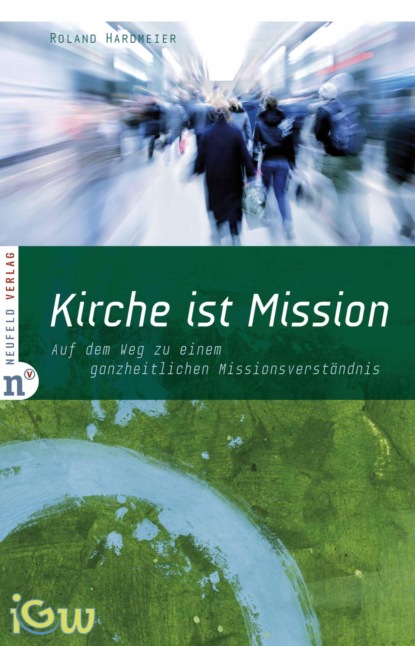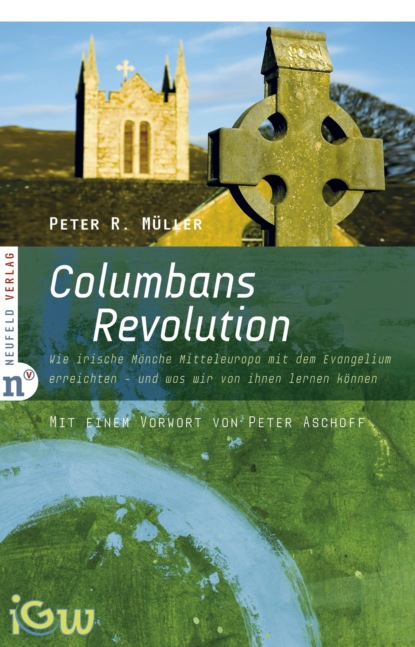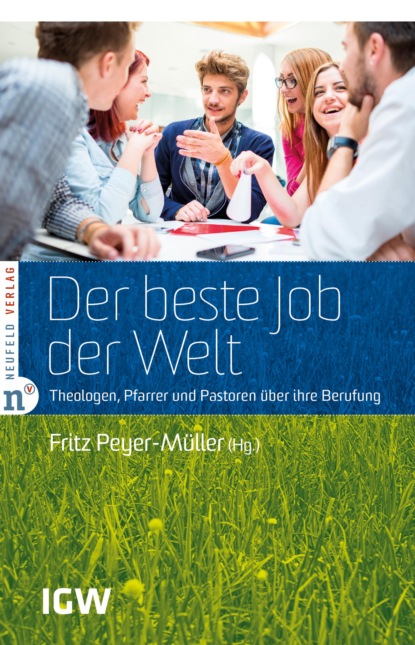- -
- 100%
- +
Das Streben nach Transformation hat, wie Track 3 deutlich macht, durchaus eine kämpferische Note. Nicht verwunderlich ist denn auch, dass der Umstand beklagt wird, die Kirche und die christlichen Entwicklungsorganisationen würden durch ihr Schweigen zur Ungerechtigkeit den Status Quo nicht selten zementieren. Der Schlussbericht folgert, dass Mission heute umfassend definiert werden muss:
Die Mission der Kirche umfasst sowohl die Proklamation des Evangeliums als auch seine Demonstration. Deshalb müssen wir evangelisieren, Antworten auf drängende menschliche Nöte geben und uns für soziale Transformation einsetzen. (Transformation 1987 [1983], V.26)
Umfassende Mission
Berneburg (1997, 197–198) fasst den Beitrag in Wheaton zur Entwicklung des Missionsverständnisses in den folgenden vier Punkten zusammen: Erstens sprach man sich in Wheaton für einen umfassenden Heilsbegriff aus. Es wurden „biblische Horizonte eröffnet, die die individualistische Begrenzung auf die Bekehrung des einzelnen als heilsgeschichtliches Ziel des Wollens Gottes zu überwinden versprechen.“ Zweitens hat man unter dem Begriff der Transformation das umfassende Heil als in allen Lebensbereichen wirkend definiert. Drittens diente das Reich Gottes als Modell für die Transformation. Wheaton „hat die Reich-Gottes-Verkündigung zum Ausgangs- und Angelpunkt des missionarischen Denkens gemacht.“ Viertens ist erklärt worden, dass Mission gleichermaßen in Wort und Tat geschieht. Die Sendung der Kirche soll „sich nicht auf die Verkündigung des Heiles zur Rettung aus der Verlorenheit des Menschen beschränken, sondern gleichberechtigt die Auswirkungen des Heiles in den sozialen Beziehungen demonstrieren.“ Berneburg steht dieser Entwicklung kritisch gegenüber:
Ohne Zweifel drängt sich die Frage auf, ob mit dieser Parallelisierung von göttlichem ewigen Handeln und menschlichem Engagement, das immer der Vorläufigkeit der Weltzeit verhaftet bleibt, nicht letztlich das reformatorische Verständnis der Rechtfertigung allein durch Gottes Gnade aufgegeben wird. Die Stärke der evangelikalen Missionstheologie lag bisher darin, dass sie die Verkündigung der freien Gnade in Jesus Christus gegenüber jeder Verkürzung durch Ethisierung oder durch innerweltliche Veränderungsprogramme bewahrte. Nun steht selbst die evangelikale Missionstheologie in der Gefahr, die missionarische Heilsverkündigung zugunsten eines ganzheitlichen Engagements aus dem Zentrum ihres Anliegens zu verlieren. (Berneburg 1997, 199)
Während Berneburg bei der Transformations-Orientierung von einer „Verkürzung“ des Evangeliums spricht, ist seit Wheaton ein beträchtlicher Teil der Evangelikalen der Auffassung, dass die Transformation eine biblische Erweiterung der Mission darstellt. Das macht deutlich, dass in dem knappen Jahrzehnt seit dem Lausanner Kongress sich die evangelikale Mission rasant gewandelt hatte. War in Lausanne noch zögerlich von der Integration der sozialen Verantwortung in die missionarische Aufgabe die Rede gewesen, wurde diese in Wheaton bereits vorausgesetzt. In Wheaton ging man einen Schritt weiter als in Lausanne und erörterte die Integration der strukturellen Veränderung als Teil der Mission. Lausanne berechtigte die sozial gesinnten Evangelikalen, ihre Tätigkeit als Teil der Mission Gottes zu betrachten. Wheaton ermutigte sie dazu in diese Richtung weiter zu marschieren und die Bekämpfung der Ursachen der sozialen Nöte in den Missionsauftrag zu integrieren. In Wheaton rückte erstmals der ganze Mensch mit all seinen Nöten und die ganze Welt mit all ihren Herausforderungen in den missionarischen Fokus. Die Welt war zur Arena der evangelikalen Mission geworden.
Manila (1989)
Unter dem Thema „Verkündigt Christus, bis er kommt – ein Ruf an die Gemeinde, das ganze Evangelium der ganzen Welt zu bringen“ fand 1989 der größte evangelikale Kongress seit Lausanne statt (auch Lausanne II genannt). Das Thema widerspiegelt das veränderte Gesicht der evangelikalen Mission im ausgehenden 20. Jahrhundert. Der Ausdruck „das ganze Evangelium“ bezog sich auf die Integration der sozialen Verantwortung in das Missionsverständnis. Das Bewusstsein, auf die Nöte der Welt eine biblische Antwort geben zu müssen, war in Manila evangelikales Allgemeingut. Das hatte nicht zuletzt mit dem Umstand zu tun, dass die evangelikale Bewegung repräsentativer vertreten war als früher. 60 Prozent der Teilnehmer kamen aus der Zwei-Drittel-Welt, 25 Prozent waren Frauen.10
Die Armen
Durch den richtungsweisenden Vortrag von Tom Houston traten die Armen in den missionarischen Fokus (Weth 1990, 100).11 Ausgehend von Lk 4,18, wo Jesus sagt, dass er den Armen gute Nachricht bringt, regte Houston zum Nachdenken über die Bedeutung der Armen in Bezug auf das Evangelium dar. Die Armen seien bei Jesus ein Sammelbegriff für die Blinden, Gefangenen und Unterdrückten. Wenn man also sage, dass Jesus kam, um den Armen gute Nachricht zu verkünden, müsse das Evangelium insbesondere den Benachteiligten dieser Welt gebracht werden (Houston 1990, 108–110). Houston forderte eine Evangelisation für die Armen: „Weil fast die Hälfte der Weltbevölkerung arm ist, wird die Welt erst dann evangelisiert werden, wenn die Gute Nachricht auch zu den Armen gebracht wird“ (Houston 1990, 113). Das erfordere konkretes Handeln:
Ich glaube, dass wir die Gute Nachricht von Jesus in einer feindlichen oder ungläubigen Welt überzeugend darstellen können, wenn wir durch Erbarmen das Anliegen der Armen und ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Und ich glaube, dass wir in der Lage sein werden, den Säkularismus im Westen zu bekämpfen, wenn wir diese Art von Authentizität der Guten Nachricht Jesu wiederherstellen. (Houston 1990, 115)
Houston forderte die Reichen auf, ihren Beitrag in einer verarmten Welt zu leisten. Mehr als die Hälfte der Evangelikalen weltweit lebe im Reichtum. Würden sie ihren Reichtum mit dem Armen teilen, könnten die meisten Probleme der Welt einschließlich das des Hungers, der Armut und der Krankheit gelöst werden (Houston 1990, 115). Houston rüttelte die reichen Evangelikalen mit der Klage auf: „Während fast eine Milliarde Menschen in absoluter Armut leben, sind die Nachfolger Jesu in ihrem Begehren, noch mehr zu besitzen, kaum von den anderen zu unterscheiden“ (Houston 1990, 114). Sein Hauptanliegen fasste Houston in der Forderung zusammen, dass das Evangelium mit Wort und Tat und Zeichen verkündigt werden müsse (Houston 1990, 116). Mit Houston sprach sich zum ersten Mal ein anerkannter evangelikaler Leiter, der weder dem radikalen Segment angehörte noch aus dem Süden stammte, dezidiert für eine Evangelisation der Armen aus.
Soziale Verantwortung
Die soziale Verantwortung war ein wichtiges Thema in Manila. Der Social Concern Track befasste sich mit der Bedeutung sozialen Handelns. Es ging weniger um eine theologische Erörterung der sozialen Verantwortung als um Erfahrungsberichte und Anregungen für die Praxis. Dieser Umstand ist bemerkenswert. Die soziale Verantwortung war unterdessen in die Missionstheologie integriert worden, so dass es nicht mehr nötig war, ihre Berechtigung zu diskutieren. Mission ohne soziale Verantwortung war unter den Evangelikalen nicht mehr denkbar.
Der Abschlussbericht des Social Concern Tracks zeugt von einer gründlichen theologischen Reflexion der sozialen Verantwortung als Teil der Mission.12 Unter dem Titel „Das ganze Evangelium“ wird der Abschlussbericht mit folgenden Statements eröffnet:
Die Gute Nachricht besteht darin, dass Gott sein Königreich der Gerechtigkeit und des Friedens durch die Menschwerdung, den Dienst, den Sühnetod und die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus errichtet hat. Das Reich Gottes erfüllt das Ziel der Schöpfung Gottes, indem es der Menschheit und der ganzen Schöpfung Ganzheit verleiht. Im Reich Gottes erhalten die Menschen allein aus Gnade einen neuen Status vor Gott und den Menschen, eine neue Würde und einen neuen Wert als Töchter und Söhne, und sie werden bevollmächtigt durch seinen Geist, Haushalter der Schöpfung zu sein und sich in einer neuen Gemeinschaft gegenseitig zu dienen. Das Reich Gottes wird in einem neuen Himmel und einer neuen Erde seine Vollendung erst dann erfahren, wenn Jesus wiederkommt. Diejenigen, die materiell arm sind oder ohnmächtig und sich von dieser Guten Nachricht ansprechen lassen und darauf antworten, werden durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, und ihnen wird von anderen Gliedern der Gemeinde des Reiches Gottes gedient werden, damit sie ihr ganzes Menschsein als Haushalter der Schöpfung Gottes erfahren und erleben. Die Nicht-Armen, die arm im Geiste werden, empfangen wahre Würde, die ihren falschen Stolz auf ihre Reichtümer ersetzt und sie befreit, wirklich menschlich werden zu können mit einer Leidenschaft für Gerechtigkeit für die Armen. Sie müssen sich auf die Kraft des Geistes Gottes verlassen, der sie befähigt, zu dienen statt zu kontrollieren. Sie kommen in eine neue Familie, die sie annimmt aufgrund dessen, was sie sind und nicht aufgrund irgendwelcher Leistungen, die sie erbracht haben – in materieller Hinsicht oder hinsichtlich ihres Status. Die Aufgabe der Evangelisation unter der Mehrheit der unerreichten Armen wird in erster Linie von denen ausgeführt werden, die selber arm sind, mit angemessener Unterstützung von wirtschaftlich Bessergestellten, die geistlich arm sind. (Samuel 1990, 151)
Dieses Statement widerspiegelt das umfassende Missionsverständnis gut, wie es sich als Folge von Lausanne I entwickelte: Das Reich Gottes ist eine grundlegende theologische Kategorie für die Mission der Kirche. Die Menschen werden aus Gnade gerecht, aber es geht auch darum, dass sie gute Haushalter der Schöpfung Gottes sein können. Und die Armen spielen eine missiologische Schlüsselrolle.
Im Abschlussbericht des Social Concern Track wird unter dem Titel „Die Wirkung des ganzen Evangeliums“ ein Maßnahmenkatalog aufgestellt, dem sich die Evangelikalen verpflichten sollten. In diesem Katalog treten einige radikale Anliegen hervor.13
Seit Lausanne I sind die sozialen Nöte der Menschen eskaliert, und die Möglichkeiten, diesen Nöten zu begegnen, sind geringer geworden. Wenn wir die Menschen mit den Augen Jesu sehen, dann erfordert die Verkündigung und Veranschaulichung des ganzen Evangeliums, dass die evangelikalen Christen sich zusammentun und gemeinsam vorgehen, um
• mit denjenigen Aspekten der Guten Nachricht zu beginnen, die einen direkten Bezug zu den Nöten und Hoffnungen der Menschen haben.
• dafür zu sorgen, dass die den Menschen von Gott gegebene Kraft freigesetzt werden kann, damit sie ihre christliche Theologie und christlichen Werte innerhalb ihrer eigenen Kultur und ihrer Lebenszusammenhänge entwickeln können.
• überall, wo es nur möglich ist, mit anderen Christen zusammenzuwirken, um die Weltevangelisation und das soziale Engagement weiterzubringen und voranzutreiben, ohne dabei die Einladung zu unterschlagen, dass wir Jesus folgen sollen.
• teilzuhaben am prophetischen Dienst, der sich auf eine ordentliche Sozialanalyse der Zusammenhänge stützt, in denen die Gute Nachricht verkündet werden soll.
• sich klarzumachen, dass die Quelle von einem Großteil des Geldes, das zur Weltevangelisation eingesetzt wird, dem exzessiven Reichtum der Ersten Welt entspringt, von dem wiederum ein Großteil aus Zinszahlungen der armen Länder stammt. Lassen Sie uns die Gelder nicht benutzen, um arme Menschen einzusperren, sie zu beschwichtigen oder zu frustrieren. Arbeiten Sie auf eine rasche Lösung des weltweiten Schuldenproblems hin, das manche christliche Beteiligung in der Entwicklungsarbeit zum Scheitern bringt.
• deutlich zu machen, dass Gott eine gute Regierung gefällt, besonders wenn sie Flüchtlinge aufnimmt, und dass er Gericht hält über jene, die ständig das Böse belohnen, insbesondere diejenigen, die mit Gewalt die Hoffnungen der Menschen auf Frieden und Gerechtigkeit zunichte machen. (Samuel 1990, 151–152)
Quo Vadis?
Der Bericht des Social Concern Track bringt deutlich zum Ausdruck, dass das radikale Segment in der evangelikalen Bewegung unterdessen gut etabliert war. Aber nicht alle sprangen auf diesen Zug auf. In Manila wurde deutlich, dass sich die evangelikale Bewegung in mindestens zwei Lager geteilt hatte: Auf der einen Seite sind diejenigen, die sich der Welt zuwenden und die soziale Verantwortung in den Missionsauftrag integrieren mit dem Ziel der Transformation. Speerspitze dieses Lagers sind die radikalen Evangelikalen. Auf der anderen Seite sind jene, die am traditionellen Missionsverständnis festhalten und mehr auf Evangelisation und numerisches Wachstum der Kirche ausgerichtet sind. Diese beiden Lager sind in ihren Positionen nicht völlig miteinander zu vereinen. Sie sind sich aber darin eins, dass die Verkündigung des Evangeliums, seine Demonstration durch Taten der Barmherzigkeit und der Aufbau der Kirche evangelikale Kernaufgabe ist.
Der Zwiespalt in der evangelikalen Bewegung zeigt sich am Manila Manifest, der Abschlusserklärung des Kongresses. Einerseits wird die Vorrangigkeit der Verkündigung herausgestrichen: „Die Evangelisation ist vorrangig, weil es uns im Sinn des Evangeliums in erster Linie darum geht, dass alle Menschen Gelegenheit erhalten, Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen“ (Manila Manifest 1989, Abschnitt 2, Absatz 4). Anderseits wird im selben Absatz festgehalten: „Wahre Mission muss immer inkarnatorisch sein.“ Inkarnatorische Mission bedeutet, dass wir „demütig Zugang suchen zu der Welt anderer Menschen, indem wir uns mit ihrer sozialen Wirklichkeit identifizieren, mit ihrer Trauer und ihrem Leid, mit ihrem Ringen um Gerechtigkeit und gegen Unterdrückungsmächte“ (ebd.). Doch gerade an diesem Punkt tat man sich schwer. Kurz vor dem Kongress hatte sich das chinesische Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens ereignet, was die Teilnahme chinesischer Christen am Kongress verunmöglichte. Leighton Ford (1990, 303) bedauerte diesen Umstand in seiner Eröffnungsrede zwar – verurteilt wurde das Massaker aber nicht. Auch am Ende des Kongresses erfolgte keine Reaktion, obwohl man sich im Manila Manifest (Abschnitt 1, Absatz 9) dazu verpflichtete, Unterdrückung zu verurteilen.
Manila brachte einen bemerkenswerten Prozess zum Abschluss. Es war unbestritten, dass Mission die soziale Verantwortung einschließt und durch Wort und Tat geschehen muss. Dieser Standpunkt ist von der evangelikalen Bewegung seit Manila nicht mehr hinterfragt worden. Andere Punkte blieben umstritten. Mission als Transformation hatte sich in Wheaton durchsetzen können, aber es war eine offene Frage, ob die dort gelegte Grundlage reichen würde, um die evangelikale Mission auf transformatorischen Kurs zu bringen. Radikale Elemente wie die prophetische Verwerfung von Ungerechtigkeit waren diskutiert, in der Praxis aber noch nicht erprobt worden. Und immer noch gab es eine beträchtliche Zahl von hauptsächlich westlichen Evangelikalen, welche die Weltzugewandheit der evangelikalen Mission als Gefahr sahen und lieber zur traditionellen Mission zurückgekehrt wären. Nach Manila war die Frage offen, wohin die Mission der weltweiten evangelikalen Bewegung sich entwickeln würde.
Manila bis Gegenwart
Seit dem Kongress in Manila hat es keine Missionskonferenzen mehr gegeben, aus denen grundlegende Neuerungen in der evangelikalen Missionstheologie resultierten. Überblickt man die Zeit seit Manila kann von einer Konsolidierung des ganzheitlichen Missionsbegriffs die Rede sein. Das zeigt sich am Forum für Weltevangelisation, das 2004 in Pattaya stattfand, wo in 31 so genannten Issue Groups die Herausforderungen der Mission diskutiert wurden. Im Vordergrund standen nicht theologische Fragen, sondern die Entwicklung von Szenarien, die es der Kirche, der Mission und christlichen Entwicklungsorganisationen ermöglichen sollten, ihren Auftrag auszuführen. Soziale Verantwortung, inkarnatorisches Handeln und transformatorisches Denken wurden vorausgesetzt. Zwar fehlt der evangelikalen Bewegung ein Konsenspapier, das Mission als Transformation offiziell legitimiert, aber die Praxis hat sich stark zur Transformation hin gewandelt. Das zeigt nicht zuletzt die Erklärung von Pattaya,14 in der es heißt:
Veränderung (Transformation) war ein Thema, das in den Arbeitsgruppen immer wieder in den Vordergrund trat. Wir erkennen an, dass wir immer wieder neu Umkehr und Umwandlung brauchen. Wir müssen uns immer weiter öffnen für die Führung durch den Heiligen Geist und für die Herausforderung durch Gottes Wort. Es ist nötig, dass wir zusammen mit anderen Christen in Christus wachsen. All dies soll in einer Weise geschehen, die zu sozialer und wirtschaftlicher (gesellschaftlicher) Veränderung führt. Wir erkennen an, dass die Breite des Evangeliums und der Bau des Reiches Gottes Leib und Seele sowie Verstand und Geist brauchen. Deshalb rufen wir zu einer zunehmenden Verbindung von Dienst an der Gesellschaft und Verkündigung des Evangeliums auf. (Pattaya II 2004, www.lausannerbewegung.de)
Die missiologischen Veränderungen, die in der Zeit zwischen Lausanne und Manila erstritten wurden, haben sich seit Manila verfestigt und sind in die Praxis übergegangen. Erhalten geblieben sind auch die unterschiedlichen missionstheologischen Positionen. Die evangelikale Bewegung lebt mit dieser Vielfalt und ist daran nicht zerbrochen. Es ist auch nicht so, dass die transformatorische Orientierung der Mission zu einer Verkürzung des Evangeliums geführt hätte. Vielmehr bestehen die traditionelle Sicht von Mission und die umfassendere, auf Transformation angelegte Sicht nebeneinander und ergänzen sich.
Ob die theologischen Grundlagen ausreichen, um Mission im Sinne der Zuwendung zur Welt langfristig zu erhalten, wird sich noch zeigen müssen, wie Tidball (1999, 281) bemerkt: „In diesem Licht muss gefragt werden, ob der evangelikale Aktivismus tief genug gegründet ist, um den eigenen Einsatz für die Welt durchhalten zu können, oder ob er allzu früh austrocknen wird, was zu Entmutigung, mangelnder Ausdauer und einem erneuten Rückzug aus der Welt führen müsste.“ In meiner Dissertation habe ich meine Überzeugung ausgesprochen, dass Tidballs Frage positiv beantwortet werden kann:
Man wird aber davon ausgehen können, dass die breite Aufnahme des erweiterten Missionsverständnisses in der Zwei-Drittel-Welt und in jüngster Zeit vermehrt auch im Westen, ein unumkehrbarer Trend ist, ja man wird von einem Paradigmenwechsel sprechen dürfen, der die missionstheologische Diskussion der Evangelikalen im 21. Jahrhundert prägen wird. (Hardmeier 2008, 75)
Von einer europäischen Warte aus mag die neuere Weltzugewandtheit der Evangelikalen als Aktivismus erscheinen, weil der Gedanke verhältnismäßig neu ist und wenig theologische Arbeit in dieser Hinsicht geleistet wurde. In der Zwei-Drittel-Welt sieht die Situation hingegen anders aus. Die radikalen Vertreter Lateinamerikas waren die ersten Evangelikalen, die sich in den 1960er Jahren mit dem Weltbezug der Mission zu befassen begonnen haben. Von ihnen liegen zahlreiche Publikationen vor, in denen die vielfältigen Aspekte von Mission als Transformation theologisch ausgelotet worden sind. Mit diesem Buch möchte ich einen Beitrag zur Diskussion leisten, denn es steht außer Frage, dass weitere theologische Arbeit geleistet werden muss. Die Fehler der 1970er Jahre dürfen in Europa nicht wiederholt werden. Viele junge evangelikaler Leiter waren damals vom Ruf, die Welt zu verändern begeistert. Die Begeisterung hat sich nicht als nachhaltig erwiesen. Die evangelikalen Kirchen in Europa haben keine soziale Agenda entwickelt und sind im alten Paradigma stecken geblieben. Offenbar fehlte es an gründlicher theologischer Arbeit, die deutlich gemacht hätte, dass die Zuwendung zur Welt, der Dienst an den Armen und die Veränderung der Gesellschaft eine solide biblische Grundlage hat.
Anmerkungen
1Auf diesen Umstand wies Harold Lindsell in Christianity Today hin (Nr. 10, 29. April 1966, 795).
2Latin American Congress on Evangelism vom 21.–29. November 1969 in Bogotá, Kolumbien.
3Der Thanksgiving Workshop on Evangelicals and Social Concern, der von Ronald Sider geleitet wurde. Sider wurde in der Folge zu einem der westlichen Hauptvertreter des radikalen Evangelikalismus.
4Zu den Verbindungen des erweiterten Missionsverständnisses mit der Befreiungstheologie und der kontextuellen Theologie siehe Kapitel 3.
5Zum Begriff „kontextuelle evangelikale Theologie“ siehe Kapitel 3.
6Der Zweite Lateinamerikanische Kongress über Evangelisation in Lima vom 31. Oktober bis 8. November 1979.
7Die All India Conference on Evangelical Social Action vom 2. bis 5. Oktober 1979 in Madras, Indien. Der deutsche Text der Madras Deklaration findet sich bei Sugden (1983, 147–151).
8Der deutsche Text findet sich in Burkhardt (1981).
9Der Konferenzband von Bangkok liegt auf Deutsch unter dem Titel Der ganze Christus für eine geteilte Welt: Evangelikale Christologien im Kontext von Armut, Machtlosigkeit und religiösem Pluralismus vor. Er wurde von Vinay Samuel und Chris Sugden herausgegeben.
10Der Konferenzbericht samt Schlussmanifest liegt auf Deutsch unter dem Titel Evangelisation mit Leidenschaft vor. Er wurde 1990 von Horst Marquart und Ulrich Parzany herausgegeben.
11Der Schotte Houston war damals neu gewählter Direktor der Lausanner Bewegung und früherer Präsident des Hilfswerks World Vision.
12Diese theologische Reflexion ist nicht verwunderlich, entstand der Abschlussbericht doch unter der Federführung von Vinay Samuel, einem radikalen Hauptvertreter. Samuel hatte in den Jahren vor Manila die Bedeutung der Armut für das Evangelium gründlich reflektiert und zahlreiche theologische Beiträge dazu verfasst.
13Das folgende Zitat ist auszugsweise wiedergegeben.
14Der Text entspricht der offiziellen deutschen Übersetzung „Pattaya II – Erklärung des Lausanner Forums 2004“ von Christof Sauer.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.