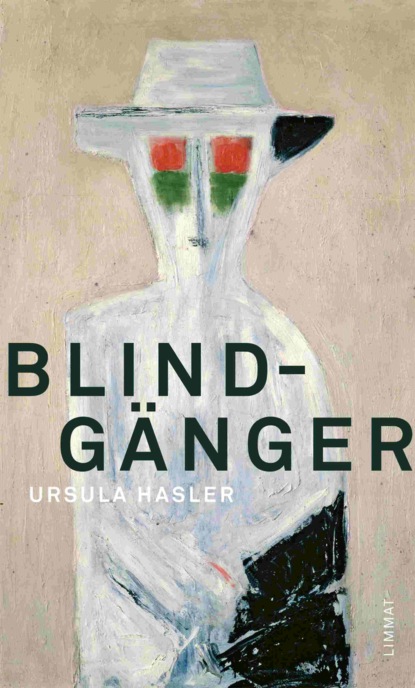- -
- 100%
- +
Darüber wolle sie nicht sprechen, das finde er bestimmt in aller Ausführlichkeit in seinen eigenen Aufzeichnungen. Sie beschleunigte ihre Schritte, sodass sich der Abstand zwischen ihnen wieder vergrößerte. Der Kiesweg bog um die Büsche und endete vor dem Herrn Kurhoteldirektor. Sie blieb stehen, die Gründerfigur des ehemaligen Kurhotels in Überlebensgröße mit steinernem Gehrock, Stock und Hut in der Hand, ein patriarchalisches Lächeln unter dem majestätischen Bart, mit festem Blick in die erfolgreiche Zukunft. Nase, Stirn und Haar weiß gefleckt, jahrzehntealter Taubendreck, dem auch der Regen nichts mehr anzuhaben vermochte. Der Herr Kurhoteldirektor trug es mit Würde. Kam ohnehin selten einer bis in die hinterste Parkecke. Sie drehten um, nur ein Weg führte weiter, im großen Bogen zurück. Die Baumwipfel rauschten, unten zwischen den Büschen war es angenehm windstill, auch heute keine Fernsicht, in großer Höhe zogen dunkle Wolken über den weißen Himmel.
Marty blickte mich leicht verunsichert an, die Notizheftrolle mit beiden Händen umklammert. Sie habe gezögert, ihren Mann zu beschreiben, auf der Hut, in ihren Augen habe er Zweifel an seinem Gedächtnisverlust gelesen. Es scheine viel Misstrauen zwischen ihr und dem Mann gegeben zu haben. Ihm sei klar geworden, dass sie ihm genau das erzählen würde, was er denken solle. Jetzt hatte sie die Gelegenheit, ihrer beider Ehevergangenheit ganz nach ihren Absichten und ohne Protestmöglichkeit seinerseits zu beschreiben. Beim Sprechen habe sie Augenkontakt vermieden. Er habe in ihrer Stimme viel enttäuschte Erwartungen gehört, wenn auch das, was sie über ihren Mann sagte, eher nach Nichts-Schlechtes-über-einen-Toten-sagen als nach ehrlicher Meinung klang.
Sie sei sichtlich verunsichert gewesen, ob sie im Präsens oder in der Vergangenheitsform über ihn reden sollte. Ja, was kann ich dazu sagen, du entzogst, also du entziehst dich erfolgreich allen nachbarschaftlichen Annäherungen und den damit verbundenen Verpflichtungen, die sozialen Kontakte pflege vor allem ich. Auch um die Erziehung der Tochter kümmere ich mich in erster Linie, du bist zwar körperlich anwesend, geistig aber meist anderswo. Eigentlich genau wie jetzt, fügte sie bitter an. Irgendwann habe sie aufgehört zu fragen, was er eigentlich ständig lese und schreibe. Er sei eher nicht so entscheidungsfreudig, um nicht zu sagen konfliktscheu. Geschätzt im Lehrerkollegium, sie habe den Eindruck auch von den Schülern, und äußerst charmant, wenn ihm danach sei. Er könne brillante Diskussionen führen, um ein Gegenüber zu beeindrucken, bei dem es sich lohne, aber auch scharf und sarkastisch sein, wenn ihn jemand nerve. Nein, ein Langweiler bist du nicht.
Sie schwieg, ergänzte dann, dass er nach der Zeit in Royan stark verändert gewesen sei, sehr launisch, nur noch Extreme, mal sprühend vor Zuvorkommenheit ihr gegenüber, dann plötzlich kränkend abweisend. Etwas sei in Royan vorgefallen. Eine andere Frau, vielleicht. Vielleicht auch nicht, sie habe nie irgendwelche Hinweise gefunden. Mehr hatte sie nicht sagen wollen und war bei den letzten Worten seinem Blick noch hartnäckiger ausgewichen.
Besser das Thema wechseln. Zweite Frage, ihr Mann – es war ihm einfach nicht möglich, ich zu sagen – habe in Royan einen Weiterbildungskurs für Französischlehrer besucht, weshalb habe er sich denn mit der Besatzungszeit beschäftigt?
Sie nickte. Jeder Teilnehmer hatte ein landeskundliches Thema als persönliches Projekt zu bearbeiten. Du bist ja auch Historiker und hast deshalb als Thema die Besatzungszeit durch die Deutschen gewählt. Royan an der Atlantikküste war nicht nur besetzt, sondern befestigt, Atlantikwall, und wurde kurz vor Kriegsende von den Alliierten bombardiert und dem Erdboden gleichgemacht.
Ja, das hatte er in den Notizen gelesen. Aber ihr Mann erwähne persönliche Recherchen, die er damit verbinden wollte. Etwas, was mit einem Besuch bei seiner Mutter an Ostern in Verbindung stand.
Sie blieb stehen, schaute ihn lange und nachdenklich an. Nein, von persönlichen Recherchen wisse sie nichts, aber eine Ahnung, worum es gehen könnte. Sie blickte sich um, suchte eine Bank, wo sie ungestört sein konnten.
Inzwischen kreuzten sie immer häufiger andere Klinikgäste, die Mittagsruhe war zu Ende. Den einen oder die andere kannte er aus dem Speisesaal, er grüßte und ignorierte ihre neugierigen Blicke auf seine Begleiterin, stellte sie niemandem vor, als was auch.
Als sie eine leere Bank gefunden hatten, zögerte sie plötzlich, setzte sich nicht, schaute vielmehr auf die Uhr, sie müsse zurück, sie habe um halb vier noch einen Termin. Er solle besser seine Mutter fragen, sie komme ja am Sonntag. Sie bedaure. Sie wich einem Spaziergänger aus und eilte davon, flüchtig zurückwinkend. Es sah ganz nach Flucht aus.
Also habe er sich alleine auf die Bank gesetzt, die Arme verschränkt und die Beine gestreckt, passender Moment für eine Zwischenbilanz. Mehr als zwei Wochen war er nun hier, er habe die Besuche Revue passieren lassen, die Frau kam heute zum dritten Mal, vor drei Tagen war überraschend der Bruder erschienen. Sein Besuch dauerte nur kurz, es gab wenig zu sagen, von seiner Seite ohnehin nichts, aber auch der Bruder blieb merkwürdig wortkarg, die Brüder schienen nicht sehr verbunden zu sein.
Er habe versucht, die verschiedenen Gespräche wieder aus dem Gedächtnis abzurufen, schwierig, Kopfschmerzen kündigten sich sofort an. Er notiere deshalb nach jedem Gespräch sorgfältig, was er als behaltenswert erachte. Er hielt die Hand hoch, in der sich die Heftrolle gerade befand. Sich Neues zu merken erweise sich als äußerst anstrengend. Er könne das Gehörte nicht mit Bildern verknüpfen, auch nicht mit Tönen oder Gerüchen.
Das Mädchen sei gestern zum zweiten Mal gekommen, sie mochte ihren Papa und habe es ihm offen gesagt, vermutlich keine Selbstverständlichkeit bei einer Sechzehnjährigen. Sie hatte ihren schulfreien Nachmittag geopfert, kam mit Zug und Bus hierher, nur um ihrem Vater einen Besuch abzustatten, einem Vater, der vermutlich immer stärker mit seinen eigenen Dingen beschäftigt war als mit seiner Tochter. Er habe Nadine an der Bushaltestelle abgeholt, sie verspürte keine Lust auf einen langweiligen Spaziergang, also setzten sie sich auf die Terrasse der Klinikcafeteria und bestellten für sie einen Eisbecher und für ihn ein Bier.
Das Mädchen kicherte, du hast mich noch nie so offiziell auf ein Eis eingeladen. Dann verlegenes Schweigen. Er konnte doch unmöglich fragen, na, wie war denn dein Vater so?, und noch weniger, na, wie war ich denn so als Vater? Er habe sie die ganze Zeit aufmerksam beobachtet, ihre Gesten, die unnachahmliche Weise, wie sie die zu langen Ponysträhnen aus dem Gesicht pustete, bevor der nächste Löffel Eis in den Mund geschoben wurde, wie sehr möchte er die Bilder von früher im Kopf finden. Ein kleines Mädchen, das auf seinem Arm ein Eis am Stiel schleckt, es tropft auf seinen Ärmel. Eine klebrige kleine Hand, die sich vertrauensvoll von der sicheren Vaterhand führen lässt. Nichts. Kein Bild. Kein Gefühl. Sie beugte sich nach vorn und meinte verschwörerisch, er habe ihr ohne Wissen von Mama öfter großzügig etwas zugesteckt, wenn das Taschengeld wieder alle war.
Marty sah mich hilflos an, nicht einmal das habe er richtig einzuordnen gewusst, brauchte sie etwa Geld? Er habe ihr zwanzig Franken über den Tisch geschoben. Sie habe gestrahlt und weitergeplaudert. Als ihr irgendwann auffiel, wie wortkarg er war, habe sie geseufzt, und nun behaupte er, nichts mehr zu wissen, das verstehe sie einfach nicht.
Nachdenklich blickte Marty auf das Heft in seiner Hand, er hoffe sehr, dass ihr Vater stolz auf sie war und es ihr auch gesagt hat. Ihr hilfloser Schmerz beschäftige ihn, er habe ihr den Vater weggenommen, den sie mit sechzehn mehr denn je brauche. Nadine habe schließlich gemeint, eigentlich sei es nicht so schlecht, wenn er von ihren Dummheiten nichts mehr wisse und ihre Streiche vergessen habe, davon erzähle sie ihm bestimmt nichts. So könne sie nun alles richtig machen. Er habe geschwiegen, ihm blieb das Richtigmachen verwehrt, ohne Vorstellung, was ihr Vater früher alles falsch gemacht hatte. Auch keine Vaterschaft lässt sich weiterführen, wenn nur einer die Geschichte kennt.
Aber Nadine war rührend, so ein Gedächtnisverlust sei doch eine unglaubliche Chance, nochmals anzufangen. Diesen Satz der Sechzehnjährigen habe er sofort aufgeschrieben, sie habe ihm die Augen geöffnet. Ja, was auch immer diesen Jean-Pierre Marty früher belastet hatte, war nun einfach weggepustet. Er sei zwar ein Heimatloser in seinem eigenen Leben, aber frei.
Ich nickte, das sei ja schon eine ganze Menge. Und zum Schluss, was sich denn nun auf dem Laptop befinde?
Marty nickte, eine umfangreiche Sammlung von tagebuchartigen Dokumenten aus der Zeit in Royan, alle ohne Titel, aber mit Datum, die ersten habe er gelesen, dann einzelne herausgepickt, zudem noch ein ziemlich großes PDF, könnte ein Manuskript sein, er sei ratlos. Eher unwahrscheinlich, dass ihm die stichwortartigen und für ihn oft unverständlichen Aufzeichnungen helfen würden, die Person dieses Jean-Pierre Marty zu verstehen. Die Hoffnung, dass sie ihm eine Spur zu seinem verschütteten Gedächtnis öffnen könnten, zerbrösle, je mehr er davon lese. Ihm fehlten zahlreiche Fakten, um Anspielungen einordnen zu können. Denn etwas habe er in seiner anfänglichen Euphorie nicht bedacht. Die persönlichen Notizen seien nicht für das Lesen durch fremde Augen bestimmt gewesen, Marty habe mit wenigen Ausnahmen weder Hintergründe noch Fakten notiert, die kannte er ja, meist nur kryptische Eindrücke, Beobachtungen, Gefühle. Kurz, die Notizen seien für Außenstehende schwer verständlich und erwiesen sich nun für das Wiederlesen durch den Schreiber mit Gedächtnisverlust als unnütz.
Ich schüttelte den Kopf, dessen sei ich mir nicht so sicher. Es war sein letzter Satz, der mich auf die unorthodoxe Therapie brachte. Da war vor einigen Monaten ein Fachartikel zum Thema Sprache und Erinnerung erschienen, die Rolle des Erzählens beim Speichern von Erinnerungen, der mich fasziniert hatte. Ich hatte der Thematik nachgehen wollen, mangels Zeit jedoch die Sache ad acta gelegt. Jetzt bot sich unvermutet eine einmalige Gelegenheit. Denn, fuhr ich fort, es gebe durchaus Hoffnung. Die PET/CT-Untersuchungen der Uniklinik zeigten zwar, dass im rechten Schläfenlappen, wo die Steuerung des autobiografischen Gedächtnissystems vermutet wird, der Stoffwechsel praktisch inaktiv sei, obwohl bei ihm keine Gewebeschädigung vorliege. Es gebe verschiedene Gründe, weshalb die biochemischen Austauschprozesse in dieser Gehirnregion gestört sein könnten, zum Beispiel Ausschüttung eines blockierenden Stresshormons. Das sei durchaus beeinflussbar. Ich würde ihm nun eine ungewöhnliche Behandlungsmethode vorschlagen, die ich wissenschaftlich begleiten wolle.
Dazu müsse ich etwas ausholen. Der Mensch kenne mittels eines ordnenden Gedächtnisses seine Vergangenheit, er habe eine mentale Vorstellung, wer er in der Gegenwart ist, und weil der Mensch auch wisse, dass er unaufhörlich auf seinen Tod zugehe, verhülle das menschliche Bewusstsein dieses unerträgliche Wissen mit Zukunftsplänen. Kurz, der Mensch könne kraft seines Bewusstseins seine eigene Geschichte erzählen, gestalten und planen.
Marty folgte mir stirnrunzelnd.
Ihm sei momentan durch eine Blockade der Zugang zu seiner Vergangenheit verwehrt, damit die Grundlage der gegenwärtigen Identität entzogen und die Imagination für Zukunftsplanung verunmöglicht. Auf der andern Seite liege ihm außergewöhnlich viel sprachliches Material in Form von eigenen Tagebuchnotizen vor, die ihm zurzeit fremd und unverständlich erschienen, aber eine einmalige Chance darstellten, zumindest die fehlende Vergangenheit der letzten Monate mittels Sprache wieder Wirklichkeit werden zu lassen.
Mein Vorschlag: Er solle die Journaltexte auf dem Laptop als Stoff, als Material für seine Wunschvergangenheit betrachten. Er solle sich das dort Erzählte aneignen und so umformulieren, dass es seine Aufzeichnungen würden. Er dürfe hemmungslos eingreifen, weglassen, erfinden. Fabulieren solle er, fantasieren, erdichten, die Gedanken im Journal zu seinen eigenen machen, die Notizen der drei Monate in Frankreich neu schreiben, sodass es seine Geschichte werde.
Marty starrte mich zweifelnd an, und wie das mit der Wahrheit sei? Wie es wirklich war?
Kein Problem, ich persönlich würde ihn von der moralischen Wahrheitspflicht entbinden. Als Bestätigung unterstrich ich die Vergabe meiner therapeutischen Lizenz zum Lügen noch mit einer wegwerfenden Geste. Was in den vorliegenden Aufzeichnungen stehe, stelle bloß eine Wahrheit dar. Er sei frei für andere Wahrheiten. Übrigens, was das Gedächtnis als Erinnerung darstelle, wenn wir etwas Vergangenes erzählen, habe weder mit realen Erlebnissen noch mit Wahrheit etwas zu tun. Es präsentiere eine Version, die zum aktuellen Zeitpunkt gerade die passendste sei. Erinnerungen sind immer Fiktionen, die wir laufend anpassen und neu erzählen. Sie haben ein neues Ich, aber keine Vergangenheit dazu? Dann erfinden Sie sie.
Aha, ich würde also nicht beabsichtigen, die Gedächtnisblockade mit Gedächtnistraining zu therapieren. Ich wolle seine Blockade oder vielmehr ihn überlisten, via Hintertür des Wunschdenkens und Neuerfindens die tatsächlichen Erinnerungen zu provozieren. Ja, das Spiel gefalle ihm, obwohl er selbst der Proband sei. Er nickte, einverstanden.
Zwei Tage später bat er einen Pfleger, mich rufen zu lassen, es hätten sich neue Erkenntnisse ergeben, über die er mit mir vor unserer nächsten Sitzung sprechen müsse, es sei fraglich, ob er dann wie ausgemacht die ersten Überarbeitungen der Royantexte mitbringen könne. Als ich ins Zimmer trat, lag Marty auf dem Bett, ein feuchtes Tuch auf der Stirn, die Balkontüren weit geöffnet.
Nie zuvor hätten ihn solch stechende Kopfschmerzen angegriffen, jetzt verlangsame sich das Hämmern zum Glück, und zwar mitten im Gespräch mit der liebenswürdigen alten Dame, der Mutter von Jean-Pierre Marty, die nicht seine biologische Mutter sei, was er bereits wusste. Der Tatsache, dass sein Alter Ego, so nenne er den Andern jetzt, adoptiert war, habe er bisher nicht so viel Wichtigkeit beigemessen, bloß ein interessantes biografisches Detail. Er habe die Bedeutung gewaltig unterschätzt, ein Lebensdrama war damit verbunden. Die Mutter sei bereits einmal im Spital vorbeigekommen und habe ihre Tränen nicht zurückhalten können. Erst jetzt, nach diesem Besuch, verstehe er ihren mysteriösen Satz, sie habe ihn ein zweites Mal verloren.
Ich setzte mich in den Lehnstuhl, womit wir uns, ohne es zu beabsichtigen, in klassischer Therapieaufstellung wiederfanden, mit dem kleinen Unterschied allerdings, dass ich nicht am Kopfende, sondern zu seinen Füßen saß. Aber Marty war in jeglicher Hinsicht mein Sonderfall. Erzählen Sie bitte.
Auch mit ihr sei er im Park spazieren gegangen, die alte Dame war nicht mehr so gut zu Fuß, sie gehe leicht gebückt, klein, aber mit Haltung halte sie das Alter im Griff, elegante Kleidung, bestimmt vor Jahren maßgeschneidert, trägt sie mit zeitloser Würde, er sei der liebenswürdigen Dame sehr zugetan. Dann habe er sie nach jenem Ostermittagessen bei ihr gefragt. Sie war nach seiner Frage direkt auf die nächste Bank zugesteuert, es erzähle sich besser im Sitzen. Sie habe seine Hand genommen, sie trug feine weiße Stickereihandschuhe.
Du kennst die Fakten, begann sie, du hast von der Adoption erst als Dreißigjähriger durch einen unglücklichen Zufall erfahren, dein Bruder hatte damals einen schweren Unfall, und es ging um eine Blutspende, die Blutanalyse ergab, dass ihr beide nicht verwandt sein konntet. Natürlich sei es dumm von ihnen gewesen, ihm das nicht früher zu sagen, aber der Zeitpunkt sei eben nie der richtige bei unangenehmen Sachen. In blinder Kränkung habe er jahrelang nicht mehr mit ihnen gesprochen.
Die Stimme der alten Dame zitterte kaum merklich. Er habe ihnen den Verrat, so nannte er ihr Verschweigen der Adoption, nicht verzeihen können. Erst als seine Tochter auf der Welt war, habe er seine sture Haltung gelockert. Sie und Vater hätten sehr unter der Zurückweisung gelitten. Du, der aufgeklärte, rationale Intellektuelle, bist durch die Entdeckung, dass zwischen dir und uns keine Blutsbande bestanden, in eine existenzielle Krise gestürzt. Was haben wir uns nicht alles anhören müssen. Die Familie eine einzige große Lüge, keine verwandtschaftliche Beziehung, keine Großeltern und Urgroßeltern, hinter dem Zeitpunkt der Geburt weiße Leere. Ja, du hast deinen Weltschmerz kultiviert. Sie habe seine Selbstbemitleidungen irgendwann nicht mehr hören können.
Marty schob das Stirntuch beiseite, setzte sich auf und blieb gebückt am Bettrand sitzen, den Kopf in die Hände gestützt. Die Mutter habe an jenem Ostersonntag ihm und seiner Familie erstmals alle Einzelheiten seiner Adoption erzählt, ausgelöst durch Nadine, die für eine Geschichtsarbeit ihren Familienstammbaum recherchieren sollte. Er dürfe auf keinen Fall vergessen, das Mädchen beim nächsten Besuch nach dieser Arbeit zu fragen. Mutters Erzählung, er habe alles stichwortartig aufgeschrieben, hier, er reichte mir sein Notizheft.
Ich winkte wiederum ab, er möge es mir bitte vorlesen.
Hochzeit der Eltern 1939, kurz danach Generalmobilmachung, Geburt des Bruders Daniel 1942, mit Komplikationen, keine weiteren Kinder möglich. Vater im Grenzdienst, bei Waldarbeiten verwundet, wurde 1944 entlassen. Leiter der freiburgischen Kantonalbankfiliale in Murten, ehrenamtlicher Treuhänder verschiedener Heime im Kanton, Familie nahm mehrmals Flüchtlingskinder auf, zeitlich befristet, Kinder mussten zurück. Mutter litt, wollte noch ein Kind adoptieren.
Marty blickte auf. In einem Nonnenkloster mit Kinderheim, Frankreich war nicht weit weg, habe es einige Flüchtlingskinder gegeben, die illegal über die jurassische Grenze gebracht und so gerettet wurden. Es waren vor allem Kriegswaisen oder Kinder, die in den Flüchtlingsströmen ihre Eltern verloren hatten, davon gab es Hunderte, sie waren beim Roten Kreuz gemeldet. Aber auch Kinder, die man bei der Kirche versteckte, weil ihre Eltern deportiert wurden. Vichy-Frankreich sei in der Judenverfolgung ja übereifrig gewesen. Die Schwestern brachten die Kinder bei ihren Ordensgemeinschaften in der Schweiz unter, mit dem stillschweigenden Einverständnis der Schweizer Grenzwache. Beim Grenzübertritt schauten die vermutlich konzentriert durch ihre Feldstecher oder auf die andere Seite.
31. Juli 1945, Vater brachte aus dem Heim einen kranken Säugling, Vollwaise, zur Pflege in die Familie, keine Geburtspapiere, der Säugling sehr klein und das Alter schwierig zu bestimmen, Arzt schätzte etwa vier Monate, also wurde der 31. März 1945 als Geburtstag in die Adoptionspapiere eingetragen.
Der «Andere» sei an Ostern völlig in Rage gekommen, weil auch der Geburtstag ein beliebiges Datum war, sein ganzes Leben eine einzige Erfindung, seine Identität eine reine Fiktion. Wie immer übertrieben und Mutter sehr gekränkt. Der Kleine wurde Jean-Pierre genannt, die französische Version von Hanspeter, Vorname seines Adoptivvaters. Der Säugling war lange kränklich, hatte vermutlich Traumatisches erlebt, lange blieben sie im Ungewissen, ob er durchkommen würde. Für Mutter war sein Überleben ein Sieg über den Krieg.
Das Wichtigste komme jetzt, Marty vergewisserte sich, dass ich zuhörte. Offizielle Bescheinigung des französischen Staates, dass Eltern unbekannt, Findelkind, leibliche Eltern vermutlich in den Befreiungskämpfen an der Westküste Frankreichs umgekommen, Kriegswaise, somit adoptierbar. Nonnen verweigerten weitere Auskünfte. Adoptivvater fand dank Beziehungen später heraus, dass das Kind aus dem Département Charente gekommen sein müsse, Gegend zwischen La Rochelle und Girondemündung, dort heftige Befreiungskämpfe und Bombardierungen Anfang 1945, die Deutschen in Atlantikfestungen verschanzt. Säugling war vermutlich Waisenkind nach Bombardierung.
Ihm sei nun klar, welche Recherchen der Andere mit seinem Weiterbildungsurlaub verbunden habe. Ein verrückter Kerl, seine Familie aufspüren zu wollen, ohne verlässliche Hinweise, nicht einmal seinen Familiennamen kannte er. Bloß ein Monogramm, GQ, falls die Mutter die gestickten Buchstaben auf dem Tuch richtig gelesen hatte, das einzige materielle Indiz für die Herkunft. Der Säugling war den Schwestern in einen Kissenbezug und ein Stück Wolldecke eingewickelt übergeben worden. Sagten sie jedenfalls. Mutter hütete das Stoffstück wie eine Reliquie und hatte es dem Andern vor einem Monat, kurz vor dem Unfall, geschickt.
Und jetzt, erregt stand Marty auf und begann im Zimmer auf und ab zu marschieren, während ich versuchte, durch Sitzenbleiben einen Kontrapunkt zur Unruhe zu bilden. Es bestehe kein Zweifel, er stehe am selben Punkt. Eine Vergangenheit zu finden, zu der alle Verbindungen gekappt waren. Aber diesmal mit miserablen Karten. Mit dem Gedächtnisverlust werde die große Lebensproblematik der unbekannten Vergangenheit quasi wiederholt, nein, auf die äußerste Spitze getrieben. Marty rieb sich die rechte Schläfe, die stechenden Kopfschmerzen hatten schlagartig wieder eingesetzt. Er blieb an der geöffneten Balkontür stehen, holte tief Luft. Er, der Mann ohne Vergangenheit, müsse die Erinnerungen eines Mannes finden, der selber auf der Suche nach seiner Vergangenheit war. Wer blicke da noch durch. Was, wenn der Andere vor dem Unfall nichts über seine Herkunft herausbekommen hatte? Dann suche er jetzt die Identität von einem, der nicht wusste, wer er war. Er frage sich, ob er die Erinnerungen des Andern, falls sie wieder auftauchten, überhaupt ertragen würde.
Er starrte durch die Baumwipfel in die Ferne. Draußen begann es zu dunkeln, hinter den schwarzen Umrissen der Parkbäume funkelte tiefblau der Abendhimmel.
Marty presste beide Fäuste gegen die Schläfen, es muss einfach einen tieferen Sinn für diesen wahnwitzigen Albtraum geben. Erregt schloss er die Balkontür und setzte sich mir gegenüber an den Tisch, der alte, verzogene Fensterflügel klirrte ob der uneleganten Heftigkeit.
Er zermartere sich das bockige Gehirn, wie es nach der Klinik weitergehe. Man könne das kaum als Leben bezeichnen, so wie er zurzeit Tag für Tag hinter sich bringe und mühsam einen Lebenslauf zusammenstückle, der ihn zunehmend befremde. Leben bedeute doch, Wünsche zu haben. Er habe keine. Ohne Erinnerungen keine Wünsche und somit auch keine Lebensziele. Da habe einer die Tür hinter ihm zugeschlagen. Die Neuschreiberei des Journals bringe nichts, er bedaure, aber er steige aus dem Schreibprojekt aus.
Ich hatte es geahnt, wollte aber unter allen Umständen den vorzeitigen Abbruch verhindern. Falls es nicht gelingen sollte, damit die Gedächtnisblockade zu lockern, nicht einmal Haarrisse zu provozieren, durch die feinste Erinnerungen zu dringen vermochten, dann habe er sich mit den neu formulierten Texten immerhin doch Wunscherinnerungen erschrieben, habe zumindest etwas in der Hand respektive im Kopf, und vielleicht reiche dies bereits, damit sich Ziele und Wünsche für die Zukunft formierten, seien sie noch so bescheiden.
Marty blickte mich nachdenklich an. Klingt nachvollziehbar. Er stand auf, begann zwischen Tisch und Fenster hin und her zu gehen, blieb dann schließlich vor mir stehen. Gut, er werde also versuchen, mögliche, wahrscheinliche, wünschbare Vorstellungen zu entwerfen, wie das Leben seines Alter Ego in den vergangenen drei Monaten gewesen sein könnte. Aber er zweifle, ob man mit Wörtern das Vergessen zurückbuchstabieren könne. Trotz Lizenz zum Lügen. Sein Lächeln geriet ziemlich schief.
Das war am Sonntagabend, am folgenden Freitagmorgen brachte Marty die ersten Überarbeitungen seines Royan-Journals, oder, wie er zu sagen pflegte, der «Aufzeichnungen des Anderen», auf dem USB-Stick zum Ausdrucken ins Sekretariat und hinterließ die Mitteilung, dass er um ein zusätzliches Gespräch mit mir außerhalb der abgemachten Sitzungen bitte, so bald wie möglich.
Royan, Montag, 5. Mai 2003
Die Geschichte ist besser vorstellbar, wenn zuerst die Kulissen aufgestellt werden. Royan. Badeort mit kleinstädtischem Charakter an der französischen Westküste, genauer am nördlichen Ufer der Girondemündung gelegen, es ist nicht ganz klar, ob das Wasser bereits dem Atlantik oder noch der Gironde gehört, jedenfalls salzig, aber in der Ferne sieht man das gegenüberliegende Ufer. Achtzehntausend Einwohner und in der Badesaison über hunderttausend mehrheitlich französische Sommergäste. Vorzeigestadt für Fünfzigerjahre-Stadtarchitektur, fast in Reinkultur, fast museal. Architekturschulen studieren am Objekt die für den Wiederaufbau in den Fünfzigern entwickelte neue Architektursprache, royano-brésilien. Eine Mischung von Bauhaus aus den Zwanzigern, Art déco aus den Dreißigern und dem brasilianischen Lyrismus eines Oscar Niemeyer aus den Vierzigern. Jedenfalls gewöhnungsbedürftig.