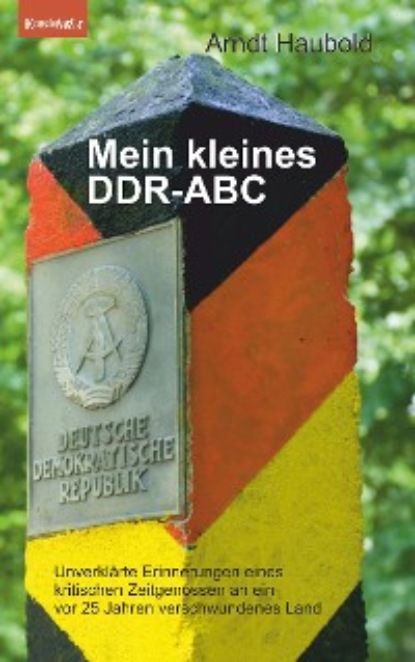- -
- 100%
- +
Dieser Siegeszug der Chemie über die Natur war kein auf die DDR beschränktes Phänomen. Es besteht weltweit noch heute und hat inzwischen etwas mit dem Weltmarkt zu tun, hat sich sogar noch verstärkt. Aber in der DDR wurde er politisiert und ideologisiert und als „Fortschritt des Sozialismus“ instrumentalisiert. Das Staatsmonopol über die gesamte Warenwirtschaft hatte zur Folge, dass sich der Kunde nicht zwischen Produkten aus Natur oder Chemie entscheiden, sondern nur das kaufen konnte, was die Mangelwirtschaft überhaupt anbot. Natürlich gab es gute, preiswerte und wirksame Arzneimittel aus Chemie, und nicht alles ist schlecht, was aus Plaste besteht. Aber typisch für die DDR war der Ersatz des guten alten handwerklich Gefertigten durch das industriell minderwertig Hergestellte, die Verdrängung von Qualität durch ständiges Einsparen und nicht zuletzt der Verlust des Schönen. Die politische Ursache dafür war die wirtschaftliche Zerstörung des Mittelstandes.
Den Namen „Chemie“ trugen etliche Fußballmannschaften der DDR. „BSG Chemie Böhlen“ klang ja noch erträglich, vergleichbar wären Namen wie „Braunkohle Borna“ oder „Glas Jena“ gewesen.
Eine spezielle Form der Chemisierung erlebte die DDR-Landwirtschaft. Neben synthetischen Düngemitteln wurden in den Chemielabors der DDR zahlreiche Gifte entwickelt, die in großen Mengen in die Natur gebracht wurden. Felder und Obstplantagen wurden großflächig, zum Teil von Flugzeugen aus, besprüht, manchmal bis zu dreißig Mal im Jahr. Dabei gab es weder ein Maßhalten noch unabhängige Kontrollen noch eine Öffentlichkeit, die auf entsprechende Gefährdungen für Mensch und Tier hinwiesen. In der Schlussphase der DDR fand auch dieses Thema Eingang in die regimekritischen Beiträge zum Umweltschutz. Bekannt ist das Holzschutzmittel „Hylotox“, das jahrelang bedenkenlos im Handel zur Bekämpfung von Holzwürmern verkauft worden war und später heimlich aus dem Verkehr gezogen wurde.
Zu den Schwächen der DDR-Chemie gehörte das Kapitel „Farbe“. Es gab zwar Farben zu kaufen, aber ihre Farbkraft und Qualität konnten mit dem Weltniveau anderer Länder, vor allem der BRD, nicht mithalten. DDR-Farben wurden deshalb bald zum Schimpfwort, die Farblosigkeit (das Grau) der DDR wurde eines ihrer Hauptkennzeichen, und die Entwicklung der Farbfotografie in der DDR blieb hinter jenem Weltniveau chancenlos zurück. Farbfotos wie überhaupt Farbe brachte erst die Wende in unser Leben.
Im Übrigen wurde der DDR-Kunststoff wirklich „Plaste“ genannt, während er im Kapitalismus „Plastik“ hieß!
D WIE DEMONSTRATIONEN
Zwei Staatsfeiertage in der DDR waren für Demonstrationen vorgesehen: der 1. Mai – der „Internationale Kampftag der Arbeiterklasse“ für die gesamte Bevölkerung – und der 7. Oktober – der „Republikgeburtstag“ für die Paradetruppen der NVA. An diesen beiden Tagen und nur an diesen beiden Tagen demonstrierte das gesamte Land seine ideologische Geschlossenheit.
Zum Maiumzug war ein Großteil der Bevölkerung auf den Beinen. Es gab kein Gesetz, das die Teilnahme an den Demonstrationen vorschrieb, aber es herrschte entsprechender Psychoterror. Wer nicht an der Demonstration teilnahm, stellte sich als Staatsfeind bloß. Die Teilnahme wurde gruppenweise organisiert und kontrolliert – Schulklassen, Arbeitskollektive, gesellschaftliche Organisationen traten möglichst geschlossen an. Vornan zog die Blasmusik zu Fuß und auf einem Pferdewagen, es folgten die politischen Notabeln, dann die Werktätigen der Betriebe, die Verkäuferinnen von Konsum und HO, dann die LPG-Bauern, schließlich die Schulklassen, letztere in Pionierkleidung. Natürlich wurden rote Fahnen und DDR-Fahnen vorangetragen, die Kinder schwenkten kleine Papierfähnchen. Die Häuser mussten geschmückt werden, vor allem an der Demonstrationsroute. Dafür wurden kostenlos Fähnchen verteilt, auch junge Birken, mit denen das Hoftor geschmückt werden konnte. Die offiziellen Gebäude trugen Transparente, wie sie auch im Demonstrationszug mitgeführt wurden. Ihre Losungen waren von der Partei vorgeschrieben, eigene Formulierungen wurden nicht geduldet: „Es lebe die DDR und die unverbrüchliche Freundschaft mit der Sowjetunion!“, „Für Frieden und internationale Solidarität!“, „Es lebe die Waffenbrüderschaft mit der ruhmreichen Sowjetarmee!“, „Für eine glückliche Zukunft der Menschheit in Frieden und Sozialismus!“, „Nieder mit den Kapitalisten!“, „Es lebe der Fünfjahrplan!“, „Alle Macht der SED!“, „Für höchste Erträge und vorzeitige Planerfüllung!“ Die Betriebe und die LPG schmückten Lastwagen mit ihren Produkten: Maschinen, Früchte, Produkte. Aufstellung war um neun Uhr auf dem Aufstellplatz, der Zug setzte sich um zehn Uhr in Bewegung, erreichte um elf Uhr sein Ziel im Zentrum, wo eine Kundgebung stattfand. Die Rede dort war für Klein und Groß zum Erbrechen langweilig – die politischen Phrasen der Partei wurden Jahr für Jahr rituell wiederholt. Nach dem Ende dieses offiziellen Teils gab es im Gasthof Freibier und Bockwurst auf Gutschein für die, die an der Demonstration teilgenommen hatten. Allgemein endete der Tag mit kollektivem Besäufnis. Es war das einzige Mal im Jahr, dass ich meinen Vater besoffen nach Hause heimkehren und seinen Rausch ausschlafen sah.
Die Teilnahme an der Demonstration machte den Kindern der niedrigeren Klassen Spaß, denen der größeren Klassen nicht mehr. Den Erwachsenen machte es insofern Spaß, da es ein arbeitsfreier Tag mit Freibier war und der Möglichkeit, Freunde zu treffen. Überzeugten Kommunisten machte es sicher Freude, aber davon gab es nicht viele. Die meisten nahmen in äußerer Haltung, aber innerer Distanz teil. Es war ein politischer Pflichtgottesdienst. Frei von der Demonstrationspflicht waren die Menschen, die nicht in sozialistische Kollektive integriert waren: Hausfrauen, Rentner, Vorschulkinder, Kranke und Behinderte, dazu notorische Außenseiter wie Zeugen Jehovas, Pfarrer oder andere Querulanten, zu denen später auch meine Eltern gehörten. Die Teilnahmeverweigerung stellte einen Protestakt dar, der als Angriff auf den Staat, den Weltfrieden, die Partei, die Regierung und den Sozialismus interpretiert wurde. Entsprechend hoch war der Psychodruck, der noch durch Kollektivstrafen verstärkt wurde: Eine Brigade, die nicht vollzählig an der Demonstration teilnahm, wurde mit Prämienentzug sanktioniert. Das erhöhte den Ärger, ja Zorn der Kollegen auf eigenbrötlerische Abweichler.
Die größte Demonstration war natürlich die offizielle in der Hauptstadt, bei der die Bevölkerung an der Ehrentribüne der Staats- und Parteiführung vorbeidefilierte. Dazu wurden Teilnehmer aus dem ganzen Land, die dazu ausgezeichnet worden waren, kostenlos mit Bussen nach Berlin befördert.
Am 7. Oktober fand in Berlin die jährliche große Militärparade statt, zu der Ehrengäste befreundeter Staaten aus aller Welt eingeladen waren, die auf der Tribüne Platz nahmen.
Andere Demonstrationen waren verboten. Es gab kein Demonstrationsrecht. Vor Faschingsumzügen etwa hatte die Partei fürchterliche Angst.
Das Ende der DDR begann mit dem Aufkommen ungenehmigter Demonstrationen kleiner Gruppen oppositioneller Jugendlicher in den 1980er Jahren: zum Liebknecht-Luxemburg-Gedenken am 15. Januar in Berlin, zur Dokfilmwoche in Leipzig im November, zum letzten DDR-Kirchentag im Juli 1989 in Leipzig und dann nach den montäglichen Friedensgebeten in der Leipziger Nikolaikirche im Sommer 1989.
E WIE EINKAUFEN
Einkaufen in der DDR hatte wenig zu tun mit dem, was heute „Shopping“ heißt. Es war kein Freizeitvergnügen der Überflussgesellschaft, sondern ein Verzweiflungskampf in der Mangelwirtschaft.
Es gab nur einen Bruchteil der Läden, die es heute gibt, viele Spezialläden gab es noch nicht, und es gab keine Supermärkte. Es gab allenfalls die Konsum-Kaufhalle mit einem Grundsortiment, die heute einem Minimarkt entspricht. Selten hatte man in einem Laden alles Erwünschte zur Verfügung, zum Fleischer musste man extra gehen, allenfalls gab es Brot und Brötchen in der Kaufhalle. Man kaufte auch nur kleinere Mengen ein, dafür wenigstens aller drei Tage, keinen Wocheneinkauf. Viele Käufer, vor allem ältere Menschen, hatten kein Auto, sie fuhren mit einem Handwagen oder mit dem Fahrrad einkaufen – oder schleppten schwere Taschen vom Laden nach Hause. Einkaufen war Nahrungssuche. Nahm später das Einkaufen mit dem Pkw zu, gab es wieder wenig Parkplätze, denn die Läden in der DDR, auch die Kaufhallen, waren noch nicht an der Peripherie der Städte zu finden, sondern im Zentrum, wo es oft an Parkplätzen fehlte.
Viele Produkte waren weniger haltbar als heute, weshalb man sie nicht länger bevorraten konnte. Ein Kasten Bier im Sommer verdarb vielleicht schon nach einer Woche, die Milch hielt sich nicht länger als drei Tage, auch nicht im Kühlschrank. Am Sonnabend bildeten sich lange Warteschlangen vor den Bäckerläden, weil die Kunden, die werktags zeitig zur Arbeit gingen, an diesem einzigen Tag der Woche frische Brötchen von einem richtigen Bäcker mit ihrer Familie essen wollten. Der Bäcker gab es einfach zu wenige, obwohl dies der Handwerksberuf war, den die DDR am meisten von politischem Druck verschonte.
Man konnte auch nicht nach Wunsch oder Bedarf einkaufen, sondern musste sich nach den aktuellen Angeboten richten und gegebenenfalls Vorräte horten. Gab es gerade Tomatenmark, musste man mehrere Flaschen kaufen, denn dann gab es ein Vierteljahr lang nie wieder Tomatenmark. Ein erfahrener Käufer mit guten Kontakten zum Verkaufspersonal erhielt geheime Tipps: „Morgen um neun Uhr wird diese Ware angeliefert, kommen Sie um diese Zeit in den Laden, am Nachmittag ist es schon wieder ausverkauft – oder ich reserviere Ihnen etwas unter dem Ladentisch!“
Die Verpackung der Waren war nicht für verwöhnte Kunden gedacht, die keinen Beutel bei sich führten. Es gab auch an der Kasse weder Plastebeutel noch Papiertüten oder Klappkisten. Dafür hatte der Kunde selbst zu sorgen. Die Verpackung der Waren war denkbar einfach. Das meiste war in Papiertüten verpackt, viele Waren gab es noch lose, und sie wurden erst in Ölpapier, danach in Zeitungs- oder Einschlagpapier eingewickelt, zum Beispiel Sauerkraut oder Fischsalat. Obst und Gemüse wurden lose in die Einkaufstasche gesteckt. Es fiel wenig Verpackungsmüll an. Für den Transport der eingekauften Waren benutzten Familien gern den Kinder- oder Sportwagen, in dessen Netz und Bodenkorb alles hineinpasste. Apropos Netz – das Dederonnetz war eines der beliebtesten Transportsysteme. Es passte in die Jackentasche und dehnte sich bei Bedarf um ein Vielfaches aus. Allerdings konnte man eine Zahnbürste oder eine Stange „Pfeffi“ unterwegs auch schnell verlieren.
Das Einkaufen kostete manchmal weniger, manchmal aber auch mehr Zeit. Preisvergleiche entfielen gänzlich. Die Suche nach Alternativen konnte sinnlos oder sinnvoll sein. Gab es den gewünschten Artikel in dem Laden, den man dafür angefahren hatte, nicht, war entweder zu erwarten, dass es ihn nirgendwo gab – oder dass er doch im Umkreis von hundert Kilometern in einem anderen Geschäft noch zu finden war.
In den meisten Bezirkshauptstädten und etlichen anderen größeren Städten gab es zwei Kaufhausketten: „Centrum“-Warenhäuser mit dem umfangreichsten Kleidungsangebot und „konsument“-Warenhäuser der Konsumgenossenschaft mit deutlich geringerem Sortiment. Man musste bei jeder Kleidungssuche zunächst davon ausgehen, dass es entweder die gewünschte Farbe, Form oder Größe nicht gab, und ein erster Einkaufsversuch führte oft noch nicht zum Erfolg. In den 1970er Jahren wurden in den Bezirksstädten Jugendmode-Läden eröffnet, die etwas mehr auf die Bedürfnisse junger Käufer eingestellt waren. Aus heutiger Sicht waren auch sie Wüsten der Langeweile.
Baumärkte waren gänzlich unbekannt, und ihre Entdeckung gehörte zu den eindrucksvollsten Erlebnissen für DDR-Bürger nach der Wende. Ich sollte für einen Bekannten ein Ersatzteil für einen Wasserhahn von einer Westreise mitbringen, aber ich scheiterte an der Fülle der Angebote im Baumarkt und war völlig ratlos und verwirrt. Baumaterialien kaufte man in einer Genossenschaftshandlung ein. Man begab sich ins Büro, bezahlte die Ware, sofern sie vorrätig war, erhielt einen Zettel und suchte dann im Betriebsgelände die Ausgabestelle. Ersatzteile für Klempner- oder Elektrikerarbeiten gab es kaum im Handel zu kaufen, man musste zum Handwerker betteln (oder ihn bestechen) gehen, denn der hatte aufgrund der knappen Warendecke kein Interesse, von der Mangelware noch etwas abzugeben. Hier und da gab es weithin bekannte Geschäfte für „Heimwerkerbedarf“, wo man gelegentlich das Gewünschte fand. Die größte Mangelware war jedoch Holz. Es war fast aussichtslos, Vollholz- oder auch nur Leimholzbretter kaufen zu wollen – man musste Spanplatten nehmen oder sich Bretter aus Latten zusammenleimen.
Für den Einkauf von Gedrucktem galt ebenso: Was in den Regalen der Buchhandlungen stand, war zur Hälfte Agitpropliteratur der DDR, zur anderen Hälfte Klassik. Moderne Literatur, sofern sie interessant für DDR-Leser war, war Bückware, die unter dem Ladentisch gehandelt wurde. Zeitungsläden waren Räume gähnender Leere, die nur durch Tabakwaren oder Lottoannahme so etwas wie öffentliche Läden wurden. Um beliebte Zeitschriften wie „Das Magazin“ oder den „Eulenspiegel“ kaufen zu können, musste man mit der Verkäuferin gut bekannt sein, denn sie wurden nur auf konspirative Rückfrage für erlesene Kunden unter dem Ladentisch herausgereicht. Auf den Bahnhöfen gab es keine Zeitschriftenhandlungen, sondern nur kleine Zeitschriftenkioske. Das Angebot war nur ein Bruchteil des heutigen.
Die Langeweile des Einkaufens wurde auch durch die Einheitspreise („Einzelhandelsverkaufspreis“ – EVP – war auf jedem Artikel aufgedruckt) verstärkt. Es gab weder Saisonschlussverkäufe noch Angebote noch Rabatte – über vier Jahrzehnte hatte jede Ware ihren Preis, den das Amt für Preisbildung der DDR für richtig befand. Er hatte weder mit Angebot und Nachfrage noch mit dem Herstellungswert etwas zu tun, sondern war politisch motiviert. Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs (auch Schulsachen), Mieten und Fahrpreise der öffentlichen Verkehrsmittel mussten billig sein und wurden deshalb hoch subventioniert, technische Geräte, Luxusgüter (dazu zählte auch der Kaffee) und Kleidung hingegen waren oft wesentlich teurer als heute. Das galt nicht für einfache Kinderkleidung.
Um bewusst einzukaufen, gab es keine Möglichkeiten. Weder waren Bio-Produkte noch fair gehandelte Waren bekannt, auch regionale Produkte gab es nur außerhalb des staatlichen Handels beim Bauern zu kaufen, sofern man die DDR-Herkunft vieler Güter nicht als regional bezeichnen wollte Natürlich gab es keine Kleidung aus Bangladesch, keine Tomaten aus Spanien, keine Weine aus Frankreich zu kaufen. Viele Waren stammten aus dem „Ostblock“ – Weine, Obst und Gemüse aus Bulgarien, Rumänien und Ungarn, Schreib- und Spielwaren aus der Tschechoslowakei, Handtücher, Reis und Tee aus China, Apfelsinen aus Kuba. Aus der Sowjetunion gab es im Einzelhandel fast nichts zu kaufen, auch kaum etwas aus Polen. Das gänzliche Wegbrechen dieses Ostmarktes – etwa bei Gemüse wie ungarische Paprika – kann man heute durchaus bedauern.
Einkaufsfahrten unternahmen viele, vor allem aus dem Süden der DDR, in ihrer Endzeit gelegentlich in die Tschechoslowakei. Dort gab es eine größere Fülle und zum Teil bessere Qualität an Sport- und Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf. Jedoch bestand dort die Schwierigkeit, ausreichend DDR-Mark in tschechoslowakische Kronen tauschen zu können.
Technische Geräte einzukaufen, war noch komplizierter als Waren des täglichen Bedarfs. Einen bestimmten guten Staubsauger oder Plattenspieler musste man oft bestellen und erhielt ihn erst nach längerer Wartezeit. Der Einkauf eines Pkws war ein Abenteuer. Doch dazu später.
Das Einkaufen in der DDR glich insgesamt eher der Urgesellschaft, es war von Jagen und Sammeln bestimmt und von Naturalientausch statt von Geldwirtschaft.
F WIE FREIKÖRPERKULTUR
Offiziell war die DDR prüde. Der sozialistische Mensch war zur Arbeit bestimmt, zur Verteidigung der Heimat, zur Nachwuchserzeugung, nicht zur zwecklosen Lebensfreude. Alles „Freie“ hatte den Geruch der Konterrevolution. Pornografie war ebenso verboten wie Prostitution. Natürlich gab es beides unter der Hand, aber man brauchte Geld oder gute Beziehungen, um sie zu genießen. Zur Leipziger Messe blühte selbstverständlich das horizontale Gewerbe im Dienst des sozialistischen Vaterlands und brachte die begehrten Devisen. Manche flotten Feger fuhren auch gern nach Ungarn oder in die Tschechoslowakei und ließen sich dort im Urlaub von Westdeutschen verwöhnen, indem sie sie verwöhnten. Die Partei hatte nie alles im Griff. Aber für den einfachen Arbeiter und Bauern gab es nur den monatlichen Republik-Nackedei – ein einziges Aktfoto in der Zeitschrift „Das Magazin“, die natürlich auch nicht am Kiosk frei verkäuflich, sondern durch eine begrenzte Zahl von Abonnements kontingentiert war. Hinzu kam später ein zweites Nacktfoto im „Eulenspiegel“, selten hatte auch die „Armee-Rundschau“ ein Aktfoto oder das Jugendmagazin „Neues Leben“. Ansonsten strotzten die Titelseiten der DDR-Zeitschriften von prallen Helden bei der Planerfüllung, von Neubauviertel-Erlebniswelten oder von sexy sozialistischen Staatsbesuchen. Inge von Wangenheims Roman „Die Entgleisung“ hatte zum Inhalt, dass ein Eisenbahnwaggon auf dem Weg aus der DDR nach der BRD unglücklich entgleiste und seine verbotene Fracht – Pornografiehefte, die in der DDR, obwohl hier verboten, für die BRD gedruckt worden waren – auf die Wiese ergoss, was zu schweren Turbulenzen führte. Im Übrigen gab es in der DDR vieles nur einmal: den monatlichen Nackedei, das Aufklärungsbuch „Mann und Frau intim“, den Bildband „Aktfotografie“ von Klaus Ender. Gelegentlich konnte man Aktfotografien per Anzeige in der Zeitung käuflich erwerben – sie waren dann als „tschechische Märchenfilme“ oder „Naturfotografien“ getarnt.
Natürlich gab es im Sozialismus auch Mann und Frau, und die Kinder wurden wie in der Urgesellschaft und wie im Kapitalismus gezeugt. Die Gesellschaft der DDR stand unter sexuellem Druck und suchte sich ihre Ventile. Sie fand sie in der Freikörperkultur. Diese war nie verboten worden, aber sie war zunächst ein Randphänomen. Die Moritzburger Teiche, der Ostseestrand auf dem Darß und ähnliche Badestellen waren Geheimtipps. Erst in den 1980er Jahren erschien ein FKK-Führer zu all diesen Stränden, nachdem sie sich ausgeweitet und ein immer breiteres Publikum gefunden hatten: die Kiesgruben in Luppa bei Oschatz, in Naunhof bei Leipzig, in Pahna bei Frohburg und eine wachsende Anzahl von Strandabschnitten an der Ostseeküste. Dort entfaltete sich ein gemäßigt-wildes Leben. Nicht jugendgefährdend wie am französischen Cap d’Agde, aber doch eine kleine Welt ohne FDJ-Bluse, ohne sozialistische Losungen, eine Welt, die Lenin nicht geplant hatte – ein Stück Freiheit. Da wurden abends Lieder zur Gitarre gesungen, da gab es Lagerfeuer, die nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr angemeldet waren, da regelte sich alles von der Basis her – der staatliche Überbau musste lediglich für den geordneten Pkw-Parkplatz sorgen (womit er genug zu tun hatte). Hier begegneten sich der Parteisekretär und der Pfarrer incognito.
Gemessen an der Bevölkerungszahl waren diese DDR-Paradiese stärker besucht als die entsprechenden Areale in der alten BRD. Vielleicht lag es ja auch daran, dass es im Westen mehr schicke, modische Badeanzüge gab, die die weibliche Welt Parade tragen wollte, während die schlichteren DDR-Kostüme aus Malimo weniger Reiz hatten als das, was die Natur den Frauen schenkte. Jedenfalls war die DDR auf diesem Gebiet führend, vielleicht sogar Weltspitze – und sie hatte etwas, das es im gesamten sozialistischen Lager nicht noch einmal gab. Im Zuge der Freikörperkultur bürgerten sich dann im letzten Jahrzehnt der DDR auch gemischte Familiensaunen ein. Auch in einzelnen DEFA-Filmen wurden, nachdem die DDR ideologisch gefestigt schien, gelegentlich züchtige, aber doch verlockende Busen enthüllt. Und im Theater Karl-Marx-Stadt begann mit der Inszenierung von Goethes „Faust I“ 1975 das, was einem heute das Leipziger Schauspiel vergällt: der Auftritt entblößter Körper – jedoch noch nicht in regelmäßigen Kopulationsszenen, sondern indem für eine Minute drei junge Hexen barbusig in der Walpurgisnacht durch die Reihen sprangen. Die Vorstellung im großen Saal der Stadthalle war immer ausverkauft „Die nackte Republik“ – das war die DDR.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.