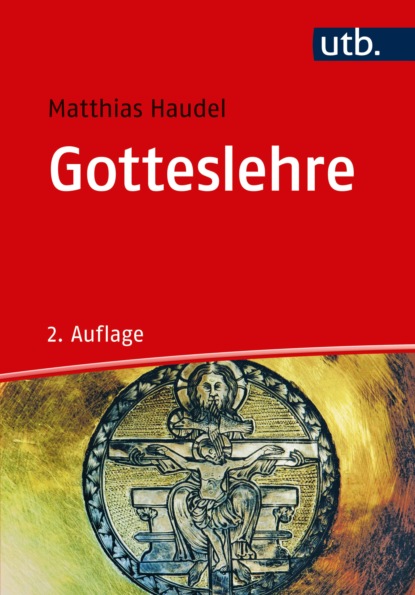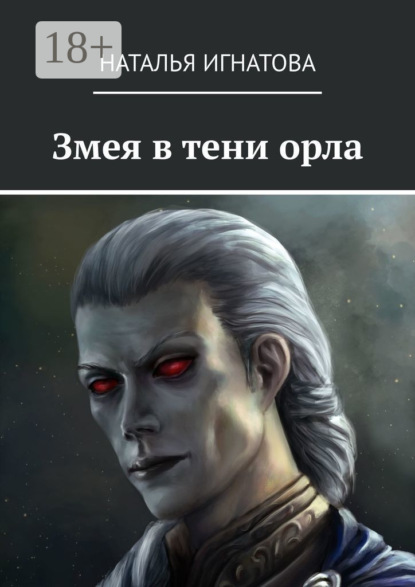- -
- 100%
- +
Die Ursprünge des philosophischen Gottesbegriffs lagen in der Abwendung von den zuletzt genannten Gottesvorstellungen, so bei den Griechen durch die großen attischen Philosophen wie Platon (427–347) und Aristoteles (384–322). Nachdem bereits die Vorsokratiker durch die Überwindung mythischer und polytheistischer Gottesbilder der Vorstellung von der Einheit der Gottheit Raum gegeben hatten, kam die Ahnung der Einzigkeit und Einheit des Göttlichen als Urgrund des Seins bei Platon und Aristoteles vollends zur Geltung. In Analogie zum menschlichen Denken ließ sich Gott als sich selbst denkendes Sein verstehen. Der Mensch hat nach Platon durch seine immaterielle und unsterbliche Seele, die vom Leib lediglich eingeengt wird, aufgrund der eingeborenen apriorischen Ideen seines Geistes die Fähigkeit, am höchsten Urgrund zu partizipieren. Entsprechend wird der Mensch als vom Leib-Seele-Dualismus bestimmtes Geistwesen Teil des kosmischen göttlichen Geistes. In gleicher natürlich-theologischer Ausrichtung beschreibt Aristoteles den ewigen Geist als sich selbst denkende Selbstbeziehung, wobei sich der menschliche Geist zum göttlichen Geist aufschwingen kann, so dass das Göttliche in uns das Göttliche an sich berührt (eth. Nic. 1177 b 28). Die Vernunft gilt als das Ewige und Unsterbliche im Menschen. So werden in der Antike bereits religionsphilosophische Vorstellungen abgebildet, die sich in aktualisierter Form in der Aufklärung mit ihren Konzeptionen idealistischer Überschneidung von göttlichem und menschlichem Geist wiederfinden.3
Dennoch hat sich stets aufs Neue das Verlangen nach einem Gott gezeigt, der als persönliches Wesen verstanden werden kann, weil das der personalen Konstitution des Menschen entspricht. Nach dem biblischen Zeugnis hat sich Gott selbst als personales Gegenüber des Menschen erschlossen, das den Menschen als Ebenbild Gottes (lat. imago Dei) transparent werden lässt und ihm ganz nahe ist. Dieses durch das dreieinige Wesen Gottes ermöglichte Verhältnis von „Gegenüber und Nähe“ eröffnet im Unterschied zu dualistischen und identifizierenden Gottesvorstellungen eine freie personale Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. So kann Gott als Vater das Gegenüber der Menschen bleiben, während er ihnen als Sohn und Heiliger Geist ganz nahe ist – ja sogar im Sohn selbst Mensch werden kann.4 Gegenüber der abstrakten Jenseitigkeit Gottes in einem unitarischen Monotheismus und gegenüber polytheistischen sowie emanatorischen Gottesvorstellungen erschließt das biblische Zeugnis also einen konkreten Monotheismus5, der die lebendige dreieinige Liebe in Gott als Voraussetzung einer persönlichen Gottesbeziehung in freier Gemeinschaft und Liebe offenbart.
Im Blick auf seine allgemeine Verwendung haftet dem Gottesbegriff immer wieder der Horizont der letztgültigen Wahrheit und Seinsgrundlage an – und damit die Dimension des Geheimnisses, das sich aus den weltlichen Zusammenhängen nicht greifen lässt. Dahinter vermag sich eine unverfügbare Eigenwirklichkeit (Aseität) zu verbergen, die auf eine selbstursächliche Einzigartigkeit verweist. So scheint der Gottesbegriff verbreitet ein grundloses Sein zu enthalten, das aus sich selbst existiert – und sich deshalb eigentlich auch nur selbst erschließen kann. Der Gottesbegriff transportiert also ein Geheimnis, das sich dem Menschen zum einen als entzogen erweist, das ihn aber zum anderen als definitives „Woraufhin“ seines Lebens unbedingt angeht. Denn dieses Geheimnis verbindet sich mit der Ahnung einer ersten, aus sich existierenden und alles Sein umfassenden Ursache. Deshalb ist „die Rede von Gott [letztlich] nur dann sinnvoll […], wenn sie ‚Gott‘ als ein auf das Ganze gehendes Wort zu verstehen gibt, dessen besonderer Anspruch universale Geltung einschließt“: Was „im sachgemäßen Gebrauch des Wortes ‚Gott‘ zur Sprache kommt, geht jeden Menschen unbedingt an“6.
2.Die Transzendenz von Welt und Kosmos
In ihrer Endlichkeit weisen Welt und Kosmos zwischen ihrem „Woher“ und „Wohin“ über sich selbst hinaus. Diese Transzendenz erlaubt lediglich die Ahnung eines letzten Grundes und Ziels, so dass Gott nicht aus natürlichen Gegebenheiten zu rekonstruieren ist. Zwar finden sich in der Schöpfung Spuren des Schöpfers, doch aufgrund der von menschlicher Selbstbehauptung geprägten Erkenntnis bleiben sie ambivalent, weshalb angemessene Gotteserkenntnis auf die Selbsterschließung Gottes angewiesen ist. Diese bedarf allerdings um der universellen Nachvollziehbarkeit willen der natürlichen Anknüpfungspunkte. Erst die trinitarisch-heilsgeschichtliche Dynamik von Schöpfung, Erlösung und Vollendung erlaubt die sachgemäße Zuordnung von natürlichen Erkenntnisvoraussetzungen und göttlicher Selbsterschließung. Dabei behalten die drei Glaubensartikel die gesamte Schöpfungswirklichkeit von Welt und Kosmos im Blick, die mit der Glaubenswirklichkeit übereinstimmen muss, wenn der Glaube nicht in innere Widersprüche führen soll.
Den aufgezeigten Horizonten des Gottesbegriffs korrespondiert die Transzendenz von Welt und Kosmos, welche über sich selbst hinausweisen (lat. transcendo). Denn sowohl der Wirklichkeit von Welt und Kosmos als auch der Universalhistorie und dem Menschen haften eine Selbsttranszendenz an, die sich zwischen den Dimensionen des „Woher“ und des „Wohin“ bewegt, wobei niemand diese Dimensionen letztgültig kennt oder in der Hand hat. Aufgrund der Kontingenz (Möglichkeit statt Notwendigkeit) und Endlichkeit ist die gesamte Wirklichkeit einer radikalen Fraglichkeit unterworfen, die im Staunen über das Wunder des Seins Frag-Würdigkeit enthält und die die Ahnung eines letzten Grundes beinhaltet. Damit verbunden ist die Frage nach einem letzten Sinn oder Ziel sowie das Phänomen der Gottesidee – alles Dimensionen, die „die Form eines unthematischen Gewahrseins haben“, weil „der Mensch von allem Anfang an in ein ihn übersteigendes ‚Geheimnis‘ hineingestellt ist, und zwar in der Weise, daß sich ihm ‚die unverfügbare […] Unendlichkeit der Wirklichkeit als Geheimnis dauernd zuschickt‘“7.
Weil die Selbsttranszendenz lediglich die Ahnung eines letzten Grundes bzw. eines Gottes ermöglicht, erlaubt sie keine spekulative Rekonstruktion Gottes aus natürlichen Gegebenheiten, seien sie kosmologischer oder anthropologischer Natur. Zwar ist laut alt- und neutestamentlichem Zeugnis die Erkennbarkeit Gottes aus seiner vom Schöpfergeist durchdrungenen Schöpfung gegeben (z.B. Ps 8; 19; 29; 104; 148; Act 14,16f.; 17,22ff.; Röm 1,19f.), weshalb es sich als unentschuldbar erweist, wenn der Mensch Gott die Ehre verweigert (Röm 1,20). Das bezeugt auch das menschliche Gewissen, insofern als das Gesetz Gottes dem Menschen ins Herz geschrieben ist (Röm 2,14f.). Der Mensch, dem sich auf diesen Wegen die Ahnung eröffnet, dass Gott ist, aber noch nicht, wer Gott ist (Luther), neigt jedoch nach Röm 1,18ff. zur Identifikation Gottes mit Geschöpflichem oder mit sich selbst – statt zu einer sich öffnenden Anerkennung Gottes. Denn die in Gen 3 erkennbare Versuchung des Menschen, sein eigener Gott sein zu wollen, zieht notwendig eine Selbstbehauptung und Selbstbegründung (Selbstvergöttlichung) nach sich, die auch das Gottesbild betrifft, weil der Mensch dann auch versucht ist, Gott selbst zu konstruieren bzw. zu rekonstruieren. Deshalb bedarf es zunächst der hermeneutischen Umkehr von selbstbehauptendem und spekulativem Denken zu empfangender Anerkennung der Kreatürlichkeit des Seins, was mit der Einsicht verbunden ist, dass Gott sich nur selbst erschließen kann.
Aufgrund der gezeigten Ambivalenz „natürlicher“ Gotteserkenntnis müssen „Natur und Gnade“ sowie „Vernunft und Glaube“ aufeinander bezogen bleiben, da sich die Gnade die Natur voraussetzt und der Glaube die Vernunft in Dienst nimmt. „Deshalb ist die Natur kein eigenständiger, in sich abgeschlossener und aus sich vollendbarer Wirklichkeitsbereich. Sie ist dynamisch über sich hinaus auf eine Erfüllung ausgerichtet, die sie sich selbst nicht geben kann, die sie vielmehr allein durch die Gnade erhält. Erst durch die Gnade erlangt die Natur ihre eigentliche Bestimmung. Wo sie sich dagegen sündhaft gegen die Gnade versperrt, da gerät sie in Widerspruch mit sich selbst, da wird sie zutiefst verkehrt.“8 Somit ist der Zusammenhang zwischen Schöpfungs- und Heilsordnung bzw. zwischen allen drei Artikeln des Glaubensbekenntnisses gegeben. Entgegen der linear trennenden Stufenordnung von natürlicher (De Deo uno) und übernatürlicher Gotteserkenntnis (De Deo trino) besteht eine trinitarisch-heilsgeschichtliche Dynamik von Schöpfung, Erlösung und Vollendung. In ihr kommt sowohl das jeweils spezifische Handeln von Vater, Sohn und Heiligem Geist in den drei heilsgeschichtlichen Phasen zum Ausdruck als auch deren gemeinsames Handeln in jeder dieser Phasen. Die Trinitätslehre lässt so im Kontext von Gesetz und Evangelium den hermeneutisch relevanten Zusammenhang von Schöpfungs- und Heilsordnung erkennen. In der dynamischen Zuordnung von natürlichen Erkenntnisvoraussetzungen und göttlicher Selbsterschließung ist neben den natürlichen Anknüpfungspunkten der Selbsterschließung auch die mit der Kreuzestheologie hervortretende Krisis zu beachten, welche die sündhafte Verkehrung und Ambivalenz der natürlichen Grundlagen offenlegt. „Die Schöpfung muß daher so interpretiert werden, daß sie von Anfang an auf die Verwirklichung der vollendeten Gemeinschaft des trinitarischen Gottes mit seiner Schöpfung abzielt, die angesichts des Widerspruchs der Sünde nur durch die von Gott gewirkte Versöhnung verwirklicht werden kann. Die Versöhnung muß in dieser Weise als Ausdruck der Treue Gottes zu seiner Schöpfung und in dieser Weise als erneute Einbeziehung des Gott widersprechenden Menschen in die ursprüngliche Zielsetzung der Schöpfung verstanden werden. Die Vollendung der Welt darf darum nicht nach apokalyptischer Manier als radikale Neuschöpfung verstanden werden, sondern muß als Vollendung der versöhnten Schöpfung interpretiert werden, also als neuschöpferisches Handeln Gottes an der ursprünglichen Schöpfung.“9
Als Schöpfung des dreieinigen Gottes enthält die Schöpfung naturgemäß Spuren der Trinität (lat. vestigia trinitatis). Denn das „Geschaffene ist auf Grund seines Ursprungs und seiner Entfaltung vom dreieinen Gott durchwirkt und deshalb dessen Abbild“10. Die vielen Spuren analoger Einheit in Vielfalt im Kosmos und im Menschen haben zwar unter anderem in der Gottebenbildlichkeit des Menschen (imago Dei, Gen 1,26f.) ihre Berechtigung, aber es bleiben aufgrund des Unterschieds zwischen Gott und seiner Schöpfung analoge Spuren. So ist Gott zum Beispiel die Gleichzeitigkeit von inner- und zwischenpersonaler Struktur (ein Gott und zugleich die Gemeinschaft dreier Personen), während der Mensch beide Aspekte auch hat, aber nur in Gemeinschaft mit anderen Menschen oder mit Gott (siehe Kap. IX,2). Durch die Analogie zwischen geschöpflicher und göttlicher Wirklichkeit ist es allerdings überhaupt erst möglich, die Offenbarung Gottes verstehen zu können und die Universalität der speziellen Offenbarung wahrzunehmen, was durch den Zusammenhang der drei Artikel des Glaubensbekenntnisses gewährleistet wird. Der integrale Zusammenhang von „Schöpfungs- und Heilswirklichkeit“ sowie von „Vernunft und Geist“ besteht, weil die Inkarnation (Zweiter Artikel) sowohl auf die mit der Schöpfungswirklichkeit gegebenen Voraussetzungen (Erster Artikel) verweist als auch auf die eschatologische Vollendung durch den Heiligen Geist (Dritter Artikel). Dieser ist wiederum nicht nur an der Schöpfung beteiligt, sondern vollzieht neben der Vollendung auch die Erhaltung der Schöpfung und die Erlösung in Christus.11
Vor dem gezeigten Hintergrund verbietet sich eine oft zu beobachtende anthropozentrische oder existentialistische Reduktion der Glaubenswirklichkeit, was der Erste Artikel mit seiner Bezugnahme auf den gesamten Kosmos (Glaube an Gott den Schöpfer) ebenso belegt wie der Dritte Artikel mit seiner kosmischen Perspektive der eschatologischen Vollendung. Der neuzeitliche Anthropozentrismus, der sich etwa in rein sittlicher Religiosität neukantianischer Prägung oder in existentialistischer Ausblendung der kosmologischen Dimension äußert, wird der ganzheitlichen Selbsttranszendenz des Menschen und seiner Einbindung in Welt und Geschichte nicht gerecht. Deshalb „würde ein völlig akosmisches Gottesbild, Wirklichkeits- und Selbstverständnis des Menschen […] eine bedenkliche Ausfallerscheinung darstellen“12. Davor bewahrt das trinitarische Bekenntnis, indem es Schöpfung und Erlösung umschließt und sich „für den umfassenden Horizont des Wirklichen“13 öffnet. Es bedarf also der Wahrnehmung der Dimension natürlich-metaphysischer Transzendenz in ihrer ganzheitlichen Perspektive, weil man Gott die Wirklichkeit von Welt und Kosmos nicht entziehen kann und der universale Wahrheitsanspruch der Offenbarung im Erfahrungskontext der Menschen gewährleistet bleiben muss, um zu verhindern, „daß der Glaube auf den Standpunkt eines ‚credo,quia absurdum‘ verwiesen wird“14. Denn der Glaube wird absurd, wenn die Wirklichkeit des Glaubens und die Wirklichkeit der Welt nicht in Übereinstimmung kommen. (Siehe dazu Kap. X,1.2: „Theologie und Naturwissenschaft“.)
Insgesamt behält die natürlich-metaphysische Dimension den Charakter der Ahnung von Gott und des natürlichen Anknüpfungspunktes seiner Selbsterschließung, auf welche die Ahnung wiederum angewiesen bleibt. So verweist die Transzendenz von Welt und Kosmos nicht nur auf die Ahnung von Gott, sondern auch auf die Notwendigkeit seiner Selbsterschließung – und damit zugleich auf die anthropologischen Voraussetzungen der Gotteserkenntnis im Kontext dieser Welt.
3.Die Transzendenz des Menschen
Da der Mensch letztlich weder seine Herkunft noch seine Zukunft selbst in der Hand hat, erfährt er sich als Frage und Geheimnis und weist so über sich selbst hinaus. Diese Transzendenz verbindet sich mit der personalen und sprachlichen Konstitution des Menschen, durch die sich der Mensch als personales Geheimnis selbst mitteilen kann und durch die er auf Anrede angewiesen ist. Indem sich der dreieinige Gott ebenfalls als personal und sprachlich konstituiertes Wesen erschlossen hat, wird der Mensch als Ebenbild Gottes transparent. Lässt sich der Mensch glaubend auf die Anrede Gottes ein, entspricht er also sowohl dem Wesen Gottes als auch seinem eigenen Wesen.
Wie es bereits aus der Transzendenz von Welt und Kosmos hervorging, spürt der Mensch, der die Begrenztheit seines Lebens ernst nimmt, dass er zum einen von Voraussetzungen lebt, die er nicht selbst geschaffen hat. So ist er nicht aufgrund eigener Entscheidung in dieser Welt, sondern er wurde sozusagen „in das Leben hineingeworfen“. Der Mensch hat also keine Verfügungs- und Begründungsmacht im Blick auf seine Herkunft. Zum anderen kann er zwar seine Zukunft im Leben planen und beeinflussen, doch sie bleibt letztlich nicht vorhersehbar. Erst recht steht die Zukunft über das Lebensende hinaus nicht in der Verfügbarkeit des Menschen. Dadurch erfährt sich der Mensch als Frage und als Geheimnis, es existiert eine Unruhe der Unabschließbarkeit und somit das Gefühl, aus sich herausgerufen zu sein. Die sich in solcher „Frag-Würdigkeit des Geheimnisses“15 und im existentiellen Verwiesensein dokumentierende Selbsttranszendenz des Menschen erwartet eine „Antwort auf die mit dem Menschen als Person gegebene Frage nach dem Ganzen der Wirklichkeit“16 und nach deren universalem Sinn. In diesem „Gefordertsein der menschlichen Existenz“17 existiert sowohl das mit menschlicher Personalität und Liebeserfahrung gegebene Grundvertrauen als auch eine unauslotbare Verborgenheit: „Insofern die Erfahrung des Geheimnisses ein unerreichbarer Horizont aller unserer Erfahrung ist, begegnet es uns als das ganz Andere […]. Insofern es uns in allen Dingen nahe ist, erscheint es uns als bergender Grund“18. Durch die Erfahrung beider Dimensionen des Geheimnisses, welche die Frage nach dem universalen Sinn beinhalten, wird das Denken über sich selbst hinausgewiesen. Bereits im antiken griechischen Begriff „Anthropos“ (Mensch) ist das über sich hinausweisende Wesen des Menschen angedeutet, insofern als der Begriff etymologisch mit dem griechischen Wortstamm anatrein (nach oben blicken) in Verbindung steht.
Die gezeigte Transzendenz des Menschen beinhaltet den anthropologischen Aspekt des Herausgerufenseins bzw. des Angewiesenseins auf Anrede, was bereits in der personalen und sprachlichen Konstitution des Menschen angelegt ist. Beide Konstitutionsmerkmale, Personalität und Sprachlichkeit, bedingen sich gegenseitig. Denn die mit selbstreflexiver Subjektivität verbundene Personalität des Menschen verkörpert Selbstsein im Gegenüber- und Mitsein, so dass menschliche Personalität einerseits die Dimension des von außen nicht zugänglichen personalen Geheimnisses beinhaltet, während sie andererseits durch die Dimension der Gemeinschaft und des Angegangenseins von außen geprägt ist. Weil sich der Mensch als personales Geheimnis nur selbst mitteilen kann und zugleich auf personale Gemeinschaft und damit auf Anrede angewiesen ist, bedarf er ontologisch der sprachlichen Konstitution. Die Sprachlichkeit ermöglicht nämlich nicht nur die Handhabung des Aspekts des personalen Geheimnisses, indem sich der Mensch anderen erschließen oder verschließen kann, sondern auch die freie Ansprechbarkeit des Menschen und die freie intersubjektive Gemeinschaft der Menschen untereinander.19
Angesichts dieser Zusammenhänge geben Sprachlichkeit und Personalität die Selbsttranszendenz des Menschen zu erkennen. Denn so wie die Sprachlichkeit des Menschen bewusste Beziehungen in personaler Gemeinschaft voraussetzt und so wie die im personalen Geheimnis gegebene Sinnfrage auf ein personales Gegenüber verweist, das allein die Antwort auf diese Frage erschließen kann, so kann das menschliche Wesen „seine Erfüllung als Person nur in der Gemeinschaft mit einem höheren persönlichen Wesen finden“20. Dabei beinhaltet die Sprache selbst schon eine transzendierende Dimension: „Die Sprache lebt vom Vorgriff auf einen Gesamtsinn der Wirklichkeit und bringt diesen in Metaphern und Gleichnissen zum Ausdruck. So ist die Sprache zugleich Erinnerung an eine unabgegoltene Hoffnung der Menschheit und zugleich Antizipation dieser Hoffnung. Noch bevor die Sprache zur expliziten religiösen Sprache wird, impliziert sie je schon eine religiöse Dimension. Erst die religiöse Sprache bringt die Sprache zu sich selbst. Nicht das Wort Gott ist ein sinnloses Wort, vielmehr ist dort, wo Gott totgeschwiegen wird, das Sprechen selbst gefährdet.“21 Entsprechend meint das Wort „Gott“ laut Gerhard Ebeling „die Tatsache, daß der Mensch in der Ganzheit seines Lebens und damit im Hinblick auf die Wirklichkeit im ganzen in einer letztgültigen Weise sprachlich angegangen ist“22.
Vor dem Hintergrund dieser anthropologischen Voraussetzungen ist es aufschlussreich, dass sich Gott in der trinitarischen Heilsgeschichte als personale Gemeinschaft der Liebe erschlossen hat und die Menschen immer wieder durch sein Wort anredet. Aufgrund des Umstandes, dass sich der Sohn Gottes wesensmäßig als Wort (griech. Logos) Gottes erschließt („Das Wort ward Fleisch“ – Joh 1,14), wird vollends offenbar, dass neben der Personalität auch die Sprachlichkeit zum innersten Wesen Gottes gehört. So wird der Mensch auch diesbezüglich als imago Dei (Ebenbild Gottes) transparent. Von daher kann das Wort Gottes die als Wortsituation bestehende Grundsituation des Menschen treffen, weshalb gilt: Wenn sich der sprachlich konstituierte Mensch glaubend auf die Anrede Gottes einlässt, handelt es sich um „dasjenige Verhalten, in dem der Mensch gleichursprünglich sowohl Gott als auch sich selbst entspricht“23, da er Gott als den von sich aus Redenden gelten lässt und sich das wahre Menschsein zusprechen lässt. „Letztlich geht es um das einzige Wort, ‚das den Menschen menschlich macht, indem es ihn zum Glaubenden macht‘“24. Dabei gewährt die im Sohn Gottes bestehende einmalige Identität von Wort und Sein den Menschen wahre Gotteserkenntnis und Heilsgewissheit, weil sich Gott in seinem Wort selbst entspricht.
So verweist die Transzendenz des Menschen auf das Geheimnis, in das der Mensch gestellt ist und das er selbst nicht erschließen kann, weshalb das Denken über sich hinausgewiesen ist, bis hin zum Grenzbegriff „Gott“, der zu der Einsicht führt: „Vor ihm muß unser Denken verstummen. Soll uns das Unendliche zugänglich werden, dann muß es sich uns selbst erschließen.“25 In dieser empfangenden Hermeneutik kann der Mensch die biblisch bezeugte Selbsterschließung des dreieinigen Gottes in der Heilsgeschichte wahrnehmen, die erkennen lässt, dass der personal und sprachlich geprägte Gott den personal und sprachlich konstituierten Menschen als Adressaten seiner Liebe geschaffen hat. Gott, der die innertrinitarische Beziehung der Liebe verkörpert, nimmt „die Menschen als seine von ihm selbst geschaffenen Kommunikationspartner in diese Beziehung auf […], so daß diese – von der grenzenlosen Beziehungswilligkeit Gottes ergriffen und sich ihr öffnend – den Mitmenschen wie auch ihrem Gott entsprechen und zu ihrem menschlichen Wesen kommen können“26.
4.Implikationen des Gottesbegriffs
Die Implikationen des Gottesbegriffs, die auf Gott als unverfügbare Eigenwirklichkeit hinweisen, korrespondieren mit dem personalen Wesen des dreieinigen Gottes, weil sich Gott als personales Geheimnis nur selbst erschließen kann. Soll Gott nicht depotenziert oder vereinnahmt werden, ist er als sich selbst erschließendes Geheimnis ernst zu nehmen. Der verborgene Gott verweigert sich menschlicher Vereinnahmung und ermöglicht so wahre Gotteserkenntnis durch den offenbaren Gott.
Die beiden Abschnitte über die Transzendenz des Menschen und die Transzendenz von Welt und Kosmos lassen erkennen, dass der Mensch im Kontext des Kosmos über sich selbst hinausgewiesen ist – auf einen letzten Grund und ein letztes Ziel. Diese Dimensionen sind wiederum verbreitet mit dem Gottesbegriff verbunden, wie es im Abschnitt über die Horizonte des Gottesbegriffs deutlich wurde (siehe Kap. II,1). So trat ein gewisser Resonanzboden des Gottesbegriffs hervor, da Gott weitgehend als Ursache aller Wirklichkeit verstanden wird und somit als selbstursächliche und unverfügbare Eigenwirklichkeit, die hinter dem Geheimnis menschlicher Transzendenz steht. Nimmt man diese Implikationen des Gottesbegriffs ernst, kann es keine aus den weltlichen Bedingungen rekonstruierbare Notwendigkeit Gottes geben, wie es falsch verstandene Gottesbeweise scheinbar vorgeben (siehe zu den Gottesbeweisen Kap. VI,3). Denn bei dem göttlichen Horizont der unverfügbaren Eigenwirklichkeit geht es um den grundlosen Grund, der erst über Sein und Nicht-Sein entscheidet. Deshalb kann weder vom Sein noch vom Nicht-Sein die metaphysisch-theistische „Notwendigkeit“ oder die atheistische „Nicht-Notwendigkeit“ Gottes abgeleitet werden („Gott ist mehr als notwendig“ – E. Jüngel).27 Vielmehr lässt die aus menschlicher Selbsttranszendenz resultierende Ahnung von der Existenz Gottes erkennen, dass der diesem Anschein nach aus sich selbst existierende Gott um seiner selbst willen ernst zu nehmen ist: Er muss sich selbst verifizieren,wenn er erkannt werden soll. „Letztlich kann Gott nicht von einer äußeren Instanz her bewiesen werden. Er muß sich selbst erweisen. Man kann den Gottesgedanken nur daran bewähren, daß man ihn an seinen eigenen Implikationen mißt.“28
Das gilt auch für die Implikationen des Gottesbegriffs, die sich aus der personalen Konstitution des Menschen ergeben (siehe Kap. II,3). Als Anknüpfungspunkt und Voraussetzung für den Zugang zu Gott verweist die menschliche Personalität auf ein personales göttliches Gegenüber, das Antwort auf das Geheimnis anthropologischer Personalität und ihres Kontextes geben kann und das sich als personales Geheimnis ebenso erschließen oder verschließen kann wie der Mensch. Wie „schon zur Anwesenheit eines Menschen dessen Entzogensein gehört“, ist „Gottes Anwesenheit […] überhaupt nur mit seiner Abwesenheit zugleich erfahrbar. Deshalb ist seine Anwesenheit auch nur als Offenbarung erfahrbar.“29 Die mit dem Wesen der Personalität verbundenen Aspekte unterstreichen also die Implikationen des von einer unverfügbaren Eigenwirklichkeit ausgehenden Gottesbegriffs, weil sich das personale Geheimnis in seiner Eigenwirklichkeit auch frei entziehen oder erschließen kann. Durch die damit verbundene Kategorie der selbstursächlichen Freiheit drängt sich die personale Dimension für den Gottesbegriff auf, wobei zu unterstreichen ist, dass sich Gott in der Geschichte als personaler Gott erschlossen hat.
Der kommunikative Charakter der Personalität bildet die Voraussetzung für eine freie Gemeinschaft der Liebe und somit die Grundlage für eine derartige Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Im Blick auf die Bedingungen angemessener Gotteserkenntnis, die Gott wirklich Gott sein lässt und ihn nicht eigenen Vorstellungen unterwirft, bleibt deshalb festzuhalten, dass Gott nur in einer empfangenden Hermeneutik ernst genommen wird, die sich seiner Selbsterschließung öffnet, statt ihn selbst rekonstruieren zu wollen. Denn wie der Mensch das personale Geheimnis seiner Mitmenschen vorurteilsfrei zur Kenntnis nehmen sollte, so sollte er auch das Geheimnis Gottes als solches wahrnehmen. „Gott ist um seiner selbst willen interessant […]. Was man Menschen zugesteht, sollte man Gott auch nicht einmal in der Theorie vorenthalten.“30 Wenn man Gott als göttliche Wirklichkeit ernst nimmt, kann er nur als sich offenbarender Gott als Gott gedacht werden: „[…] für Gott als den, über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, kann es nicht nochmals einen größeren und umfassenderen Horizont geben, von dem her und innerhalb dessen wir ihn begreifen können“31. Soll Gott nicht depotenziert oder vereinnahmt werden, muss man ihn als sich selbsterschließendes Geheimnis wahrnehmen. Nur so lässt man ihn als Gott gelten, während man sich selbst unter Berücksichtigung der eigenen Transzendenz als empfangende menschliche Kreatürlichkeit annimmt. Denn „Gott denken heißt: Gott allein als denjenigen denken, der de deo etwas zu sagen hat. […] Gott denken kann nicht heißen, daß die menschliche Vernunft ihm gleichsam vorschreiben könnte, wie er sich ihr zu zeigen hat.“32