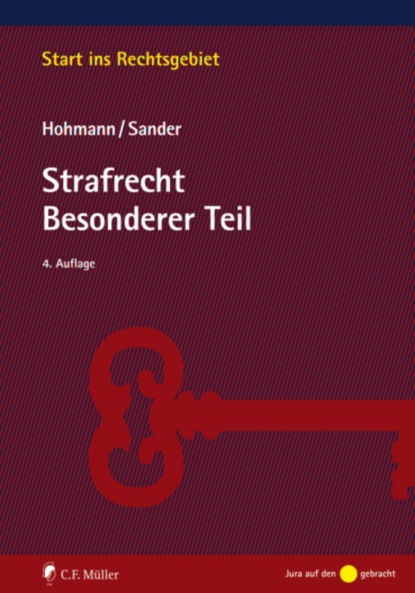Öffentliches Recht im Überblick
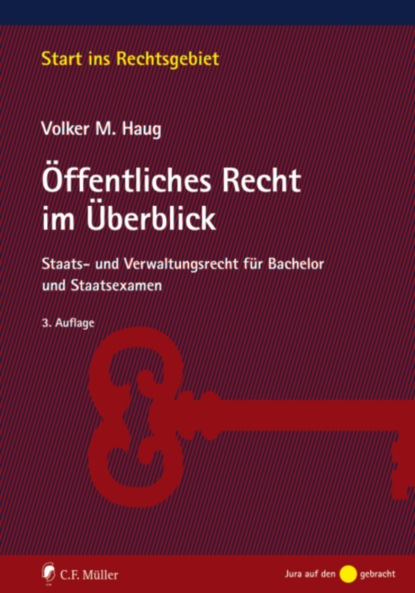
- -
- 100%
- +
166
Für jeden Mitgliedstaat gilt außerdem, dass der Ernennung eine Anhörung durch den Richterprüfungsausschuss gem. Art. 255 AEUV vorausgeht. Dieser Ausschuss besteht aus sieben Persönlichkeiten, die entweder ehemalige Europarichter sind, den höchsten nationalen Gerichten angehören oder sonst anerkannt hervorragend befähigte Juristen sind. Die Einbindung des Ausschusses soll zum einen eine europäische Sichtweise in das nationale Auswahlverfahren einbringen, und zum anderen die erforderliche fachliche Qualität der Richter sicherstellen.
b) Verfahrensarten
167
Die meisten EU-Verfahrensarten sind sog. „Direktklagen“, weil sie – oft nach erfolgloser Durchführung eines internen Vorverfahrens[43] – direkt bei einem europäischen Gericht eingeleitet werden können. Diese Verfahren dienen zum einen zur Entscheidung von Streitfällen innerhalb des EU-Systems, also von EU-Organen untereinander oder mit EU-Mitgliedstaaten. Zum anderen haben sie die Funktion, Meinungsverschiedenheiten zwischen EU-Bürgern (v.a. Unternehmen) und der Union bzw. Unionsorganen zu lösen (ohne Zwischenschaltung nationaler Instanzen).[44] Zu diesen Direktklagen gehören Vertragsverletzungsverfahren, Nichtigkeits- und Untätigkeitsklagen, Amtshaftungsklagen und dienst- und arbeitsrechtliche Klagen von EU-Bediensteten.
168
Abbildung 17: Direktklage-Verfahren beim Gerichtshof der EU
Verfahrensart Streitparteien Gegenstand des Verfahrens Konsequenzen bei Erfolg Vertragsverletzungsverfahren (Art. 258, 259 AEUV) Antragsberechtigt ist die Kommission (Regelfall), aber auch jeder Mitgliedstaat.[45] Antragsgegner sind einzelne Mitgliedstaaten. Handeln des beklagten Mitgliedstaates, das nach Auffassung des Antragstellers gegen primäres oder sekundäres EU-Recht verstößt. Verpflichtung des beklagten Staates, den festgestellten Verstoß schnellstmöglich abzustellen bzw. zu korrigieren (z.B. eine zu Unrecht gewährte Subvention zurückzufordern). Ansonsten drohen finanzielle Sanktionen. Nichtigkeitsklage (Art. 263, 264 AEUV) Klageberechtigt sind die Mitgliedstaaten, die EU-Organe und der AdR sowie – bei persönlicher Betroffenheit – nat. und jur. Personen. Klagegegner ist ein EU-Organ oder eine sonstige EU-Einrichtung. Rechtlich verbindlicher Akt des beklagten EU-Organs (bis hin zu Gesetzgebungsakten), der nach Auffassung des Klägers gegen das EU-Recht verstößt. Rückwirkende Nichtigkeitserklärung des angegriffenen Rechtsaktes (z.B. einer Richtlinie, für die keine Zuständigkeit der EU besteht). Untätigkeitsklage (Art. 265 AEUV) Klageberechtigt sind die Mitgliedstaaten, die EU-Organe sowie – bei persönlicher Betroffenheit – nat. und jur. Personen. Klagegegner ist ein EU-Organ. Unterlassen des Erlasses eines rechtlich verbindlichen Aktes, zu dem das beklagte EU-Organ nach Auffassung des Klägers verpflichtet ist (ohne Ermessen). Verpflichtung des beklagten EU-Organs, den unterlassenen Akt schnellstmöglich zu erlassen (z.B. über eine an das EP gerichtete Petition zu befinden). Ansonsten drohen finanzielle Sanktionen. Amtshaftungsklage (Art. 268 AEUV i.V.m. Art. 340 II, III AEUV) Klageberechtigt sind alle nat. und jur. Personen. Klagegegner ist die Union als Rechtsträgerin des betroffenen Organs. Geltendmachung eines Schadens, der dem Kläger durch eine rechtswidrige oder fehlerhafte Amtshandlung eines EU-Organs bzw. -Bediensteten entstanden ist. Ausgleich des Schadens durch Geldzahlung seitens der EU (z.B. Bezahlung des Zinsschadens, den ein Unternehmen wegen einer zu Unrecht von der Kom. verhängten Geldbuße erlitten hat). Dienstklage (Art. 270 AEUV) Klageberechtigt sind alle EU-Beamten und -Bediensteten. Klagegegner ist die jeweilige EU-Behörde, bei der der Kläger angestellt ist. Jedes Tun oder Unterlassen der Anstellungsbehörde, durch die die Rechtsposition des Klägers aus dem Beamtenstatut beeinträchtigt wird. Aufhebung der beanstandeten Maßnahme (z.B. einer disziplinarischen Rüge) oder Bewilligung einer vermögensrechtlichen Leistung (z.B. zu Unrecht einbehaltenes Gehalt).169
Neben diesen Direktklagen gibt es noch das praktisch sehr bedeutsame Vorabentscheidungsverfahren (Art. 267 AEUV). Dem Vorabentscheidungsverfahren liegt stets ein Rechtsstreit vor einem nationalen Gericht zugrunde, bei dem es auf die Auslegung primärrechtlicher EU-Normen oder die Vereinbarkeit sonstiger EU-Normen mit dem Primärrecht ankommt. Da hierüber allein der EuGH (und nicht einmal ein nationales Verfassungsgericht!) letztverbindlich entscheiden kann, muss das nationale Gericht spätestens in letzter Instanz einen solchen Fall dem EuGH vorlegen, damit dieser seine Rechtsauffassung darlegen kann. Nur durch dieses Auslegungs- und Verwerfungsmonopol des EuGH kann eine EU-weit einheitliche Anwendung und Auslegung des EU-Rechts sichergestellt werden. Die EuGH-Entscheidung ist dann sowohl für das konkret vorlegende Gericht als auch – soweit eine Aussage über die Auslegung oder Gültigkeit einer EU-Norm getroffen wird – generell für alle EU-Organe und Mitgliedstaaten verbindlich (z.B. Feststellung der Rechtswidrigkeit der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung[46]).
7. Europäische Zentralbank
Vertiefungshinweis:
Art. 282-284, 127-133 AEUV
170
Die Europäische Zentralbank (EZB) genießt neben ihrer Stellung als EU-Organ auch eine eigene Rechtsfähigkeit (Art. 282 III AEUV). Sie wird vom EZB-Rat geführt, dem das Direktorium und die (derzeit 18) Präsidenten der nationalen Notenbanken aller Euro-Staaten[47] angehören. Die sechs Mitglieder des Direktoriums (einschließlich Präsidentin und Vizepräsident) werden vom Europäischen Rat auf Empfehlung des (Minister-)Rates nach Anhörung des EP und des EZB-Rates für die Dauer von acht Jahren (ohne Wiederernennungsmöglichkeit) ernannt (Art. 283 II AEUV).
171
Die EZB ist für die Leitung des Europäischen Zentralbanksystems, dem neben der EZB alle nationalen Notenbanken des Euro-Raumes angehören, zuständig. Sie legt zur Sicherung der Preisniveaustabilität die Währungspolitik des Euro fest, nimmt nach Bedarf Deviseninterventionen vor und verwaltet die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten (Art. 127 II AEUV). Außerdem ist die EZB exklusiv berechtigt, über die Ausgabe von Euro-Banknoten und -Münzen zu entscheiden (Art. 128 AEUV). Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben ist die EZB ausdrücklich unabhängig, was alle übrigen EU-Organe und die Mitgliedstaaten zu respektieren haben (Art. 282 III AEUV).
172
Besondere Aufregung hat deshalb ein Urteil des BVerfG vom Mai 2020 verursacht, in dem infrage gestellt wurde, ob das PSPP[48]-Anleihenprogramm noch vom währungspolitischen Mandat der EZB gedeckt oder bereits im Schwerpunkt als wirtschaftspolitische Maßnahme – für die die Mitgliedstaaten zuständig wären – anzusehen ist.[49] Denn natürlich kann die Unabhängigkeit der EZB nur innerhalb ihrer Aufgabenfelder gelten, wozu das PSPP allerdings laut einer vorherigen Entscheidung des EuGH zählt.[50]
8. Rechnungshof
Vertiefungshinweis:
Art. 285-287 AEUV
173
Dem Rechnungshof gehört pro Mitgliedstaat ein Mitglied an (Art. 286 I AEUV). Die Mitglieder müssen – idealerweise durch eine Tätigkeit an einem nationalen Rechnungshof – eine besondere Eignung aufweisen und werden vom (Minister-)Rat auf der Grundlage von Vorschlägen der jeweiligen nationalen Regierungen und nach Anhörung des EP für die Dauer von sechs Jahren (mit Wiederwahlmöglichkeit) ausgewählt (Art. 286 II AEUV).
174
Die zentrale Aufgabe des Rechnungshofs ist die Rechnungsprüfung bei grundsätzlich allen Organen und Einrichtungen der EU, worüber der Rechnungshof einen jährlichen Tätigkeitsbericht – vor allem über entdeckte Mängel – vorlegt (Art. 287 I, IV AEUV). Die Prüftätigkeit des Rechnungshofs umfasst die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit aller Einnahmen und Ausgaben sowie die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung (Art. 287 II AEUV). Die Rechnungshofmitglieder sind allein auf das Wohl der EU verpflichtet und genießen volle Unabhängigkeit (Art. 285 UA 1 AEUV).
9. Problem Demokratiedefizit
175
Angesichts der weitreichenden Aufgabenfelder der EU (s. Rn. 208 ff.), die teilweise weit und in hoheitlicher Weise in die Rechtssphäre des einzelnen Bürgers hineinwirken können, stellt sich die Frage nach der demokratischen Legitimation der Gesamtorganisation der EU. Denn trotz eines prominenten Bekenntnisses der EU zum Demokratieprinzip (Art. 2 EUV) weist die EU-Organisation sowohl im Institutionengefüge als auch in den Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen verschiedene Mängel unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten auf. Man spricht daher von einem Demokratiedefizit der EU. Dies hat auch zu dem polemischen Bonmot geführt, dass die EU selbst nicht die Demokratieanforderungen erfüllt, die sie an ihre Beitrittskandidaten stellt.[51]
176
Zu diesen Mängeln zählen insbesondere folgende Punkte:[52]
– Die fehlende Wahlrechtsgleichheit bei der Wahl des EP wegen unterschiedlicher Stimmengewichte der Wähler je Mitgliedstaat und national verschiedener Wahlrechtsausgestaltungen (s.o., Rn. 105 f.), – die teilweise zu schwache Stellung des EP als einziges direktdemokratisch legitimiertes Organ sowohl bei der Gesetzgebung als auch bei der Bildung der Kommission (s.o., Rn. 110 ff., 120, 122), – die zu starke Exekutivprägung der EU-Organisation wegen der immer noch teilweise dominanten Rolle des (Minister-)Rates (und des Europäischen Rates), in dem die nationalen Regierungen vertreten sind (s.o., Rn. 127 ff.), und – die bis heute faktisch kaum bestehende europäische Öffentlichkeit.177
Aufgrund dieser Mängel vertritt das BVerfG schon in seiner Maastricht-Entscheidung und noch deutlicher in der Lissabon-Entscheidung den Standpunkt, dass die demokratische Rückbindung der EU bis auf Weiteres nur über die nationalen Parlamente erfolgen kann. Um dies leisten zu können, müssen zum einen diese Parlamente wie z.B. der Deutsche Bundestag substantielle Zuständigkeiten behalten. Und zum anderen muss sich die EU auch künftig legitimatorisch auf ihre Mitgliedstaaten stützen, die als „Herren der Verträge“ nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung souverän darüber entscheiden können müssen, wofür die EU zuständig sein soll und für was nicht.[53]
178
Diesem Demokratiedefizit stellt die EU ein Legitimationsmodell gegenüber, das auf verschiedenen Säulen ruht (vgl. nachfolgende Grafik):[54]
– So gibt es erstens – hauptsächlich – eine repräsentativ-demokratische Legitimation, die auf zwei Säulen ruht. Denn die Unionsbürger werden einerseits als Angehörige ihrer Heimatländer durch die von ihnen (mittelbar) gewählten Regierungen im (Minister-)Rat indirekt und andererseits als EU-Angehörige in dem von ihnen gewählten Europäischen Parlament direkt repräsentiert (Art. 10 EUV).179
– Ergänzend tritt zweitens eine partizipativ-demokratische Legitimation hinzu, indem den EU-Bürgern eine direkte Beteiligung am politischen Leben der EU ermöglicht wird. So fördern die EU-Organe die Kommunikation von Bürgern und Verbänden mit dem Ziel einer Stärkung der europäischen Öffentlichkeit. Außerdem treten die EU-Organe in einen kontinuierlichen Dialog mit Verbänden und Zivilgesellschaft ein und führen Anhörungen Betroffener durch. Und schließlich haben die EU-Bürger die Möglichkeit, über eine EU-Bürgerinitiative ein aus ihrer Sicht wichtiges Thema auf die Agenda der EU zu bringen (Art. 11 EUV).180
Abbildung 18:
Demokratische Legitimation der EU

[Bild vergrößern]
181
Verständnisfragen:
1. Vergleichen Sie die Stellung des EP bei der Rechtssetzung und bei der Haushaltsverabschiedung. (Rn. 109–119) 2. Welche Mehrheitsbegriffe gibt es beim (Minister-)Rat? (Rn. 131 f.) 3. Warum nennt man die Kommission die „Hüterin der Verträge“? (Rn. 149–152) 4. Kann man die Kommission als „Europa-Regierung“ bezeichnen? (Rn. 142 f.) 5. Welches EU-Organ hat die relativ stärkste Stellung? (Rn. 127) 6. Welches EU-Organ legt die Richtlinien der EU-Politik fest? (Rn. 123 f.) 7. Welche Instanzen kennt das europäische Gerichtssystem? (Rn. 159–164) 8. In welchen Konstellationen können auch Privatpersonen oder -unternehmen vor einem europäischen Gericht klagen? (Rn. 168) 9. Wie ist die EU demokratisch legitimiert und was versteht man unter dem „Demokratie-Defizit“ der EU? (Rn. 175–180)Anmerkungen
[1]
Vgl. Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EU-Verfassungsrecht, AEUV Art. 341 Rn. 2.
[2]
Bergmann, in: Bergmann (Hg.), Handlexikon, S. 535 Sp. 2/535 Sp. 1.
[3]
Der Europäische Rat zählt als ein über der operativen Ebene stehendes Leitungsorgan nicht dazu, vgl. Rn. 123.
[4]
BVerfGE 129, 300 (353); das BVerfG bezeichnet das EP auch als „eine Vertretung der Völker der Mitgliedstaaten“, BVerfGE 123, 267 (373) – Lissabon.
[5]
Eigentlich sind es 751 Mitglieder (Art. 14 II UA 1 S. 2 EUV); da der Brexit aber erst nach der Wahl von 2019 wirksam wurde, hat man die weggefallenen 73 britischen Parlamentssitze zum Teil auf andere Länder „umverteilt“ und zum Teil eingespart, um im Fall künftiger Erweiterungen das Parlament nicht über die Zahl von 751 Mitglieder anwachsen lassen zu müssen, vgl. https://www.europarl.europa.eu/news/de/faq/12/wie-viele-mitglieder-hat-das-europaische-parlament (4.11.2020).
[6]
Seit dem Brexit nach der EP-Wahl 2019 gehören den beiden großen Fraktionen zusammen 331 Mitglieder an; 29 Abgeordnete sind fraktionslos.
[7]
Weshalb das BVerfG meint, dass die Fraktionen auch noch Vertreter von Kleinst- und Splitterparteien integrieren könnten und die 5 %- bzw. 3 %-Hürde im deutschen Europawahlrecht unnötig sei, vgl. BVerfGE 129, 300 (327 ff.); kritisch dazu Haug, Muss wirklich jeder ins Europaparlament? Kritische Anmerkungen zur Sperrklausel-Rechtsprechung aus Karlsruhe, ZParl 2014, S. 467 (475 f.).
[8]
Vgl.
[9]
BVerfGE 123, 267 (374 f.) – Lissabon; dafür hat sich Deutschland allerdings im Rat (durch das Bevölkerungsquorum) ein starkes Gewicht gesichert (s.u. Rn. 131).
[10]
Art. 7, 8 des Protokolls (Nr. 7) über Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union.
[11]
Huber, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 14 EUV Rn. 4.
[12]
Alle Fallzahlen in dieser Rn. sind auf den gescheiterten Verfassungsvertrag bezogen, dessen diesbezüglichen Inhalte jedoch weitgehend in Lissabon primärrechtlich übernommen wurden, vgl. Margedant, in: Bergmann (Hg.), Handlexikon, S. 351 Sp. 2 m.w.N.
[13]
Margedant, in: Bergmann (Hg.), Handlexikon, S. 351 Sp. 2.
[14]
Gellermann, in Streinz, EUV/AEUV, Art. 289 AEUV Rn. 6.
[15]
Deshalb sind die großen Parteienfamilien 2014 und 2019 mit europaweiten Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten in den EP-Wahlkampf gezogen (2014: Jean-Claude Juncker und Martin Schulz; 2019: Manfred Weber und Frans Timmermans).
[16]
Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 135.
[17]
Huber, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 14 EUV Rn. 5, bezeichnet das EP in diesem Zusammenhang als den „große[n] Gewinner sämtlicher Vertragsrevisionen“.
[18]
BVerfGE 123, 267 (372 ff.); 129, 300; 135, 259; kritisch dazu Haug, Muss wirklich jeder ins Europaparlament? Kritische Anmerkungen zur Sperrklausel-Rechtsprechung aus Karlsruhe, ZParl 2014, S. 467 (476 f.).
[19]
Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 75.
[20]
Erster Amtsinhaber war der Belgier Herman Van Rompuy, anschließend der vormalige polnische Ministerpräsident Donald Tusk. Seit 2019 ist der frühere belgische Premierminister, Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates.
[21]
Calliess, in: Calliess/Ruffert, EU-Verfassungsrecht, EUV Art. 15 Rn. 5.
[22]
Ausnahmen vom Halbjährigkeitsprinzip können sich durch das Prinzip der Teampräsidentschaft ergeben, wonach immer eine Gruppe von drei Mitgliedstaaten für die Dauer von 18 Monaten den Vorsitz wahrnimmt; ausführlich zur Vorsitzthematik Obwexer, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 16 EUV, Rn. 83 ff.
[23]
Im Detail ist die Mehrheitsbegriffsstruktur noch etwas komplexer; so gibt es zu den einzelnen Begriffen noch verschiedene Unterfälle sowie die vierte Gruppe „besonderer Mehrheiten“. Näher hierzu Obwexer, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 238 AEUV, Rn. 10.
[24]
Weitere Beispiele sind die Einrichtung und Organisation der vertraglich vorgesehenen Ausschüsse (Art. 242 AEUV) oder die Festlegung des Rahmens für die Ausübung der Auskunfts- und Nachprüfungsbefugnisse der Kommission (Art. 337 AEUV), vgl. Obwexer, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 238 AEUV, Rn. 12.
[25]
Dieses „Lissabon-Regime“ gilt erst seit dem 1.11.2014; bis dahin galt das „Nizza-Regime“, das auf einer unterschiedlichen Stimmengewichtung der Mitgliedstaaten (zwischen 3 und 29) basierte und in einem Übergangszeitraum bis zum 1.4.2017 auf Antrag eines Mitgliedsstaates noch Anwendung fand, vgl. Obwexer, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 16 EUV, Rn. 43 ff.
[26]
Hintergrund des „oder-Zusatzes“ ist, dass nicht drei große Staaten mit zusammen mehr als 35 % der EU-Bevölkerung (z.B. D, F, I haben zusammen rund 41 %) die qualifizierte Mehrheit allein verhindern können sollen; Art. 16 IV UA 2 EUV verlangt deshalb für die Sperrminorität mindestens vier Staaten.
[27]
Siehe die umfassende Auflistung bei Gellermann, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 289 AEUV Rn. 7, die u.a. die Bekämpfung von Diskriminierungen (Art. 19 I AEUV), die operative Zusammenarbeit der Polizeibehörden (Art. 87 III AEUV), die Steuerharmonisierung (Art. 113 AEUV) sowie die Sozial-, Umwelt- und Energiepolitik (Art. 153 II UA 3, 192 II, 194 III AEUV) umfasst.
[28]
Gellermann, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 289 AEUV, Rn. 9.
[29]
Vgl. die vollständige Aufzählung bei Obwexer, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 242 AEUV, Rn. 5 f.
[30]
Vgl. Margedant, in: Bergmann (Hg.), Handlexikon, S. 800 Sp. 2/801 Sp. 1.
[31]
[32]
Kugelmann, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 17 EUV Rn. 12-14.
[33]
Vgl. Bubrowski, Im Spiel der Kräfte, FAZ v. 21.5.2014, S. 8.
[34]
Vgl. Kugelmann, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 17 EUV Rn. 86 f.;
[35]
Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 119 f.
[36]
Vgl.
[37]
Vgl. Mitteilung der Kommission 2019/C 70/01; Schwarze/Wunderlich, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 260 AEUV Rn. 10.
[38]
[39]
Vgl.
[40]
Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 756 f.
[41]
Das EuGöD bestand von 2005 bis 2016 und wurde dann in das EuG wieder eingegliedert, vgl. Erwägungsgrd. 9 der VO (EU, Euratom) 2015/2422 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union.
[42]
Vgl. Huber, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 253 AEUV Rn. 2 f. Der Richterwahlausschuss besteht je hälftig aus den zuständigen Landesministern und vom Bundestag nach Fraktionsproporz gewählten Mitgliedern, §§ 2-5 RiWG.