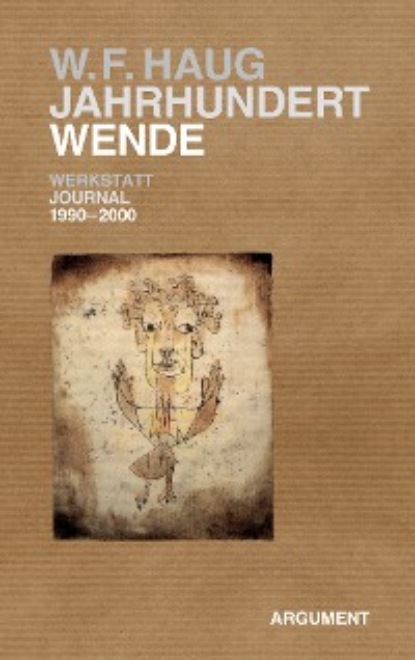- -
- 100%
- +
*
»Der reale Krieg geht um die Vormacht im Islam« (Oliver Fahrni im »Freitag« vom 1.2.). Beschleunigt den Umbruch in den arabischen Ländern. Massenhafte Absage an die westliche »Modernisierung« aus Hoffnungslosigkeit. Von den Ölscheichs in den achtziger Jahren finanziert, zwecks »Re-Islamisierung ihrer Gesellschaften von unten«, um der iranischen Gefahr einen Riegel vorzuschieben. Daher seien die islamischen Intellektuellen so sprachlos (das verstehe ich gut; sie sind wie wir in Widersprüchen gefangen). Fahrni zitiert den Marokkaner Zaki Laídi: im Kern eine »Mobilisierung der Frustrationen«. »Die schnelle Entwicklung der elektronischen Medien habe den Armen der Welt die Illusion einer anderen Lebensweise vermittelt, ohne ihnen den Zugang dazu zu erlauben.« – Das erinnert mich an meine Thesen zur Auswirkung der Warenästhetik, bloß dass ich damals nicht den Nord-Süd-Gegensatz im Auge hatte. Ich müsste nachsehen, was ich als Vorwort zur nie erschienenen argentinischen Ausgabe der Kritik der Warenästhetik geschrieben habe. – Also: Premiere oder erst Generalprobe auf kommende Nord-Süd-Kriege?
Krippendorff sieht die eigentliche (aber vorerst blockierte) Lösung hinter den hilflosen Friedensdemonstrationen: »Regierungsgegner aller Völker, vereinigt euch!«
»Königsmechanismus«: eine Anordnung der Interessenwidersprüche derart, dass ihre Austragung die Zentralmacht reproduziert.
*
Rückblick auf die atemberaubende Utopie des Neuen Denkens (1985– 1990). – Michael Brie (»Zur Herrschaft verdammt? Experimentierfelder für eine neue Weltordnung«, in: Freitag, 1.2.) analysiert, wie die durch die Perestrojka neu aufgeworfene deutsche Frage »die realen Machtstrukturen, das tatsächliche Kräfteverhältnis und die bewussten oder auch instinktiven Strategien der Hauptkräfte der Gegenwart offenbarte«. Er konfiguriert die politischen Alternativen, wodurch unterm Strich bestürzend deutlich wird, dass die hoffnungsvoll aufgebrochenen Völker von den westlichen Interessen zu Vehikeln gemacht wurden. Die deutsche »Vereinigung« wurde zur Generalprobe für die Herstellung einer Neuen Weltordnung des transnationalen Kapitalismus »westlicher« Provenienz.
Das weltpolitische Machtvakuum, das der Kalte Krieg hinterlassen hatte, wurde »geradezu blitzartig« gefüllt: 1. Stellvertretende Niedermachung des »die Supermächte nachäffenden Zöglings«. – 2. Ökonomischpolitische Erpressung von SU und China. – 3. EG und Japan akzeptieren (und finanzieren partiell) die führende Rolle der USA bei der Herstellung jener korporativen Weltherrschaft des trilateralen »Westens«. Das erlaubt den USA, den Verlust der ökonomischen Hegemonie durch militärische Hegemonie zu kompensieren. – 4. Krieg als Fernsehspiel und Ausblendung (Zensur) von Informationen (aber die Opferbilder werden folgen). – 5. »Die linken und liberalen Intellektuellen aber finden gegenwärtig nur zu ohnmächtigem Protest, hilflosem Räsonnement oder machtpolitischem Scheinrealismus.«
Paradoxer Erfolg: Die »Politik einer Perestrojka für die Sowjetunion und die ganze Welt war erfolgreich bei der Auflösung einer Supermacht und damit der alten internationalen politischen Sicherheitsstrukturen sowie beim Zerfall des Staatssozialismus zumindest in Osteuropa. Sie scheiterte vor den Aufgaben des Aufbaus einer neuen internationalen wie auch inneren demokratischen soziopolitischen Ordnung in der UdSSR.« Den Schlüssel zu diesem Paradox sieht Brie in den Machtstrukturen und der Lebensweise der drei kapitalistischen Weltmachtzentren (mit ihrer »ungeheuren und faszinierenden Dynamik«), wo Massen (80 Prozent) und Eliten darin übereinstimmen (»ein stabiles und kaum wirklich zu erschütterndes Bündnis«, derselbe Block, der den Anschluss der DDR durchsetzte), entsprechende Selbstveränderung abzulehnen. »Eine wirkliche Perestrojka könnte nur von ihnen ausgehen, oder sie muss scheitern.« Als Folge hiervon sei die UNO von den USA instrumentalisiert, »neues Wettrüsten unvermeidlich und jede Alternative vorerst zerschlagen«.
MB zitiert Hondrich, der im »Spiegel« der Vorwoche die »pax americana et europea« (Japan vergessend) damit als notwendig begründet hat, dass die »weniger zivilisierten Länder« noch nicht den Krieg zu verurteilen gelernt hätten. Der Westen sei »zur Dominanz verurteilt«. Brie ergänzt: »Wer Dominanz sagt, spricht verschämt von Herrschaft.« Daher gewaltsame Entwaffnung. Hobbes redivivus, äußerlich erzwungene Zivilität, allenfalls Vorstufe »wirklicher Zivilisation«. Deren Merkmal wäre »selbstbewusste, freie, demokratisch erstreitbare Fähigkeit zur Selbstbeschränkung, Interessenabwägung und zur eigenen Neubesinnung.« Gemessen daran stecken wir noch in der Barbarei. Einer »pluralen Weltordnung« steht vor allem westliche Lernunfähigkeit im Wege. Von dieser haben die Eliten der Dritten Welt gelernt, sie ahmen nach, und für den Westen ist gerade diese »nachmachende Entwicklung« bedrohlich geworden. »Für kurze Zeit schien uns 1989 Geschichte wieder möglich. Aber die Chancen wurden zerstört. Die Zukunft wurde vernichtet […]. Die Apokalypse ist unausweichlich geworden.« – Undialektisch.
*
Glück. – Gesundheit, Erfolg in sinnvoller Arbeit, Liebesglück. Prekär im allgemeinen Unglück. Keineswegs das Substanzielle, wovon Adorno so merkwürdig spricht.
Systemisch vorgesehen: Plastikeuphorie, Masturbation und Schnaps bei Pay-TV im Hotelzimmer.
13. Februar 1991
Der nächste hat sich verabschiedet: Uwe Rauhöft aus Potsdam, der mit einer ideologietheoretischen Arbeit hängengelassen worden ist und einen westlichen Betreuer suchte (seine Betreuerin – Helga Marx, zusammen mit Wolfgang Jonas und Valentine Linsbauer Autorin der Produktivkräfte in der Geschichte von 1969 – war »abgewickelt« worden). Rauhöft gibt »die Philosophie« auf und wählt zunächst ein Babyjahr, um sich später wieder seinem ursprünglichen Beruf eines Mathematiklehrers zuzuwenden.
Für die Zürcher Wochenzeitung einen kleinen Kommentar zu Biermann und Enzensberger geschrieben. Nichts ist weiter weg als die Zeit der Hoffnungen von vor einem Jahr.
14. Februar 1991
Hörte am Radio Biedenkopf die Durchkapitalisierung der ehemaligen DDR mit der »ersten Mondreise der Amerikaner« vergleichen. Die Leute dort über die Maßen unzufrieden und enttäuscht. Aber sie wenden sich keineswegs der PDS zu, die sich ihnen als Interessenvertretung anbietet.
15. Februar 1991
Gorbatschow soll »Diktatur des Gesetzes« ankündigen: der Rechtsstaat wird aufgezwungen.
Vom Krieg nun Totenbilder: als zwei Raketen die, wie es heißt, 2 Meter dicken Wände eines Luftschutzbunkers in Bagdad durchschlagen hatten, war auch der von beiden kriegführenden Seiten errichtete Schleier vor den Ziviltoten zerrissen. Die Welt bekam Hunderte von verbrannten Frauen und Kindern zu sehen. Die Journalisten suchten vergeblich nach Spuren des Befehlsbunkers, von dem die USA weiterhin behaupten, dass er in jenem Bunker gewesen sei. Es scheint, sie haben mehr Waffen als Ziele.
16. Februar 1991
Mária Huber beschreibt in der ZEIT vom 1.2., was mir auch der Student aus Leningrad gesagt hat: Die partielle Währungsreform in der Sowjetunion machte fast nur Ärger, schadete den Leuten, brachte das gesamte Leben durcheinander, traf jedenfalls die Mafia so gut wie gar nicht. Die ZEIT überschreibt den Artikel: »Alle Macht dem KGB«. Auf der Titelseite ein Artikel von Christian Schmidt-Häuer: »Ein halber Putsch? Gorbatschows Wende am Ende«. – Oder rückt jetzt der Sturz Gorbatschows ins Visier des Westens? Ist es mit der Interessenübereinstimmung vorbei? Die Nachrichten aus der SU konfus-katastrophisch; ich entdecke keine Handschrift darin.
Laut Katja Maurer hat Engelbrecht gefragt, wo denn die Artikel von Haug blieben. Ich glaube, er will sehen, wie ich in der Hölle schmore.
Simulation. – Die Attrappenwaffe als Waffenattrappe, Mario Mosellis Plastikpanzer aus Turin, die jetzt im Irak US-Raketen auf sich ziehen. Der Preis nicht simuliert: 15 000 USD für einen russischen T 55 (falls es stimmt, was die ZEIT schreibt).
18. Februar 1991
Eberhard Radczuweit, der den Verein Deutsch-Sowjetische Kontakte ins Leben gerufen hat, schreibt als Reaktion auf mein Buch, inzwischen habe er den Boden unter den Füßen verloren. »Wer als Sozialist auf die Perestrojka hoffte, kann Melancholiker werden.« Er will von Westberlin aus in den sowjetischen Meinungsstreit eingreifen: »Unsere FHW-Leute sollen das Mysterium der Sozialen Marktwirtschaft entschleiern, unsere Marxisten über ML diskutieren und die ›Berliner Realisten‹ in der Manege kritische Malerei vorstellen, wo der Sozialistische Realismus (Stalinistischer Idealismus) den Realismusbegriff schlechthin in Verruf brachte.« Mich will er über A. Bytschkow nach Moskau einladen lassen. Das Institut für Gesellschaftswissenschaften habe »endgültig den Boden verloren«.
21. Februar 1991, auf der Reise nach Aachen
Zur Abwechslung bei einem DFG-geförderten Colloquium über Institutionentheorie, eingeladen von Karl-Siegbert Rehberg, der ein etwas synkretistisches, aber interessante Gedanken aufnehmendes Papier verschickt hat. Sinngemäß heißt es dort etwa: Wie bei den Reichen vom Geld, schweigt man bei den Mächtigen von der Macht. In seinem Diskurs lockert R. die härtesten Tatbestände (z.B. den gegenwärtigen Krieg), um sie so umzugruppieren, dass wenig verschwiegen und doch alles folgenlos ist. Als Denker könnte er die passive Revolution personifizieren.
Konservativ ist die Institutionentheorie, wo sie ›uns‹ herabsetzt zu Ein- und Unter-Geordneten, indem sie Ordnung alias Herrschaft als Unverfügbares voraussetzt. Ich riskiere die These, dass jede Institution als Kompromissbildung entsteht. Werde dabei von Hans-Joachim Giegel unterbrochen, der verlangt, man solle endlich den normativen Ansatz von Honneth diskutieren. Da zu meiner Verwunderung weder er noch die Joas, Honneth u.a. den Begriff »Kompromissbildung« verstehen, obwohl ich auf Freud und die Wiederaufnahme seiner Gedanken bei gewissen Linguisten und Semiotikern hingewiesen hatte, erhalte ich immer wieder griffiges Material, um nachzusetzen.
Ich schlage (vergebens) vor, die römischen institutiones als Kernbeispiel zu nehmen, dem wir nicht grundlos den Ausdruck entlehnen. Es herrscht die Tendenz, den Institutionenbegriff auf jede kulturelle Bestimmtheit, auf jede Üblichkeit auszudehnen. Eine solche Ausdehnung gibt es in der Wirklichkeit; Kerninstitutionen stützen sekundäre Institutionalisierungen. Daher ist der Begriff Institutionengefüge unentbehrlich, man muss, was er meint, dann aber auch konkret als solches analysieren. Für mich der Staat die I. par excellence. Die sog. Religion bildete ja in Gestalt der Theokratie eine frühe Form von Staat, die aber gegenüber der Kriegslogik nicht stabil war. Erst die komplexe Kompromissbildung, bei der nicht nur Herrschende und Beherrschte, sondern auch die drei Ordnungen der Regierung, der Religion und des Krieges ins Verhältnis gebracht sind, gibt den Kernbestand des Institutionengefüges her.
Schließlich frage ich, warum der Ideologiebegriff in den Thesen von Rehberg und Göhler nicht vorkommt. Riskiere den Satz: Jede Institution ist eine ideologische Macht. Werde indes belehrt, dass man diesen Begriff nicht mehr benutzen könne, genau so wenig wie Herrschaft. Von Ideologietheorie scheint hier niemand etwas zu wissen. Göhler: Ideologie ist interessiertes Bewusstsein, Lenk: Zurückbleiben hinter dem fortgeschrittensten Bewusstsein, Honneth: eine Weltdeutung mit Sperren.
Hans Joas überrascht die Anwesenden mit der Kategorie der »kollektiven Efferveszenz«, die er aus dem Französischen von Durkheim ins Deutsche übernimmt, ein wunderbares symbolisches Kapital schaffend. Er begeistert sich für »affektive Bindungswirkungen«, was Kurt Lenk zum Hinweis auf Freuds und Webers Analysen des Führerkults provoziert. Seine These: Institutionen gehen aus Erlebnissen der »kollektiven Efferveszenz« oder Fusionserlebnissen hervor. Michael Greven will wissen, wie er dann den Parlamentarismus denkt. Göhler sieht die Verfassungsgebung der BRD als rein zweckrationalen Akt, der erst später retrospektiv seinen Gründungsmythos nach sich zieht.
Joas praktiziert die »Fusion« als Denkform: »Die wirkliche Begründung einer Freundschaft ist die Freundschaft, die Begründung eines Glaubens der Glaube, einer Bindung die Bindung.« Das kriegt einen positivistischen Dreh, weil er Kritik verwirft: Gegen die Wirklichkeit ein soziales Ideal zu richten (und so denkt er Kritik), sei klassisch-jugendlich. Er hat merklich Begeisterung für seine Ware entwickelt. Und das ist eine gefährliche Ware: Bindungsmythen, zwischen Sorel und Mussolini. Im Übrigen wittere ich Institutionentechnokratie in kritisch-theoretischer Verpackung. Werde aber belehrt, dass Joas nichts mit Kritischer Theorie zu tun hat. Ich riskiere die These, dass jede I. vom Gemeinwesensfundus schöpft und dass die »kollektive Efferveszenz« ein entsprechendes Erleben ist.
Ein Schmalz-Bruns von der Bundeswehrhochschule kommt mir in der Pause aggressiv. Studenten aus Aachen retten mich. Sie kennen Schriften des Projekts Ideologietheorie und haben meine Einladung angeregt.
*
Abends bei Kurt Lenk, den ich zuerst nicht wieder erkannt hatte und der mir jetzt wieder so vertraut ist, als lägen nicht zwanzig Jahre zwischen dieser und unserer letzten Begegnung. Seine Diskussionsbeiträge helfen mir, die enorme Feindseligkeit der Prätendentengeneration zu überstehen. Lenk sieht diese Ex-Achtundsechziger ihre Versöhnung mit dem Establishment begehen. Man hat sich damals in einander getäuscht, keine der beiden Seiten ist so, wie damals gemeint. Auch ich spüre bei ihnen einen Willen zum Positiven, der immer dann eine aggressive Wendung nimmt, wenn Kritik geübt wird.
22. Februar 1991, Aachen
Greven schlägt vor, die Position von Honneth, Giegel u.a. als Konstruktive Theorie zu bezeichnen, jedenfalls nicht mehr als Kritische Theorie, denn diese war institutionenkritisch. Er beschreibt den Gestus der Habermasianer als ein permanentes Entwerfen von Denkmöglichkeiten: »Man könnte dies so fassen …«. Diese Konstruktive Theorie betreibe eine normative Institutionentheorie, von der man über die Gegenwartsgesellschaft kaum mehr etwas erfährt. Der einstige Gehlenschüler Rehberg fügt hinzu: Die Nachtseiten institutioneller Zusammenhänge, die vielleicht Institutionalisierungsgrund waren, werden vor lauter Affirmativität ausgeblendet.
Hans Joas erklärt sich mit Habermas nur in der einzigen Weise verwandt, gleichfalls kilometerweit entfernt von Adorno zu sein. Axel Honneth erklärt Habermas’ Verschweigepraxis mir gegenüber kühl mit »Inkompatibilität der Theorieansätze«. Da irrt er, der er am selben Machtspiel teilhat: zur honorierten Linken des Systems zu gehören und dem die systemkritische Linke zu opfern. In der Diskussion warf er mir vor, »radikal skeptisch« zu sein. Ich nehme den Ball auf. Wenn skepséô untersuchen, erforschen bedeutet, dann will ich weiter untersuchen, was ist, wogegen er konstruiert, warum es so sein muss, wie es ist. Ich bestehe immer wieder (mit geringem Echo) darauf, dass wir uns als institutionelle Diskursanten selbst ins Bild einbeziehen müssen.
Auf der Fahrt nach Frankfurt ignorieren mich diese falschen Frankfurter. Ich meinte während der gesamten Tagung etwas wie Hass von ihnen zu spüren. Wer bin ich?
Privatisierung. – Nun nehmen sie sogar die Kläranlagen aufs Korn. Die giftigen Exkremente werden über uns kommen.
23. Februar 1991, Frankfurt
In Frankfurt bei den Götzes überaus lieb aufgenommen: zunächst von den Kindern. Grete mit ihren neun Jahren eine kleine Persönlichkeit, macht Ballett und spricht sehr bestimmt. Den zwei (oder drei?) Jahre älteren Florian nennt sie ihren »kleinen Bruder«. Es stimmt in gewisser Weise; er scheint die Zeit anhalten zu wollen an der Schwelle zur Pubertät, ungeheuer zart und phantasievoll.
Bei der IMSF-Tagung im Haus der Jugend am Deutschherrenufer finde ich Jupp Schleifstein noch kleiner geworden, auf einen Kinderkörper zusammengeschrumpft. Verteidigt Gorbatschow. Man musste runter von der Gewalt, daher nun Zerfall und Auflösung.
Die Tagung beginnt überraschend unergiebig. Hatte vom altkommunistischen Milieu mehr erwartet. Flüchte in der Mittagspause zu den Götzes, vor allem der Kinder wegen.
Heinz Jung erzählt mir sein Leben und bringt mir den alten Spruch bei: »Professoren und Doktoren – Proletariat, Du bist verloren!« Er kriegte ihn dereinst von seinem alten kommunistischen Onkel zu hören, der ihm eurokommunistische Tendenzen verübelte.
25. Februar 1991
Eine ebenso intelligente wie gut vorbereitete Radio-Journalistin (Walz) interviewte mich für den Bayrischen Rundfunk über die Gramsci-Ausgabe.
26. Februar 1991
Nach fünfstündiger Autofahrt Lesung in Bremen (aus dem Perestrojka-Journal). War müde, fand keine Form, beim Diskutieren kein Ende. Das Publikum (MASCH) freundlich, wollte aber über den Krieg reden. Ich meine zu merken, dass sie unter der Maske radikaler Kritik unsere Niederlage verinnerlichen und sage, sie hätten die Dinge früher zu harmlos gesehen und jetzt zu negativ. Der Moment, da ich aus dem Journal vorlesen konnte, scheint vorbei.
1. März 1991, Fern (Lungau)
Die Shakespeare-Sonette präsentieren sich überraschend: Reklame fürs Heiraten und Kinderzeugen. Eine recht manierierte Metaphernkompetenz führt sich vor, möglicherweise ironisch-doppelbödig. Dass der Adressat ein Jüngling ist, dessen Schönheit vom älteren Dichter besungen wird, erinnert an die antike Päderastie; in der Schwebe gehalten wird (zumindest in den ersten neun Sonetten), ob diese Erinnerung zulässig ist. Manifest dient die »Schönheit« als Vehikel, das die Zeit unaufhaltsam in Bewegung setzt, indem sie dieselbe zum Vergänglichen schlechthin macht, dem indes ein Weg zur Dauer offensteht in Gestalt des Erben (heir).
Die Ähnlichkeiten (resemblances), in die das Problem des rechten und rechtzeitigen Nützens der Schönheit eingewoben ist, sind aberwitzig: Zeuger, Sohn und »glückliche Mutter« harmonieren zusammen wie wohlgestimmte Saiten im Akkord. Wenn die starke Jugend (strong youth) der Sommer ist, so der Sohn, in dem sie wieder auflebt, das im Sommer aus Blüte und Frucht hergestellte »Destillat«, das im Alters-Winter in Glaswänden (der Schnapsflasche) lebt, während draußen der Tod herrscht.
*
Im Golf »Feuerpause«; das Wort »Pause« droht mit Wiederaufnahme im Falle verweigerter Fügsamkeit. Der Bodenkrieg soll eine Art Spaziergang gewesen sein. »Es war wie Truthahnschießen« (vom Flugzeug aus), beschrieben US-Soldaten ihren Feldzug. Nur 79 US-Soldaten sollen gefallen sein, auf irakischer Seite dagegen »bis zu 200 000«, freut sich die FAZ. Schon wieder Sektlaune. Nur ein Tropfen Wermut: Die BRD hat gewissermaßen verloren, weil sie es an Kriegsbegeisterung missen ließ. In der FAZ-Leitglosse verhöhnt Fack die »ablassheischende Nachtwächterrolle« der BRD: dass sie keine Soldaten geschickt, sondern sich freigekauft hat (»Ablass«). Der Grund für diesen Ärger ganz materialistisch: Die riesigen Summen für den Wiederaufbau Kuwaits werden nicht nach Regeln des Weltmarkts (Preis- und Qualitätskonkurrenz) vergeben, sondern feudal, als Lohn für Gefolgschaftstreue: Aufträge wie Lehen. Deutsches Kapital hofft jetzt, wenigstens durch die koreanische Hintertür Zugang zu diesen Profittöpfen zu erhalten. Südkorea hat Flugzeuge und Sanitäter für den Krieg gestellt, und in manchem koreanischen Kapital steckt ein deutsches. Den ersten »Auftrag« aber erhält die US-Armee, die sich dadurch in ein riesiges Lohnunternehmen verwandelt: sie darf die von ihr angerichteten Trümmer aufräumen. Neue Verhältnisse kündigen sich an: das Ölscheichtum, einer der größten Grundrentner der Welt, der sich längst in den westlichen Industrialismus eingekauft hat (z.B. bei Mercedes-Benz), zahlte zunächst mit über 50 Mrd USD die Aufrüstung des Irak, dann die Zerstörung dieser Ausrüstung durch die USA und nun den Wiederaufbau. Eine neue Dimension von angewandtem Militärkeynesianismus. Ein Grund für Konflikte in der OPEC (und mit dem Irak): Was Kuwait an niedrigen Ölpreisen verliert, gewinnt es an westlichen Kapitalprofiten.
Irak. – Katastrophale militärische Niederlage. Die Elite-Panzertruppen zum Schluss eingekesselt und ausgeschaltet. Infrastrukturell das Land kaputt, ökonomisch völlig am Boden, angewiesen auf Gnadenerweise. – Die Chemiewaffen nicht eingesetzt. Warum nicht? Unfähig dazu oder aus Selbsterhaltung (Kriegsbegrenzung)? Die Raketen eher symbolisch. Das Kalkül einer Ausweitung des Krieges (auf möglichst viele islamische Länder, ausgelöst durch ein provoziertes Eingreifen Israels) ist nicht aufgegangen. Israel konnte von den USA herausgehalten werden.
USA. – Warum stellten sie (und wann) den Krieg ein? Welche Rolle spielten dabei UNO, Sicherheitsrat, Sowjetunion? Gingen die USA so weit als irgend möglich, an die äußerste Grenze der Resolutionen des Weltsicherheitsrats?
In der BRD fielen die Aktien wegen der Feuereinstellung: hinterm Rauchschleier des Krieges scheint die Weltrezession wieder hervorzutreten.
Slowenien will eine eigne Währung einführen. Heißen soll sie zwischen donaumonarchischem Taler und amerikanischem Dollar: »Tolar«.
2. März 1991
Gina Thomas ist sich nicht zu schade, in der gestrigen FAZ mit einem imperialistischen Kiplingzitat, das im Munde eines britischen Offiziers vor dem Fronteinsatz im Irak bei der Truppe Wirkung gezeigt haben soll, fürs Bildungswesen zu werben. Dabei geht es irgendwie ums Töten zwecks dauernder Weltherrschaft (»als Mittel dauernder imperialer Überlegenheit«) und darum, ein richtiger Mann zu werden. Wie aus Theweleit. Und für so was will die Thomas klassische Bildung.
Im Irak soll es zu Bewegungen gegen das Baath-Regime gekommen sein, in Basra »Anarchie« herrschen, nachdem die Führungsschicht sich fluchtartig davongemacht habe.
Jugoslawien rutscht weiter in den Bürgerkrieg. Kroatien setzt »Sonderpolizei« gegen serbische Autonomisten ein. Gestern sechs Tote. Nun soll die Armee eingreifen.
Im Januar in der Bundesrepublik 22 000 Wehrdienstverweigerer angesichts des Golfkrieges.
*
Gewimmel von Assoziationen: Phantasiegestalten, Sekundenfilme, ein anderes Reich der Schatten, mögliche Leben, ungelebte Möglichkeiten. Diesen Gestalten sich zuzuwenden, sie auszukosten, das heißt Ausruhen.
3. März 1991
Shakespeare-Sonette. – Fair war einmal = kalós. Wirft ein überraschendes Licht auf die fairness und von dieser zurück ins alte Griechentum. The sonnetts: Liebesmanierismus mit eingeblendetem (manieristischem) Antimanierismus (130).
XXII: Zauberhafte Teilhabe des Liebenden an der Jugend des Geliebten. Dieser Zeitzauber geht nur gleichgeschlechtlich. Er unterstellt jedoch (Unmöglichkeit am Grunde jedes Zaubers) Gegenliebe. Dann lebt eines jeden Herz in der Brust des andern. »How can I then be elder than thou art?« Er sagt nicht, dass dann für den jungen Geliebten das komplementäre Gegenteil gelten müsste: How can thou then be younger than I am?
Synästhesien, hervorgehend aus den alten Analogien und den mittelalterlichen Ähnlichkeiten: To hear with eyes belongs to love’s fine wit.
XXXV: Irgendein öffentlicher Sexskandal scheint geschehen. Sie dürfen sich nicht mehr sehen. Der Dichter-Liebhaber mit sich selbst im Clinch: for thy sensual fault I bring in sense. Seine Zerrissenheit artikuliert er als inneren Bürgerkrieg: such civil war is in my love and hate.
*