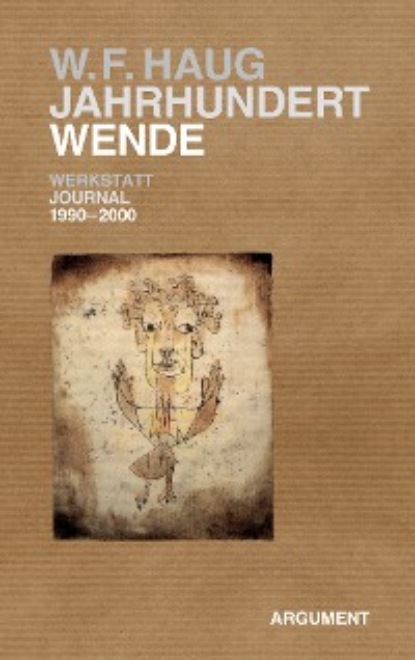- -
- 100%
- +
Joseph S. Nye jr. (Harvard): Transformation der amerikanischen Macht. Das gewandelte Umfeld in Gestalt der transnationalen Konzerne und der ökologischen Politiken kostet die Staaten ihre Autonomie. Dazu reiht er den »Terrorismus« (Deckwort).
Terrorismus. – Vergleich mit der Piraterie des 16.–17. Jahrhunderts. Doppelte Übergangserscheinung von Freibeuterei in Handel und von beidem in die moderne Staatsmarine. Die britische Flotte bildete sich aus eben jener mixed economy aus Handel und Freibeuterei. Die Entfaltung von Welthandel per Schiff machte – außerhalb der um die entsprechenden Machtpositionen sich drehenden Kriege – Verkehrssicherheit auf See nötig. Zu Lande die Räuber. Heute entsprechen jenen alten Störern alle Arten von Mächten, die der auftauchenden globalen Verkehrsordnung des transnationalen High-Tech-Kapitalismus in die Quere kommen. Völker, denen ihr Recht vorenthalten ist, kommen kaum als Völkerrechtssubjekte in Frage. Die Unterliegenden werden doppelt unterliegen, falls sie nicht nachhaltig kämpfen und effektiv stören. Erst wenn sie das tun und dabei nicht besiegt werden können, werden die Herrschenden bestrebt sein, sie in den Völkerrechtskompromiss einzubeziehen.
Das schlechte Gewissen während des Golfkrieges nährte die Terroristenangst. Zusammenbruch des Flugtourismus und überhaupt eines Teils des Flugverkehrs. Auffallend wenig wirklicher Terrorismus in dieser Zeit.
5. März 1991, Esslingen
Der Oberste Sowjet hat ein neues Währungsgesetz verabschiedet, das schon wieder (noch immer) Staat gegen Geld (Eigenlogik des Marktes) einsetzt, derart wieder Wirklichkeit (und Eigentätigkeit der Leute) von sich abspaltend.
7. März 1991
»Von der SED gestohlenes Grundvermögen« nennt die FAZ-Leitglosse den aus Enteignungen hervorgegangenen genossenschaftlich genutzten Boden der DDR. Hybris der Sieger. Aber im Osten reift ein zweiter Aufstand heran, und die Klügeren aus den bürgerlichen Parteien haben begriffen, dass Ökonomie vor dem Prinzip Privateigentum rangiert. Zumindest verbal macht man jetzt Zugeständnisse: »Sanieren, um verkaufsreif zu machen«, soll der neue Auftrag an die »Treuhand« lauten, die bisher privatisiert hat um der Privatisierung willen und zu diesem Zweck die Unternehmen zuerst vollends ruinierte: Ausrottungskreuzzug gegen nichtkapitalistische Eigentumsformen.
*
Mit Barbara, meiner ›illegitimen‹ Halbschwester, traf ich mich auf dem Parkplatz des pforzheimer Krankenhauses Siloa. Sie führte mich auf den Trümmerberg. Als die Stadt am 22. Februar 1945 ohne jeden militärischen Sinn vernichtet wurde und mit ihr 17 000 Menschen untergingen, da war B. noch im Mutterleib. Es war wie ein Gleichnis: der Boden, auf dem wir zusammenkamen, waren die Trümmer einer großen Liebe, einer unheilbaren Verstrickung dreier Menschen. Mein Vater war beinahe vierzig, das Mädchen Else knapp halb so alt (sie ist am 4. August 1924 geboren).
Zu denken, dass diese Else, die nie einen anderen Mann hatte, noch lebte, als ich vor drei Jahren in Pforzheim über Antifaschismus sprach, während Barbara mit ihrem Mann inkognito im Publikum saß, um mich zu beobachten. Ihre Mutter lehnte damals den Gedanken, mich kennenzulernen, noch strikt ab. Jetzt versuchen wir, die fragmentarischen Hinweise, die wir von unseren Müttern haben, zusammenzusetzen und unsere jeweilige Verstrickung zu erkunden. Es ist ein Puzzle, aber kein Spiel, allzu viel Dunkles hängt an dieser Familiensaga.
Barbara hat blaugraue Augen. Sie ist Lehrerin in einer Grundschule, auf dem Trümmerberg befürchtet sie einen Moment lang, in einem Kind den Schüler wiederzuerkennen, mit dem sie am Morgen »zusammengerasselt« ist. Sie ist mit allerlei Selbstetikettierungen zur Hand, als wollte sie möglicher Kritik zuvorkommen: »unfähig zur Spontaneität«, »konfliktscheu« usw.
Ihre Mutter hat das Unglück ihrer großen und »schuldigen« Liebe auf eine Weise verallgemeinert, dass sie alles Unglück aus der Umgebung auf sich nahm; sie war »der Jesus von Pforzheim«. Als Arzthelferin die Klagen der Patienten nicht nur anhörend, sondern das geklagte Leid mitduldend. In jenem Schicksalsjahr 1945 war Elses Mutter der Schwangeren nicht beigestanden, sondern hatte sie zu einer Tante geschickt. Standardsatz der Mutter: »was sollen da die Leute sagen«. »Diesen Satz haben meine Kinder nicht ein einziges Mal von mir gehört«, sagt Barbara. Sie schildert ihre Ältere (Brita, 15) als verschlossen und hausgebunden, die jüngere (Berit, 10) als »Außenministerin« der Familie, nicht zu Hause zu halten. Als mein Brief kam, sagte Berit sofort: »kriege ich jetzt einen Onkel?«
Namenszauber: Barbara (genannt Bara), Bernd; Brita, Berit.
Als wir uns verabschieden, zögert B. einen Moment lang, ob sie mich nach Hause einladen soll. Meine Schwester zu sein, lehnt sie ab; wir haben nicht denselben Vater, sondern nur denselben Erzeuger, sagt sie, und Geschwister haben eine gemeinsame Geschichte, während wir nur eine dunkle Geschichte unter uns haben, wie den Schutt von Altpforzheim, als ein Unbewusstes unserer Kindheit.
8. März 1991
Geschichten meiner Mutter. – Die von einem Arzt eines Tags diagnostizierte Rückgratverkrümmung, die sie darauf zurückführte, dass sie als Kind stets verschraubt bei Tisch saß, weggedreht von ihrem Vater, um ihn nicht sehen zu müssen, zur Körperform gewordener Vaterhass. Irgendeine schlechte Sitte seinerseits widerte sie an. Mütterliche »Sexualaufklärung« nach ihrer ersten Periode, die viel zu früh gekommen sei, bei noch ganz kindlich dünnem Körper: »Und dann gibt es da noch etwas, aber das sollte man lieber lassen.«
In der FAZ ein Gedicht von Werner Söllner, Swanns Arrangement mit sich selbst, das, wie schon der Titel zeigt, mit Kennern von Proust kommuniziert, die den Namen Swann wie ein Emblem für die Suche eines Homosexuellen nach seiner verlorenen Jugendzeit (Jugendliebe) lesen: Vergangenheit, halb / vergessener Ton, bittere Frucht, einzig / gelebte Zeit: süßer Kern deiner Flucht. In der Gegenwart fühlt sich das poetische Ich in einem Abgrund / voll Traum und Verlust / dieser süßen Last aus allem / was du gesehen hast. Hübsch die Rede von den Zimmern / die dich noch immer bewohnen.
9. März 1991
Sabine Brandt darf im FAZ-Feuilleton hetzen, gegen Hermann Kant, Helmut Baierl, Gerhard Bengsch (»Krupp und Krause«), die sie mit Bedacht zwischen schreibenden Sicherheitspolizisten untermüllt, um darüber zu lamentieren, dass sie kraft deutscher Einheit jetzt die demokratischen Grundrechte nutzen dürfen und »unsere Mitbürger« geworden sind: »Das müssen wir schlucken, wie die Generation vor uns nach 1945 manches und manchen hat schlucken müssen.«
Laut Neil Postman hat der Durchschnittsamerikaner an seinem 20. Geburtstag 800 000 Werbespots über sich ergehen lassen. Rechnet man die ersten drei Lebensjahre ab, wären das knapp 134 pro Tag. Er würde sich nicht wundern, wenn demnächst Jesus mit einer Flasche aufträte: »Als ich damals in Kanaa Wasser in Wein verwandelte, war er nicht entfernt so gut wie dieser Pinot Noir von Gallo.«
10. März 1991
In Moskau eine riesige Demonstration der »Demokraten« gegen Gorbatschow. Afanasjew, der in meinem Gorbatschow-Buch von 1989 noch als eine der Stimmen im Einklang mit G, wenngleich sich in manchem vorwagend, vorkommt, seit mehr als einem Jahr ein scharfer Gegner, ja Feind. Als mein Buch erschien, gingen die Flitterwochen der Perestrojka, als sich noch alle Unzufriedenheit hinter G sammelte, eben zu Ende. Die Taktik Jelzins jetzt, Gorbatschows rechtsstaatliche Rekonstruktion der Sowjetunion zu durchkreuzen. Der Bürgerkrieg, vor dem G warnt, sei dessen Krieg gegen das Volk, schreien sie.
11. März 1991
Im Deutschlandsender Kultur – einem Sender der ehemaligen DDR, der noch existiert und wo ich zu Wort komme, wie nie zuvor (und vermutlich auch nicht danach) in der Bundesrepublik – eine Diskussion über Gramsci mit Johannes Agnoli und Otto Kallscheuer. Manfred Lötsch, der zugesagt hatte, bleibt aus. Meine beiden Gesprächspartner haben aus entgegengesetzten Gründen ein Interesse daran, Gramsci als Anhänger der Diktatur des Proletariats hinzustellen, Kallscheuer, um ihn zugunsten von Croce zu verlassen, Agnoli, um ihn als Kronzeugen gegen den bürgerlichen Parlamentarismus zu haben. Ich vermute dagegen, dass bei Gramsci aufgrund seiner Fragestellung (Scheitern des revolutionären Kommunismus im Westen) zu aller bewussten Fragestellung eine gleichsam hinterrücks erfolgte Problemverschiebung hinzugekommen ist, die seine weiterwirkende Aktualität ausmacht: Transposition der (Klassen-) Kämpfe in die politische Kultur. In der Gesprächsstruktur fehlt ein DDR-Intellektueller. Aus taktischen Gründen stütze ich mich vor allem auf den abwesenden Peter Glotz und spare die Kritik an ihm aus. Sie läuft darauf hinaus, dass bei ihm das emanzipatorische Projekt Gramscis wegschwimmt und eine inhaltsleere Orientierung auf etwas allgemein Umkämpftes herauskommt. Das drückt die Konstellation der drei »Denkfiguren« aus, die Glotz bei Gramsci herausgreift: Meinungsführerschaft, Volkstümlichkeit, Kompromissfähigkeit. Da ist jede Spur dessen getilgt, worum es dabei spezifisch geht.
12. März 1991
Mutationen der Warenform. – »Shareware« und »public domain-software« als Modifikationen der Warenform, Realscholastik einer Produktionsweise, die dem klassischen Privateigentum entwächst. »Shareware« ein Unbegriff für das »Hinüberragen« einer Ware in den Nichtwarebereich, wo die Dinge ohne Gegenleistung von jedem angeeignet werden können wie das Einmaleins oder das Alphabet. »Shareware« ist die gute Miene zum bösen Spiel, dass sich Programme durch jeden unbegrenzt reproduzieren lassen bei reinen Materialkosten. Das hat den Markt gespalten in einen formellen und einen informellen. Der formelle Markt verlangte Rechtsschutz, dieser aber nur zufällig wirksam. Der informelle Markt verlangt kein Vertriebssystem, die »Ware« verbreitet sich »von selbst«, wie es vom Kapitalstandpunkt heißt (in Wirklichkeit verbreiten sie die Benutzer: einer der Unterschiede von ziviler und bourgeoiser Gesellschaft). Das materielle Interesse der Verwerter zieht sich nun auf die Handbücher zurück, da aber auch diese kopiert werden, auf die Zusage eines Up-date-Service gegen Zahlung der Registrierungsgebühr. Eine Halbform sind daher die Kurzformen, die gegen eine kleine Gebühr verkauft werden und die der Nutzer probefahren und mit konkurrierenden Programmen vergleichen kann, um sich dann ggf. für den Erwerb der Vollform zu entscheiden. – »Public domain-software« ist mit öffentlichen Mitteln entwickelt und darf nach US-amerikanischem Recht daher nicht als Ware gehandelt werden.
16. März 1991
Die SU hat den steckbrieflich gesuchten alten Erich Honecker in einem Militärflugzeug nach Moskau gebracht. Der Akt widerrechtlich, aber widerwärtig wäre gewesen, ihn zu unterlassen. Hans-Jochen Vogel, hierin idealtypischer Sozialdemokrat, sprach sich im Bundestag für die strafrechtliche Verfolgung H.s aus, erinnerte aber an die zehn Jahre Haft unter den Nazis und daran, dass H. vor wenigen Jahren noch mit allen Ehren in Bonn empfangen worden war.
Der Golf-Krieg für die USA das erwartete Geschäft. Tribute der »Bundesgenossen« minus Kosten, großzügig gerechnet, = 7,4 Mrd US-Dollar Reingewinn. Darin ist enthalten, dass für den Abzug aus der Golfregion 7 Mrd USD, dazu für den Heimtransport noch einmal 5,2 Mrd USD und schließlich 6,4 Mrd USD für Wiederbeschaffung eingerechnet sind. Man sieht, dass über die Kriegskosten hinaus Alimente verlangt werden. Die Gesamtkosten werden auf 47,5 Mrd USD geschätzt. Der Überschuss soll nicht zurückgegeben werden, weil Menschenleben nicht mit Geld aufzuwiegen sei, wie der demokratische Abgeordnete Schroeder aus Colorado, Anwärter auf einen kleinen Tui-Preis, gesagt hat. Einzelsubsidien: Kuwait: 13,5 Mrd USD; Saudi-Arabien: 13,5 Mrd USD; Japan: 9 Mrd USD; BRD 5 Mrd USD; Vereinigte Arabische Emirate: 2 Mrd USD; Südkorea: 305 Mio USD.
In der SU läuft morgen die Abstimmung über den Erhalt der Union, die als Verbund gleichberechtigter souveräner Republiken (Kasachstan setzt dafür: Staaten) reartikuliert wird. Alle Eigentumsformen, die das Funktionieren eines einheitlichen Unionsmarktes begünstigen, sollen legitim sein.
Bezeichnend die Unterstützung, die aus Kasachstan kommt, der nach Russland flächenmäßig zweitgrößten Republik (2,717 Mio km2, 16,2 Mio Menschen): Ihrer Zusammensetzung nach ein Spiegelbild der Union, würde sie mit dieser zerfallen. Wie derzeit die Tschechoslowakei und Jugoslawien zerfallen, nein, schlimmer, weil dort bei allem Durcheinander doch relativ klare ethnisch-politische Grenzen ziehbar, während im sowjetischen Völkergemisch eine Art Afrikanisierung ausbrechen könnte.
17. März 1991
Im heute zur Abstimmung gestellten Entwurf zu einem neuen Unionsgesetz besagt der 4. Punkt: »Die Republiken betrachten den Aufbau und die Entwicklung einer zivilen Gesellschaft als die wichtigste Voraussetzung für Freiheit und Wohlstand«. – Ja, aber wie verstanden? Lauert unter der zivilen der Wechselbalg der bourgeoisen Gesellschaft?
Erkenntnis, kapitalistisch: »Wir erkennen Sie« heißt in der Bankensprache dasselbe wie »we credit you«, nämlich »wir schreiben Ihnen gut«.
Transnationaler Kapitalismus. – Als globale Produktionsweise schafft er sich eine globale Sprache, weltweit und branchenübergreifend, eigens genormt für Electronic Data Interchange (EDI). Unter Leitung der UNKommission für Europa wurde gemeinsam mit den Normeninstituten von 60 Ländern der Sprachstandard EDIFACT entwickelt (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce & Transport).
Hochtechnologische Produktionsweise. – Mikromechanik als neues Forschungsgebiet. Hier geht es um »Mems« (mikro-elektro-mechanische Systeme), Chips, die nicht nur speichern können, sondern auch »spüren« (Sensoren) und »reagieren« (Mikromaschinen). Oder mechanische Informationsspeicherung mittels mikromechanischer Speicherzellen, bei denen die Wölbung von winzigen Stegen – dünner als ein Haar und tausendfach auf einem Chip angeordnet – die Information darstellt: nach oben = 1, nach unten = 0. Mit elektronischen Komponenten gekoppelt, ergibt das ein Mems. Der Begriff »Maschine« (und die Disziplin des Maschinenbaus) erfährt hier eine Ausdehnung ins Mikroskopische und dadurch einen Verallgemeinerungs- und Abstraktionsschub im Vergleich zur für Marx noch dominanten Werkzeugmaschine. Entwickelt werden »Mikroaktoren« – Zahnräder, Getriebe, Mikromotoren und -turbinen –, deren Funktionieren sich nur unterm Mikroskop beobachten lässt. Die Methoden der Fertigung aus dünnen Materialschichten ähneln z.T. denen der Chip-Produktion. Die Anwendung wird dadurch gekennzeichnet sein, dass sich ungeheure Mengen solcher Mikromaschinen auf engem Raum unterbringen lassen: Hunderte pro Chip, von denen wiederum hundert auf einem Silizium-Wafer Platz finden. Werkstoffe und ihre mechanischen Eigenschaften sind in diesem Bereich noch zu erforschen. Man kennt noch keine metallurgischen Rezepte für Werkstoffhärtung in Mikrodimensionen. Wiederum erfordert das eine Revolutionierung der Messtechnik, zugleich der Klimatisierung von Räumen. – In Berlin arbeitet das Fraunhofer Institut für Mikroelektronik an solchen Technologien. (E. Arzt: »Motor und Chip in einem. Neue Horizonte für High-Tech-Materialien in der Mikromechanik«, FAZ, 12.3.)
*
Kathrin A. schreibt aus Leipzig von der Angst der vielfachen Ungewissheit, Angst der Chancenlosigkeit, aber auch Angst der hinterrücks verändernden Macht der Chancen. In ihrer Umgebung hektische Suche nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen, mit der Vorstellung, sich dann die jetzigen Ideale weiter leisten zu können. Ihr Freund hat sein Studium nach vier Jahren abgebrochen, um sich in Herford bei der Commerzbank zum Geschäftsstellenleiter ausbilden zu lassen. Nach acht Wochen wird sie ihn zu Ostern erstmals wiedersehen, und sie fragt sich, ob sie ihn dann wiedererkennt. Er hat ein kritisches Bewusstsein, aber wird er nicht seine Zweifel verdrängen müssen, um voranzukommen? Und in drei Jahren wäre er Filialleiter einer Bank und seine Frau marxistische Pädagogikdoktorin. »Ich weiß nicht, ob wir das können.«
In Tönen der inneren Vergewisserung, die merkwürdig abstechen von dieser Existenzangst, spricht Kathrin, wo sie von ihren Fortschritten im Russischstudium schreibt, das sie in ein paar Monaten abzuschließen hofft: »Nach 10 Jahren Russischunterricht und einigen Reisen in die SU ist es ein schönes Gefühl, die Sprache nun richtig zu lernen. Ich fühle mich wie zuhause, auch wenn die gefühlsmäßige Bindung an dieses Land verschwommen ist. Sich für diese Sprache, diese Menschen, die Geschichte dieses Landes zu interessieren und sich damit nun intensiv zu beschäftigen, ist wie die Erfüllung eines Vermächtnisses. Das Beste und Schönste meines bisherigen Lebens nehme ich mit in die neue Zeit. Ein Teil meines Inneren festigt sich und wird mir immer erhalten bleiben. Wenn das Studium auch hart ist, beruhigt es mich, es gibt mir innere Festigkeit.« Dieser innere Halt jetzt von größter Bedeutung.
Kathrin ist es gelungen, das Thema ihrer Diplomarbeit bei den Pädagogen unterzubringen: »Massenkultur, Massenmedien und Kommunikation in den gesellschaftstheoretischen Auffassungen W. F. Haugs«. Freilich ist unsicher, ob der Antrag auf »Forschungsstudium« genehmigt wird, ob der Betreuer dann noch arbeiten darf und ob die Hochschule in den nächsten Jahren überhaupt noch existiert. Deshalb hat sich K. parallel bei der Lufthansa um eine Ausbildungsstelle als Stewardess beworben, ja sogar als Pilotin. »Also wenn nicht alles schiefgeht, vergrabe ich mich ab Oktober in Büchern oder gehe in die Luft. Den Sommer will ich in den USA verbringen«. – Hoffnungen zwischen Stewardess und marxistischer Pädagogikdoktorin! So werden wohl jetzt zwei Generationen in eine ungeheuerliche Mobilität in jeder Hinsicht geschleudert, weil ja auch Ehen und Kinder mit auf dem Spiel stehen. Eine fast ekstatische Wiedergewinnung von Zukunft nach der nostalgischen Zukunftslosigkeit vom vergangenen Oktober schildert Kathrin in Gestalt einer Parisreise zu Sylvester: »Ich habe mich (obwohl ich kein Französisch kann) sofort heimisch gefühlt. Als ich im Musée d’Orsay vor ›meinem‹ Cézanne und vor ›meinem‹ van Gogh, nun allerdings vor den Originalen, stand und als ich ›meine‹ Montmartretreppen runter- und wieder raufstieg, wusste ich nicht, ob ich schwebte oder fiel und fiel. Ich hab’ getanzt, gelacht und geheult zugleich. Zum ersten Mal habe ich gefühlt, dass MIR nun die Welt offensteht. Es war wie eine Befreiung.«
Die Rezension meines »Perestrojka-Journals« im ND hat K. übrigens so verstanden, dass das Buch »jetzt auch hier erscheint«. Da spricht noch die alte DDR.
18. März 1991
Bei einer Tagung des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft sagte der Vorstandsvorsitzende der Asia Brown Boveri, Eberhard von Koerber, es sei wichtiger, »Arbeitsplätze zu erhalten, als im Eiltempo in Ostdeutschland eine lupenreine Marktwirtschaft einzuführen«. Er scheint an befristete Schutzzölle zu denken. Anlass des Treffens war der »Zusammenbruch« der Ostmärkte.
Auf dem Binnenmarkt selbst bei Fahrrädern die übliche Verlagerung von Produktion (und Arbeitsplätzen) von Ost- nach Westdeutschland: in der DDR 300 000 Räder weniger, in der BRD 300 000 mehr, dazu ging die gesamte Produktionssteigerung von 100 000 Rädern an den Westen, wo also unterm Strich ein Zuwachs von 400 000 herausgekommen ist.
19. März 1991
In der SU zeichnet sich eine Zweidrittelmehrheit für den neuen Unionsvertrag ab. In »Sowjetunion heute« lese ich einen Hinweis darauf, dass die Einheit der USA Ergebnis eines Bürgerkriegs war.
Karl Otto Pöhl (Bundesbank) hat die Währungsunion vor einem EGGremium heute als katastrophal eingeschätzt. Die BBC berichtete es voller Genugtuung. Ebenso, dass in Leipzig gestern eine Montagsdemo gegen die Ruinierung der vormaligen DDR-Wirtschaft stattgefunden hat. Die ARD-Nachrichten enthielten uns beides vor. Immerhin bekam man etwas mit von einer Demonstration in Leuna, wo der IG Chemie-Vorsitzende »Rechtsideologen« bezichtigte, auf Kosten der Arbeitsplätze den Übergang zur Marktwirtschaft »übers Knie zu brechen«.
In den USA ist der Energie-Erzeugerpreis im Februar (also während des Ölkriegs) um 0,1 Prozent zurückgegangen. Jetzt steigt und steigt der Dollarkurs. Scheint mir logisch, weil die Kriegskontributionen, die kuweitischen Lohnaufträge an die US-Armee und Saudi-Arabiens Waffenkäufe die Dollarnachfrage um rund hundert Milliarden in die Höhe getrieben haben müssen.
Morgen soll Band 1 unserer Gramsci-Ausgabe ausgeliefert werden, und gestern realisierte ich, dass der Vertrag, den Georg Stenzaly mir geschickt hat, keine Unterschriften trägt. Im Brief versucht er, diesen Tatbestand bauernschlau zu verstecken, liefert aber zugleich andeutungsweise die Gedanken, die in seinem Kopf vorgegangen sind: Gramsci schon 50 Jahre tot, also die Rechte frei verfügbar.
Rundbrief. – Liebe Freundinnen und Freunde, seit Monaten (oder sind es Jahre?) fange ich die meisten Briefe (falls ich zum Schreiben komme) mit einer Entschuldigung an. Als Ein-Person-Betrieb (auch an der FU), der neben Lehre und Forschung auch noch einige Projekte mit-betreibt (Gramsci, die Volksuniversität, Philosophie im deutschen Faschismus, dazu ein Kooperationsprojekt mit der IG Metall und ein »Antiken-Projekt«), bricht mein Zeithaushalt spätestens immer dann zusammen, wenn ich mich in Schreibklausur begebe, um ein Buch fertigzustellen. Dann bleiben Briefe monatelang liegen, die freundlichsten Einladungen unbeantwortet. Übrigens geht es Frigga, zu deren Projekten die Frauenkrimireihe hinzugekommen ist, nicht anders; wie in meinem Zimmer gibt es auch im ihrigen drückende Schichten aus unbeantworteter Korrespondenz. Eigentlich bräuchten wir ein »Privatsekretariat«, wenn dieser Schuldenberg nicht immer weiter anwachsen soll. Aber das ist Zukunftsmusik. Es bleibt nichts anderes übrig, als dass wir uns bei denen, die wir versetzt haben, entschuldigen. Es gibt mildernde Umstände:
In den letzten drei Jahren bin ich in eine atemlose Produktionsdynamik gerissen worden. Es fing mit der Studie über die Perestrojka an (1987–89), die, kaum veröffentlicht, schon von der Krise der Perestrojka überholt schien. So begann ich im Juni 1989 das »Perestrojka-Journal«, wodurch der Zusammenbruch der DDR mich schließlich unvermutet in dessen Chronisten verwandelt hat, der, obwohl von der dort herrschenden Ideologie negiert, selber keineswegs alles an der DDR negiert hatte und nun sein Denken und alle bisherigen Überzeugungen seines Milieus radikal in Frage stellen lassen musste. Parallel zu diesem politischen Tagebuch erschienen die »Wahrnehmungs-Versuche«. Im Sommer 1990 ließ ich mich sogar verführen, als Pressekorrespondent zum 28. Parteikongress der KPdSU zu fahren.
Wenn die Verhältnisse plötzlich in Bewegung geraten, wenn nach langen und langsamen tektonischen Verschiebungen das große Erdbeben geschieht, dann ist es unmöglich, geruhsam und schonlich zu handeln. Es herrscht ein Ausnahmezustand, der die Lebensweise verändert. So ging es uns 1989/90. Jetzt ist, um ein anderes Bild zu nehmen, die Lawine ins Tal gerauscht; auch wenn Trümmer umherliegen und neue Not wächst, ist doch die relative Ruhe einer gewöhnlicheren Gangart wieder eingekehrt.
Ende 1989/Anfang 1990 habe ich zusammen mit dem Leipziger Romanisten Klaus Bochmann und dem Ostberliner Übersetzer Joachim Meinert, dazu aus Westberlin mit Pit Jehle und Leonie Schröder, eine neue Arbeit angefangen: die kritische Gesamtausgabe von Gramscis Gefängnisheften ins Deutsche zu übersetzen. Dieser Tage erscheint der erste Band, im Herbst der zweite. Einschließlich eines Registerbandes werden es zehn Bände, und wir werden, falls wir sehr gut arbeiten, Ende 1995 damit fertig sein. Die Übersetzergruppe, zu der Ruedi Graf und Gerhard Kuck gestoßen sind, veranstaltet Intensivseminare, wo Probleme besprochen und die Standards und Kriterien vereinheitlicht werden. Jede Übersetzung wird gegenlektoriert, dann wird der Gesamttext vom Bandherausgeber ein drittes Mal durchgearbeitet und schließlich von der Gruppe noch einmal von vorne bis hinten Korrektur gelesen. Ihr seht, wir sparen keine Mühe. Natürlich wollen wir eine möglichst eng am Original sich haltende Übersetzung machen, die keine Unebenheit ausbügelt.