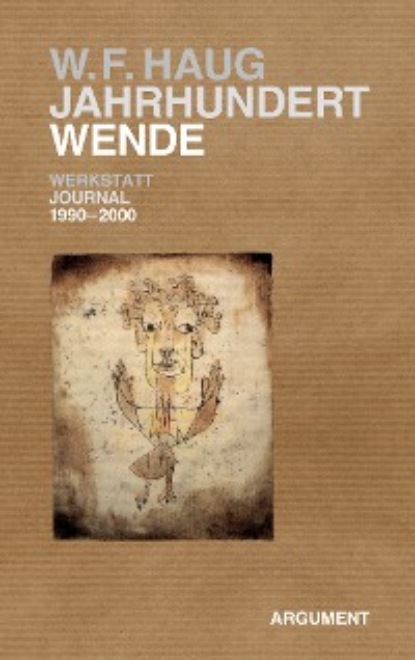- -
- 100%
- +
Nachdem ich seit 1988, wegen der Arbeit an dem Gorbatschow-Buch, unser anderes Großprojekt, das Neue Wörterbuch des Marxismus, etwas stiefmütterlich behandelt hatte, nicht nur wegen der Zeitökonomie, sondern auch wegen der stürmischen Veränderung der Verhältnisse im »Weltmarxismus«, wende ich diesem Projekt nun wieder einen erheblichen Teil meiner Arbeitskraft zu. Ich nutze dafür mein Forschungssemester. Wer sich an die Gründungsbedingungen des Projekts erinnert – Boykott durch DKP, DDR, ML, das Ausweichen ins Internationale etc. –, der wird verstehen, dass dieses Projekt nach dem Zusammenbruch der DDR umzubauen war. Nicht nur müssen die neuen Erfahrungen verarbeitet werden, nicht nur hat sich unsere Perspektive geändert, nachdem eine ganze Formation historisch geworden ist, sondern auch das marxistische theoretische »Personal« hat sich verändert. Das lässt sich an der Wörterbuchredaktion ablesen, zu der inzwischen drei Redakteure aus der vormaligen DDR gestoßen sind. Dem Projekt sind zusätzliche Aufgaben zugewachsen, an wissenschaftlicher Kommunikation und Erneuerung in der marxistischen »scientific community« mitzuwirken. Das Projekt wird uns zweifellos bis zum Jahr 2000 beschäftigen, aber wir sind entschlossen, den ersten Band (A bis G) tatsächlich zum Jahresende 1991 zu schaffen. Manche Autoren haben Mühe, an solche Versicherungen zu glauben, weil wir ähnliches schon vor dem großen Umbruch im Osten gesagt hatten. Ich hoffe, sie werden meine Ernsthaftigkeit an den inzwischen vorgelegten Arbeiten ablesen und die Chance begreifen, die der Aufschub geboten hat. Anders hätten wir ein inzwischen bereits veraltetes Werk vorgelegt.
So viel über die allgemeinen Projekte, an denen ich mitarbeite. Dazu kommt die Fertigstellung von Band 3 des Pluralen Marxismus, einem Ketzerwerk, dem inzwischen die orthodoxe Inquisition abhanden gekommen ist, dessen Funktion (und daher auch dessen Inhalt) ich völlig neu überlegen muss. Ferner steht die Neuauflage meines Sartre-Buchs von 1966 an.
Ich weiß, das alles sieht nach individual overstrech & overstress eines Menschen aus, der einen voluntaristischen Schlag hat und so unweise ist, Glücksgüter und -haltungen dem zu opfern, was er als Aufgabe ansieht.
20. März 1991
Xenophon, Anabasis VII, 4.7: im griechischen Expeditionsheer Päderastie normal, heißt es. Aber waren dort Knaben mit? Wenn nein, etwas anderes. Die »meisten Forscher« seien sich darin einig, »dass die männliche Liebe dem Ethos der Kriegergemeinschaft entsprang« (46). – Basiert z.T. auf H. J. Marrou, Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum (1977). Marrou erklärt: »Die griechische Homosexualität ist militärischen Charakters.« (75)
21. März 1991
In der SU endlich wieder Politik erkennbar. Mit der Dreiviertelmehrheit für die Beibehaltung der Union im Rücken verkündete Gorbatschow den ersten Akt der Preisreform. Er hat dafür die Zustimmung aller Republiken (außer den baltischen) gewonnen, auch wenn Jelzin nur seinen Stellvertreter unterschreiben ließ, um aus einem eventuellen Misserfolg Kapital schlagen zu können. Es läuft so, wie Gorbatschow es immer angestrebt hat: die staatlichen Subventionen werden zurückgenommen, was den »Gesamtpreis« um die gleiche Summe hochtreibt, und die freiwerdenden Mittel werden (zu 85 Prozent) auf die Löhne draufgeschlagen. Theoretisch gesehen, müssten jetzt die Marktmechanismen volkswirtschaftlich sinnvoll wirken. Was den Widerstand gegen die Preiserhöhungen angeht, der noch vor einem Jahr das Programm von Ryschkow im Vorfeld zum Scheitern gebracht hat, so scheint er zermürbt zu sein durch die Krise. Preiserhöhungen verlieren ihren Schrecken angesichts des größeren Schreckens, dass es zu regulären Preisen fast nichts mehr zu kaufen gibt und am Schwarzmarkt eh horrende Preise verlangt werden. Auch könnte es sein, dass sich Widerstand verzettelt und erschöpft hat. Der Streik der Bergarbeiter muss also nicht zum Generalstreik werden, sondern könnte die Form werden, in der die Gesellschaft diffus seine ›Sinnlosigkeit‹ realisiert.
Im DDR-Gebiet wird laut Sachverständigenrat »der Aufschwung« vorerst ausbleiben, der Zusammenbruch noch weitergehen. Vom Bausektor strahlen keine Konjunktureffekte aus. Auch wird jetzt vom verschlechterten Umfeld (Weltrezession) gesprochen.
22. März 1991, Gramsci-Colloquium im Haus am Köllnischen Park
Schwäche und Stärke meiner Kommunikationsweise sind zwei Seiten einer Medaille: esoterisch mit einer Fassade, die überaus zugänglich ist. Hält einen Schock bereit.
Bemerke die Tendenz, die Struktur der gramscischen Reflexionen dem Gefängnisdasein zuzuschreiben. Die so reden, haben vermutlich nie geforscht, sonst wüssten sie, dass das, was sie als haftbedingt schildern, zum normalen Prozess wirklicher Forschung, die eine fortgesetzte Anomie ist, gehört. Das ständige Umarbeiten, Umwerfen der Anordnung, die Unordnung, das Sich-Sperren des Materials, das Darüber-Krankwerden, die Schlaflosigkeit, das unabstellbare Zwangsdenken usw.
Joe Buttigieg hat recht, wenn er annimmt, dass die meisten, die Gramsci im Munde führen, einfach zu faul sind, um sich sein Denken wirklich anzueignen. Der Mangel an kritischer Strenge, sagt er, hat die intellektuellen Milieus der Linken erreicht. Lorianismus bedeutet billiges Denken, das die Schleusen öffnet. Gramsci spürte darin eine der Vorbedingungen des Faschismus.
Gramscis Methode ist arbeitsaufwendig.
Frank Deppe befürchtet jetzt vor allem, dass Begriffe wie »Zivilgesellschaft« als eine black box fungieren, in die alles aus den theoretischen Traditionen der Arbeiterbewegung Mitzunehmende hineinprojiziert wird. Man müsse viele Linien nebeneinander berücksichtigen. Er hat recht und unrecht, denn er gewichtet noch zu wenig die Beispiellosigkeit der Arbeitsweise der Gefängnishefte und neigt dazu, deren Besonderheit in Gramsci als solchem aufzulösen.
Nach einer ärztlichen Visite bei Gramsci verlangte der Arzt, man möge ihn einen Blick auf die Hefte werfen lassen. Die Folge von anscheinend unverbundenen Paragraphen mit wechselnden Themen durchblätternd kam er zur Diagnose, dieser Gefangene müsse ein Psychotiker sein.
Gramscis Verteidigung vor Gericht basierte darauf, seine Parteiführerschaft zu bestreiten. Da schrieb Grieco einen hymnischen Brief, worin er Gramsci zum größten Parteiführer hochlobte. Das machte Gramsci zum Märtyrer, was dieser nie sein wollte. Eine Falle.
Kuno Füssel sprach vom Hilflosen Atheismus der alten DDR, die den Atheismus zur Staatsreligion erhob und zum Erziehungsziel machte und die Zivilgesellschaft ins Privatleben einsperrte. Im Anschluss daran parallelisierte Jan Rehmann Gramscis Ökonomismuskritik und Marx’ Religionskritik. Der Vergleich knirscht.
*
Zivilgesellschaft. – Eine marxistische Sozialistin widmete 1901 ihre römische Antrittsvorlesung der Zivilgesellschaft: Teresa Labriola, Tochter Antonios, sprach sich dagegen aus, die Bildung der Zivilgesellschaft in die Zukunft zu verlegen. Geregelte Solidargemeinschaft.
Zweidrittelgesellschaft. – Gewohnt, fürs untere Drittel zu sprechen, vergisst die Linke leicht, dass es darauf ankommt, einen Block zusammenzubringen, der die besser situierten Zweidrittel spaltet und einen erheblichen Teil davon mit dem unteren Drittel zusammenschließt.
Peter Glotz: von der Nomenklatura zur Prokura.
23. März 1991
Anne Showstack-Sassoon reagierte abwehrend, als ich ihr beim Gramsci-Colloquium vom neuen Elend in der vormaligen DDR erzählte. Sie verteidigte ihre Freudentränen, die sie sich vorm Bildschirm hatte machen lassen.
Der Dietz-Verlag hat der Redaktion von »Utopie kreativ« zu Ende Juni gekündigt. Die Treuhand hat alle Stiftungen der PDS eingefroren.
Lexikalische Neuzugänge. – Abwicklung, Evaluierung, Nullarbeitszeit, Treuhand, Warteschleife.
Mit Kathrin A. vereinbart, dass sie ein paar Tage an der Fertigstellung des Sartre-Buchs (Neuauflage) mitarbeitet. Etwas wie Angst in ihrer Stimme.
24. März 1991
Wie ein Vogel im Käfig flattern die Wünsche, die meine Seele sind, in meinem eingespannten Leben. Bevor er tot zu Boden fällt, wird er die Tür offen sehen. Kaum mehr Leben vor mir, gemessen an den stürmischen Verlangen. Von der Tagung bleibt mir jenes spitzbübische Mädchen Franziska im Kopf, wie ein Lichtbild in einer Welt des Mangels. Fata Morgana, wechselnd zwischen Kind und Geliebter.
25. März 1991
In Leipzig die größte Montagsdemo seit jenem Herbst 89. Auf dem berliner Alex dito. »Wohlstandslüge, Wahllüge, Hauptstadtlüge«, die Losungen in die drei Farbfelder der bundesdeutschen Fahne geschrieben. Wechseln Symbole die Front? Die Zusammenrottung der Übelstände, deren leicht fassliche Artikulation wird für die Regierung gefährlich. Wie Schaum auf der Woge die rasche Forderung des künftigen SPDVorsitzenden nach Neuwahlen. In Leipzig forderte der IG Metall-Chef Steinkühler den Vorrang der Sanierung vor der Privatisierung. Die Krise in Ostdeutschland noch vor ihrem Tiefpunkt. Zugleich gehen die Auftragsbestände der westdeutschen Industrie zurück, weil die Auslandsbestellungen. Der Dollar auf Rekordstand, man schreibt dies der ostdeutschen Krise zu. Die Börse geht nach unten.
Der Anschluss der DDR hat der alten Bundesrepublik (im letzten Quartal 90) fast 5 Prozent Wachstum gebracht bei einem Beschäftigungsstand, der um 886 000 über dem Vorjahresniveau lag (dass die Arbeitslosen nur um 220 000 abgenommen haben, spiegelt die Zuwanderung). All das bei Rückgang der Auslandsnachfrage. Stärkstes Wachstum bei den »Ausrüstungsinvestitionen« (11,9 Prozent).
*
Im ND-Gespräch, das Brigitte Hering mit Harald Neubert und mir heute geführt hat, nutzte Neubert mich zur Selbstrehabilitierung. Dieser Vorruheständler, dessen Persönlichkeit immer unverwechselbare Funktionärsfarbe tragen wird, jenes spezifische DDR-Grau, hat sich mit seiner Treue zur Sache dennoch Umtriebigkeit bewahrt. Ihn rettet, dass er mit Kontakten zur italienischen KP befasst war, daher u.a. auch Gramsci kannte, was alles relativ zur ML-Orthodoxie als ungeheuer ketzerisch galt.
Horizontale Kontakte scheinen im SED-Apparat ein Schattendasein geführt zu haben. Neubert schildert die Wandlitz-Nomenklatura als nicht mit einander kommunizierend: es hätte als Fraktionsbildung verstanden werden können. Noch heute sollen sie isoliert und beleidigt in ihren Wohnungen sitzen und nicht einmal Telefonnummern voneinander haben. Otto Reinhold habe die Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED zwar vor unliebsamen Einmischungen abgeschirmt, deren Kader jedoch nie anders denn als seine Unteroffiziere behandelt.
Brigitte Hering erzählte, beim ND sei es erst richtig schlimm geworden, nachdem Günter Schabowski den Usus eingeführt hatte, alle Artikel vorher bei Günter Mittag einzureichen. Sie meint, Kurt Hager sei entmachtet gewesen. Aber Neubert sagt, Hermann Axen habe bis zuletzt Angst vor Hager gehabt. Axen, fett und klein von Statur, war nicht dumm, aber feige.
Jürgen Kuczynski soll eine schlimme Rolle gespielt haben, als die Kybernetik entlarvt und die sich abzeichnende wissenschaftlich-technische Revolution geleugnet wurde. Er soll Ulbricht und später Honecker mit Zahlen beruhigt haben, von einer technologischen Revolution könne noch lange überhaupt keine Rede sein. Obwohl ich den alten ›Kutsch‹ mag, kann ich mir das vorstellen. Erinnere mich, wie FH in ihren ersten Auseinandersetzungen als Automationsforscherin auch auf Kuczynskis Leugnung der Möglichkeit von Automation im faulenden Kapitalismus stieß – und zwar stieß wie gegen eine Rezeptions-Barriere, denn die westlichen Nachplapperer der DDR machten sich derlei sogleich zu eigen und entlarvten alles, was dem widersprach.
Wie aus einem Königsdrama, wenngleich aus der Materie kleiner Leute: Als Honecker seinen Glückstraum erlebte, jenen Fackelzug der Zehntausende, die winkenden Jugendlichen, die am 40. Jahrestag der Republik an ihm vorbeizogen, da erlebte er den Vorabend seines Sturzes. Der Triumph ging mit dem Untergang schwanger. Kann für jeden gelten, mutatis mutandis.
26. März 1991
Traf mich mit Jens-Uwe Heuer, Jahrgang 1927, Akademiemitglied, Jurist, jetzt Bundestagsabgeordneter der PDS. Wie in alten Zeiten war das Treffen am Ausgang des Bahnhofs Friedrichstraße verabredet worden. Heuer hat ein vorzügliches Buch über Demokratie geschrieben, das Ende 1989, also nach dem (bzw. mitten im) Umbruch, herausgekommen ist. Das Vorwort datiert vom Mai 89, und das Buch hatte seit 87 fertig beim Verlag gelegen. Es dokumentiert, dass in der Schlussphase der DDR ein ganz neuer Theorietyp herangereift war, der nach Übergang in die Praxis verlangte. Heuer ist ein Wissenschaftler, den es in die Politik verschlagen hat. Er arbeitet mit einem Kollegen an einem Buch über die letzte (freigewählte) Volkskammer. Er zeigt, wie strategisch verhindert worden ist, dass sich die DDR vor dem Anschluss noch als Rechtsstaat rekonstruieren konnte. Sie musste unterhalb der Ebene juristischer Normalität bleiben, um als Konkursmasse behandelt werden zu können. Aufgrund veralteter Unterlagen mache ich einen peinlichen Fehler: gewinne Heuer für den Wörterbuchartikel »Demokratie«, erst später merkend, dass dieser nicht nur vergeben, sondern sogar schon geschrieben ist.
Die Krise zwingt die Regierung zu einem Strategiewechsel, ja sogar teilweise zu einem ideologischen Paradigmenwechsel. Dies ist der Moment der Opposition.
27. März 1991
Michael Zöller (Professor für politische Soziologie und Erwachsenenbildung an der Universität Bayreuth) kriegt in der FAZ eine Seite, um Krieg als Mittel der Politik zu rechtfertigen, ja selbst perspektivisch eine Politik ohne Krieg zur schlechten Utopie zu erklären. Da wird der Sieg im Golfkrieg verarbeitet. Dass Saddam Öl in den Golf hat pumpen lassen, wird den westlichen Kriegsgegnern und Umweltschützern angelastet. Eine bemerkenswerte Tui-Leistung. Im Westen war gefordert worden, zu verhandeln, um Umweltschäden abzuwenden. »Das Umweltmotiv konnte sich im Westen politisch auswirken und brachte deshalb eine propagandistisch einfallsreiche Phantasie auf die Idee, Öl in den Golf zu pumpen. […] So zeigt das Lehrbeispiel, dass die Forderung nach Gewaltverzicht nicht nur das Ziel verfehlt hat, ein höheres Gut, nämlich die Unversehrtheit der Umwelt zu schützen, sondern die bewusste Schädigung der Umwelt erst attraktiv gemacht hat.« – Die Kritik am Videospiel-Charakter der Kriegsberichterstattung des Fernsehens dreht Zöller mit einem anderen Tui-Trick um: Wer die Zurschaustellung der Vernichtungsschläge kritisiere, ästhetisiere den Krieg und klage dessen »Ernsthaftigkeit« ein. In Wahrheit hätten die neuen gezielt einsetzbaren Waffen eine »Humanisierung des Krieges« bewirkt. Damit rehabilitiert Zöller ein altes konservatives Axiom, wonach »Politik und Gewalt oder auch Krieg und Frieden nicht voneinander getrennt werden können, sondern nur verschiedene Aggregatzustände sozialer Beziehungen sind«.
Auf der Leserbriefseite spricht dagegen Herbert Vonach, Professor am Institut für Kernphysik in Wien, von den »Kriegsverbrechen« der USA, deren blindwütige Bombardierung der Städte, vor allem in der letzten Phase, bei Hinauszögern des Waffenstillstands, er mit der Zerstörung Dresdens vergleicht.
29. März 1991, Karfreitag
Einheitseffekte. – Was Westdeutschland gewinnt, verliert Ostdeutschland. Kurz, Westdeutschland gewinnt.
Der Dollar weiter nach oben. Fasziniert betrachtete Arnold Schölzel am Mittwoch immer wieder die Überschrift des FAZ-Börsenberichts: »Montagsdemos treiben den Dollar hoch«. Dass die Art der Wiedervereinigung die Ostdeutschen als die Dummen dastehen lässt, hat die internationale Kreditwürdigkeit der Bundesrepublik erhöht.
Arbeitslosigkeit. – Die französische Ökonomie führt eine für die Epoche typische Bewegung vor: Die Wirtschaft wächst 1,5 Prozent weniger als die Produktivität. Das drückt sich in steigender Arbeitslosigkeit aus (derzeit 9,2 Prozent der aktiven Bevölkerung). Große Unternehmen, darunter der Rüstungs- und der Autobranche, haben Massenentlassungen angekündigt. Heute früh habe ich im Radio gehört, dass IBM vier Prozent seiner Beschäftigten (15 000) entlässt.
Sowjetunion. – Die Unionsregierung belagert von einer Hauptstadtbevölkerung, die gegen sie ist. Gorbatschow hat nicht verloren, aber er hat seit langem die Initiative und fast allen Konsens verloren, mehr noch unterhalb des Konsenses die Tiefendimension des Glaubens an eine Zukunft. Noch unklar, wohin die Preisreform führt. Die Schwarzmarktpreise noch immer das Zehnfache der (hochgesetzten) regulären Preise. Laut FAZ wird der Privatsektor beeinträchtigt durch die Preiserhöhungen, weil er die Löhne anpassen müsse. Heißt das, er hat bisher schon zu Schwarzmarktpreisen produziert?
30. März 1991
Im Radio wird Schewardnadses warnende Empfehlung berichtet, »die beiden sowjetischen Führer« müssten sich arrangieren, weil es sonst keinen Weg gebe. Von wegen Zivilgesellschaft! Da sind zwei Führer wie Naturtatsachen, um sie herum muss das Land sich bauen. Zufällig übersetze ich gerade § 75 aus dem zweiten der Gefängnishefte. Einen Artikel Robert Michels’ lesend, der sich auf Max Weber stützt, beschäftigt sich Gramsci dort mit charismatischen Führern und jenem Typ von Parteiung, der um sie herum aufgebaut wird. Nach Gramscis Einsicht »fällt das sogenannte ›Charisma‹ im Sinne von Michels in der modernen Welt immer mit einer primitiven Phase der Massenparteien zusammen, mit der Phase, in der die Doktrin sich den Massen als etwas Nebulöses und Inkohärentes darstellt«. Gramsci schreibt das Nebulöse mit Blick auf die faschistische Partei der Tatsache zu, dass hier eine absterbende Klasse sich mit vergangenem Ruhm bewusstlos gegen die Zukunft abschirmen will. Gorbatschow führt die rationale Programmpartei, Jelzin verschafft jenem glühenden Nebel Ausdruck, der den Bürgerkrieg birgt. Launisch, wechselnd, intensiv und unklar folgt er dem kleinsten gemeinsamen Nenner der Unzufriedenheit, um deren desartikulierenden Strahl just immer dorthin zu bündeln, wo Gorbatschow an der Rahmenkonstruktion der Zivilgesellschaft und eines ihr dienenden Staates arbeitet.
In der Wochenendbeilage der FAZ ein hintergründiger Erlebnisbericht von Sonja Margolina über eine riesige Demonstration gegen Gorbatschow und für Jelzin. Sonderbare Perspektive, die den Phänomenen mit einem Ja begegnet, in dem sie sich fangen und verlieren wie in einer Falle. Und sonderbare Kategorien. So die des Ästhetischen: »Gorbatschow […] hat die Ästhetik des letzten Schritts der Rettung des Imperiums und dem Machterhalt geopfert, nun verliert er wohl beides.« Die Demonstration schildert die Margolina als einen Karneval, den vor allem die 50 bis 55-Jährigen betreiben und dem vor dem orgiastischen Höhepunkt die Luft ausgeht. Sie schildert sie als zum Absterben verurteilte Klasse, die bewusstlos am eigenen Untergang arbeitet: »Die Menschen sind überwiegend gut gekleidet: in Pelz, Lamm-Mänteln und schicken Mützen. Es sind keineswegs arme Leute, die ungeachtet der Wirtschaftskrise über ihre Verhältnisse leben. Sie sagen ›nein‹, aber ahnen nicht, was auf sie zukommt. Sie haben das Wort ›Abwicklung‹ noch nicht gehört und können sich kaum vorstellen, dass ihre tollen Pelze vielleicht die letzte Pracht in ihrem Leben bleiben werden. In Moskau, der Residenzstadt, ist die Hälfte der Berufstätigen einfach überflüssig – ein offenes Geheimnis. Doch man kann es sich kaum vorstellen. Würden sie hierherkommen, wenn sie durchschauen würden, welches Schicksal ihnen Jelzins Programm der Privatisierung bereiten wird? ›Freiheit‹ – rufen sie. Freiheit von der Arbeit, vom gewohnten sozialen Status, Freiheit für die anderen – die Jungen, Arroganten, Schlauen, die an ihre Stelle treten werden.«
Die Jungen schildert sie als konformistisch, darauf bedacht, für sich etwas aus der Gesellschaft herauszuschlagen. »Von kleinen Randgruppen abgesehen, ist die heutige Jugend politisch indifferent und infantil.«
31. März 1991
Aggressive Naivität. – Schirrmachers Leichtigkeit kommt mir vor wie die Folge einer Gewissenlosigkeit, seine schnelle Intelligenz wie die Folge einer Abwendung. Sein Artikel über Andrej Sacharows Memoiren (in der Literaturbeilage der FAZ vom 25.3.) geradezu »amerikanisch« in seiner aggressiven Naivität. Selbstverständlicher Standpunkt der Sieger als der Guten. Die Macht im eigenen Rücken unsichtbar haltend, zeigt er die böse Macht stets beim Andern (hier Sowjetrusslands). Schönreden der »Dissidenz« von einem, dem sie nie in den Sinn kommt. Die Macht, der er dient, ist nicht besser, nur besser funktionierend. Mir scheint fast, er glaubt an das Reich des Bösen. Sollte er das tun, wäre er böse.
In derselben Literaturbeilage feiert Rüdiger Bubner den »intellektuellen Patriotismus« Manfred Riedels und macht den »Verfassungspatriotismus« madig, weil dieser die Nation verfehle. Daneben beweihräuchert Mattenklott Enzensbergers manieristische Absagelyrik.
Das Erstaunlichste ein langer und aufwendig geschriebener Artikel von Gustav Seibt über den Historiker Ernst Kantorowicz und dessen zwei Leben, da er nach der Auswanderung 1933 sich eine neue Wissenschaftlerkarriere in den USA aufgebaut hat. Seibt beschreibt mit beflissener Lust dessen georgeschen Hymnus auf den Staufenkaiser Friedrich II. (ein Buch von 1927, das Hitler mehrfach gelesen haben soll und das Goebbels Mussolini geschenkt hat). Es ist hochgradig fiktional in seiner Beseitigung aller Kontingenz (der Held ist stets und in jedem Detail wesentlich) oder etwa in seiner imaginären homoerotischen Wunscherfüllung einer »bis ins Alter knabenhaften«, aber desto männlicheren Körperlichkeit. Rudolf Borchardt hat das 1930 als »Umfälschung der Weltgeschichte auf Georges Posen« verspottet, die zeigen wolle, »wie George als Hannibal die Schlacht bei Cannae schlägt, während George als Scipio bei Zama den Punier abtut und dann als Cäsar ostwärts und als Ariovist westwärts den Rhein überschreitet« usw. Dreißig Jahre später dann geradezu das Gegenbuch, das just das Fiktionale in der Geschichte behandelt: Die zwei Körper des Königs. Seibts Lob unecht, weil das Lobenwollen durchlugt. Kantorowicz ist eben Jude. Hat zudem den Deutschen das Allerheiligste bereitet, den Kyffhäuser, danach sogar noch amerikanische Ehren auf sich gehäuft. So einer muss heimgeholt werden. Hier kann man studieren, wie das Pantheon erneuert wird.
1. April 1991, Ostermontag
Detlev Rohwedder, der Präsident der »Treuhand«, erklärt »eine reinrassige, gedanklich saubere und schnörkellose Marktwirtschaft« in der vormaligen DDR für undenkbar. Er sagt von sich, »aus einem gewissen patriotischen Eros heraus« die Stelle angenommen zu haben.
3. April 1991
Die RAF betreibt geradezu chirurgische Kriegsführung in der symbolischen Ordnung von Staat und Wirtschaft. Nun den Chef der »Treuhand«, auf die sich unser aller Aggressionen gerichtet hatten. Auf teuflische Weise erfüllt sie unbewusste kindische Wünsche. So verhindert sie deren politische Reifung. Rohwedder hat zur Mannschaft von Helmut Schmidt gehört. Sozial-Technokrat, Sanierer, nicht Privatisierer.
4. April 1991
Kathrin A. ist gespalten: Eine Hälfte von ihr trauert der untergegangenen Perspektive nach, »Staatskundelehrerin« der DDR zu werden. Eigentlich eine abscheuliche Vorstellung. Auf mich als Thema ist sie von einem Dozenten angesetzt worden, der sich inzwischen vom Marxismus abgewandt hat. Nun könnte es sein, dass sie über ihr Zufallsobjekt an diesem hängen bleibt.
In der FAZ zeichnet Reißmüller das Bild von einer »grotesken Rück-Wende« Gorbatschows. Bei den Leuten wachse das Verlangen nach Ruhe und Ordnung, Politikmüdigkeit, Überdruss an Demokratie und Öffentlichkeit. Gegen den »Gorbatschowismus im Westen, der sich zusammensetzt aus Unterwürfigkeit, Lust an albernem Personenkult und einem verständlichen Bedürfnis, zu vertrauen und Hoffnungen zu hegen«. Was Reißmüller an G stört: »Seine sozialistischen Anschauungen (wahrscheinlich mehr Gefühle), die früher abblätterten, festigen sich wieder.« Immerhin lässt er auch eine Spur der Notwendigkeit sozialistischer Politik sehen: Bei dominanter Privatisierung käme es zu einer gigantischen, zig Millionen erfassenden »Massenarbeitslosigkeit, die sozial abzufedern der Sowjetstaat kaum imstande wäre«.