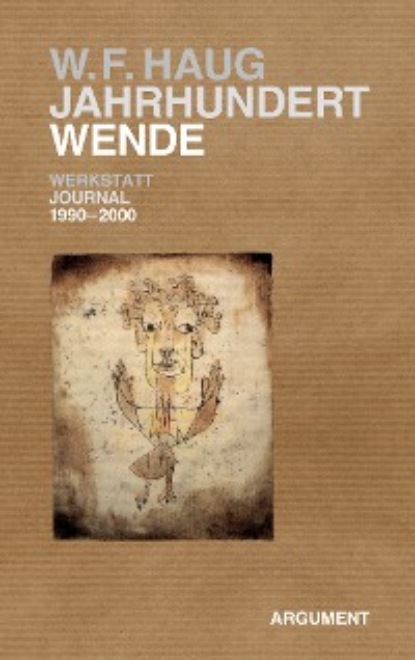- -
- 100%
- +
In Leningrad haben Jugendorganisationen – darunter Anarchisten, aber auch der Komsomol – einen Block der Linkskräfte gegründet. Die Erklärung sagt: Die Wirtschaftskrise führe zur massenhaften Enttäuschung an der Demokratisierung und folglich zur Möglichkeit der Wiederherstellung des staatlichen Autoritarismus. Deshalb müssten alle Kräfte sich sammeln, die an Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und Humanismus festhalten.
Der Oberste Sowjet und die Regierung Estlands haben ein Treffen ehemaliger estnischer SS-Angehöriger verboten.
Usw. usf.
6. Juli 1990
Der APN-Fernschreiber im Pressezentrum gibt nur fragmentarisch-rätselhafte Eindrücke von der Debatte zur Wirtschaftsumgestaltung. Abalkin will anscheinend Marktwirtschaft-sans-phrase.
Alexej Sergejew, Professor an der Gewerkschaftshochschule, polemisiert scharf gegen die zwei Linien: die »konservative« der Regierung und die bürgerlich-reaktionäre, die »höchst sonderbar« selbst »auf den höchsten Parteiebenen als linksorientiert und demokratisch bezeichnet wird«. APN unterschlägt, wie er diese zweite Linie charakterisiert. Die erste resultierte im »langsamen und schwierigen Hinabgleiten […] zu einer Gesellschaftsordnung der ökonomischen Ungleichheit«. Die zweite setzt an am faktischen »Bündnis zwischen der Schattenwirtschaft – den bislang noch illegalen Kapitalisten – und den Resten des voluntaristischen und bürokratischen Systems, die sich an ihre Machtpositionen klammern«. Beide »verheißen den Volksmassen nichts Gutes […]. Die UdSSR würde […] praktisch zu einer Halbkolonie von höher entwickelten kapitalistischen Ländern und danach würde sie sich schnell aus einem Bettler in einen ausgeplünderten Bettler verwandeln.« Die Warnung ist klar. Rätselhaft das Fragment, das sie ihm (des Einklangs mit der Marktpolitik wegen, denke ich) zugestehen: »Die einzige wissenschaftlich fundierte Verhaltensweise […] besteht darin, sich auf den Prozess der Vergesellschaftung der materiellen Produktion zu stützen, der sich in der gesamten Weltwirtschaft objektiv entfaltet.«
Alexander Busgalin, Vertreter der »Marxistischen Plattform«, bejaht die Entstaatlichung des Eigentums und die Entbürokratisierung der Wirtschaftslenkung, widersetzt sich jedoch dem Verkauf der Betriebe an Privatpersonen. Er plädiert für »Eigenständigkeit der Arbeitskollektive und ihre reale Selbstverwaltung«, »Vertragsbeziehungen zwischen Zentrum, Produzenten und Verbrauchern« und »demokratisch ausgearbeitete langfristige Zielprogramme zu einer strukturellen Umgestaltung […]. Das ist der Weg zur Wiederherstellung des gesellschaftlichen Eigentums«.
Die These, die KPdSU solle sich als »Partei des gesamten Volkes« verstehen, wurde von vielen Rednern angegriffen. »Arbeiter und Bauern und alle Werktätigen«, war ihre Gegenformel.
7. Juli 1990
W. Schostakowski behauptet, die Formel »Partei des ganzen Volkes« sei von den Theoretikern des »entwickelten Sozialismus« verkündet worden. Er verfolgt die Linie nicht zurück zu Stalins »Staat des ganzen Volkes« (war das 1936 in der Verfassung?). Das »ganze Volk« ist allenfalls eine beschwörende Anrufung, die mit populistischer Gewalt gegen alles Dissidente schwanger geht. Schostakowski sieht für die KPdSU die Rolle einer »politischen Vorhut der Gesellschaft, doch ihre Grundlage bildet der Teil der Werktätigen, der einen humanen, demokratischen und auf Selbstverwaltung basierenden Sozialismus anstrebt.« Dass die sozialen Antagonismen der politischen Vertretung des »ganzen Volkes« im Wege stehen, dämmert in dem merkwürdigen und nicht weiter verfolgten Bedenken, die Beziehung auf eine bestimmte soziale Basis würde dazu führen, »dass Kräfte, die andere Interessen vertreten, an Boden gewinnen«. – Den von der KPdSU geförderten Menschentyp nennt er den »Erfüllungsgehilfen«.
Die KPdSU beschäftigt insgesamt 214 000 Personen.
Parteitheoretisch: Der Spalt in einer parlamentarischen Partei, die an der Regierung ist; es regiert ja nicht die Partei, sondern ihre Regierungsvertreter regieren, Vertreter hoch 2 oder hoch 3.
*
In seinem Rechenschaftsbericht sagte Medwedew, das ZK sei nicht länger ein »Ideologie-Ministerium«. – Jakowlew in seinem Bericht: Die Partei der revolutionären Idee zu einer Machtpartei geworden. Jetzt der Zusammenstoß zwischen der »Idee der Volksmacht und der Praxis der Volksunterdrückung«. Die Wende zur Demokratie sei Jahrzehnte zu spät gekommen.
Lew Saikow in seinem Bericht: Die gesamte Militärpolitik des Landes wurde vom Politbüro gesteuert. (Merkwürdig, daneben/darunter noch eine extra Regierung zu halten.) Er sprach von der von ihm geleiteten Sonderkommission, die bis vor kurzem nie erwähnt wurde, wo Außenpolitik und die Repressionsapparate aufeinander abgestimmt wurden, wo außer Schewardnadse und Jakowlew u.a. die Chefs von KGB und Armee saßen. Ihre Haupterrungenschaft war der Rückzug aus Afghanistan und die Beendigung des Kalten Kriegs. – Zu den (einseitigen) Abrüstungsmaßnahmen gehört die Öffentlichkeit von vielem, was bislang der Geheimhaltung unterlag.
Das Problem beim Übergang zur parlamentarischen Daseinsform der KPdSU ist, dass sie nicht mit Mehrheiten bei den Wahlen rechnen kann. Auch hat sie Handlungsfähigkeit einseitig akkumuliert in direkter befehlsadministrativer Machtausübung. Ihre Leute haben nicht gelernt, sich in öffentlicher Konkurrenz durchzusetzen.
Reflexion am Rande des Parteitags: Das »Persönliche« eine eigenartige Instanz; seine Bedeutung abhängig vom Institutionengefüge und der politischen Kultur des Lebens in diesem Gefüge. Die Mehrheit dieser Delegierten scheint »unter« ihrem Bewusstsein ein großes Verlangen nach dem großen Führer zu spüren. Man muss aufpassen, ein solches Verlangen nicht vorschnell mit Strukturen des »Unterbewussten« zu erklären. Das Geflecht von mittragenden Einlassungen ist noch zu schwach; es fehlt an einem Common Sense, an entsprechenden bewährten Erfahrungen und also auch an Gewohnheiten. Merkwürdig wäre, setzte sich das Verlangen nach einem Volkskönig durch, obwohl es kein politisches Fundament für dieses Volkskönigtum gibt.
Gorbatschow – Zentrist ohne Zentrum, und doch der einzige Kandidat.
8. Juli 1990
»Es wurde demontiert, ohne zugleich aufzubauen.« (ND, 3.7.90) Frank Wehner, Berichterstatter des ND, hält es noch immer für erwähnenswert, »dass kein Beschluss gefasst wurde, ohne dass es Gegenstimmen gegeben hätte«. Auch der Titel gemäßigt-nostalgisch: »Lenin blickt diesmal eher skeptisch in den Saal«. Für »Fehler« in den letzten fünf Jahren habe »die Partei einen hohen Preis zu bezahlen«. Aber was ist mit den sechzig Jahren davor? Begreift nicht, dass ihre Stellung und Funktion der Urfehler. »In scharfem Ton« weist Gorbatschow laut ND die Forderung nach Parteirückzug aus den Repressionsapparaten zurück; unterschlagen wird sein revolutionärer Zusatz, auch alle andern Parteien könnten dort Gruppen aufmachen. Ebenso weggelassen die Frauenfrage und die neue Arbeiterbewegung.
ND, Titelseite, Herrmann/Wehner unkritisch und konzeptionslos: »Ligatschow setzte sich für die Zusammenarbeit aller marxistisch-leninistischen Kräfte, für den klassenmäßigen Zugang bei der Formierung der Sowjets der Volksdeputierten und eine folgerichtige, stufenweise Verwirklichung der Reformen ein.« Wer, bitte, sind die »marxistisch-leninistischen Kräfte«? Ist der ML denn kein Problem? Was, bitte, wäre ein »klassenmäßiger Zugang bei der Formierung der Sowjets der Volksdeputierten«? Also doch keine freien Wahlen? Und wer spräche im Namen welcher Klassen? Mit welchem Anspruch (Privileg)? Schließlich: was wäre dann »folgerichtig«? Welches wären die »Stufen« und ihre Reihenfolge? Ist denn irgendjemand gegen Folgerichtigkeit als solche und gegen »stufenweise Verwirklichung der Reformen«? Gegen was und wen richtet sich das? Warum werden die Beschwerden gegen die Pressefreiheit nicht berichtet? Nicht der Wink mit Armee und KGB?
»Schewardnadse, der seine Unterstützung für die Politik Gorbatschows deutlich machte« – was man im ND für mitteilenswert hält! Hier schreibt das Unbewusste, zumindest Ungesagte. – »Aufsehen erregte dessen Bereitschaft, nicht für Leitungsorgane der Partei zu kandidieren«. – Hübsche Bereitschaft. Im Kommentar bezeichnet Frank Wehner die Position Ligatschows als »Sozialismus der reinen Lehre«. Als ob das reine Lehre gewesen wäre.
Nicht anders der Ton im ND vom 5.7. (Klaus Joachim Herrmann: »von der Klärung zur Klarheit?«): nostalgisch, äußerst ungeklärt selber. Am treffendsten noch, was als absurdes Zeugnis berichtet wird: auf der Demo im Gorkipark ein Transparent: »Es lebe der letzte Parteitag der KPdSU!« – Es ist tatsächlich der letzte.
An der Kritik, die geübt wird, übersieht der Berichterstatter das positionelle, das Vorentschieden-Indirekte, das Genörgel, das Fehlen wirklicher Analyse und Strategie.
9. Juli 1990
Gestern Gorbatschow mit rund 2/3 der Stimmen gewählt: zum ersten Mal direkt und geheim vom Parteitag, also auch nicht mehr durch Palastintrigen im Politbüro absetzbar. Awaliani kandidierte gegen ihn, kein Vertreter der Machtkonservativen.
12. Juli 1990
Ligatschow sagte, seine Differenzen mit Gorbatschow beträfen die Taktik, nicht die Strategie. Alle, denen es um die Verteidigung des Sozialismus gehe, sollten sich hinter ihm sammeln. Diese Bewahrungsposition unterminierte er freilich durch die ironische Frage, warum den Sowjetmenschen zugemutet werden solle, nach 70 Jahren des Kollektiveigentums »den Sozialismus durch die Einführung des Privateigentums zu retten«. – Hält er Staatseigentum für Kollektiveigentum?
1916 Delegierte stimmten dann überraschend für die Streichung Ligatschows aufgrund seiner »konservativen« Ansichten von der Kandidatenliste. Die Streichung wurde zwar wieder rückgängig gemacht, aber der Ausgang war damit klar. Gorbatschows Kandidat, der ukrainische Parlamentspräsident Wolodymyr A. Iwaschko, würde das Rennen machen. Zur Kandidatur war übrigens auch der Karrierist Frolow vorgeschlagen worden.
Zum Streik scheint Gorbatschow keine konstruktive Position zu finden. Als Lysenko (Demokratische Plattform) beantragte, die Forderung der Streikenden nach Rücktritt der Regierung zu unterstützen, soll Gorbatschow laut FAZ gesagt haben, die »Anstifter« des Streiks hätten ihr Ziel nicht erreicht.
*
Wjatscheslaw Kostikow, Kommentator von APN, malt das Bild eines durch den Parteitag schicksalhaft erschütterten Gorbatschow, der als ein anderer hervorgeht, nachdem man ihn der »Demontage des Sozialismus« angeklagt hat. Der Parteitag habe ihn einige Jahre seines Lebens gekostet. Das Wort »Schicksal« liebe er besonders. Er wird mit dem Zaren Boris Godunow verglichen (»und tobend haben sie mich verflucht«), der als Progressiver »seiner Zeit voraus war«. Seit 1985 hätten sich »seine Ideen, Reden, Ansichten, Machtstellung, Wertsystem« »beträchtlich gewandelt«. – Dieser Kommentator lässt einen künftigen präsidialen Würdigungsjournalismus ahnen und verurteilt mich, der ich konzeptionelle Kontinuität bei Gorbatschow sehe, zum Illusionisten.
*
Gorbatschow zur Parteitags-Diskussion über seinen Bericht: Scharf gegen Inkompetenz, Flegelei, demagogische Agitation, »gemeine Berechnung« und opportunistische Anpassung an Stimmungen. »Man darf sich nicht von Leuten gängeln lassen, die in der Politik inkompetent sind, das bringt Unglück.« Er spottet über die, welche Vor- und Nachteile auf die Goldwaage legen. »So etwas wie die Perestrojka […] muss man nach neuen, historisch dimensionierten Kriterien einschätzen.« Sein Hauptkriterium: »Befreiung der Gesellschaft«, Freisetzung der »Tatkraft des Volkes«. Dass dabei nicht nur Gutes und Konstruktives an die Oberfläche gekommen ist, »muss man hinnehmen – so ist das nun mal mit der Revolution«. Alle haben noch nicht genügend »gelernt, von der neuen Freiheit Gebrauch zu machen«.
Was die Verlagerung der Macht in die parlamentarischen Konfliktbearbeitungsorte angeht, registriert er »ein kühles Verhältnis zwischen den Sowjets und der Partei«. Mehr noch: »Bei einem Teil der Deputierten zeichnet sich […] eine Konfrontationshaltung ab.« Viele sind aber auch »einfach verunsichert und in einem Schockzustand; da kam die alte Krankheit zum Vorschein: Mangel an Initiative, an selbständigem Denken, das Unvermögen, unter demokratischen Bedingungen, in einer ungewohnten Situation frei von Klischees zu handeln.« Ergo: nicht nur Widerstand ist schuld am Nichtklappen, sondern Habitus. Im Diskussionsverhalten vieler Delegierter habe er »mit den Poren geortet, dass keineswegs alle begriffen haben: diese Partei existiert und arbeitet bereits in einer neuen Gesellschaft, wir brauchen eine andere, erneuerte Partei mit einem neuen Arbeitsstil«. Zur »Partei und ihren Geschicken« sagt er: »Für mich ist das die Frage meines ganzen Lebens und der menschlichen Haltung.«
Gorbatschow vermerkt bei den, »wie man sagt, ›einfachen‹ Genossen, Arbeiter, Bauern, Intellektuellen sowie Sekretäre der Grundorganisationen der Partei das meiste Verständnis für die Ungewöhnlichkeit und Neuartigkeit der Situation […]. Obwohl die Definition ›einfache‹ ja noch aus ›jener Zeit‹ stammt, und ich hätte sie wohl nicht gebrauchen sollen.« – Er denkt nur den Gegensatz zur Nomenklatura, nicht von Gramsci her.
Im Blick auf die neue Arbeiterbewegung akzeptiert er die Kritik am nachhinkenden Reagieren auf diese: »Die Parteikomitees, u.a. das ZK, sind daran schuld, dass sie […] sich ihre Haltung zu den entstehenden neuen Formen der Arbeiterbewegung zu lange überlegt haben.« Auch räumt er ein, »dass wir in den zwischennationalen Beziehungen vieles übersehen und Zeit versäumt haben«, lässt das aber nicht einseitig auf der Führung sitzen: »Wir […] alle zusammen – geben Sie das endlich zu [Beifall] – haben gedacht, in dieser Beziehung sei bei uns alles in Ordnung.«
Zur Kritik an der Nichteinmischung der SU in Osteuropa: »Was denn, wieder Panzer, wieder schöne Lehren, wie man zu leben hat?«
Ideologie. – »Dieser Bereich […] wurde vermutlich der heftigsten Kritik ausgesetzt.« Eine Schwierigkeit sieht er darin, dass viele negative Phänomene nicht nur Hinterlassenschaft der Vergangenheit, sondern »auch ein Ergebnis des ›explosionsartigen‹ Charakters der Freiheit« sind. – »Ideologie« konzentriert sich im Sprachverständnis der KPdSU in diesem historischen Moment auf den Sozialismusbegriff. Dies das Feld der Traditionalisten. Gorbatschow greift folgendermaßen ein: Alles drehe sich darum, was wir unter dem Sozialismus verstehen«. Die »Ideologie des Sozialismus« sei kein Lehrbuch, sondern werde »sich zusammen mit dem Sozialismus selbst in dem Maße herausbilden, in dem wir dazu beitragen, dass das Land satt, geordnet, zivilisiert, geistig reich, frei und glücklich ist«. Den »ideologischen« Tiefstand der auf den ML bestehenden Traditionalisten charakterisiert er damit: Wann immer ein Redner die Fragen philosophisch zu stellen und zu behandeln begann, »verfiel der Saal in Apathie oder er wurde niedergeklatscht«. Das Verlangen nach Wiederherstellung einer verbindlichen Denkordnung bekommt zu hören: »Wir werden es nicht erlauben, alles von den Klassikern Geschaffene in einen neuen ›Kurzen Lehrgang‹ zu verwandeln«.
Ökonomie. – Der Zustand des politischen Akteurs KPdSU ist das eine, die zerreißenden Konflikte und Ungewissheiten über die Umgestaltung des gesamten ökonomischen Mechanismus und aller Verhältnisse in Produktion und Distribution ist das andere, wahrscheinlich viel schwierigere Feld. Gorbatschow unzufrieden damit, dass der Parteitag mit Dreiviertelmehrheit das Wort »Markt« aus dem Namen der Kommission für Wirtschaftsreform gestrichen hat. Die »jähe Wende zu einer radikalen Änderung der Situation in der Volkswirtschaft« werde folglich »nach wie vor nicht verstanden«. Weiterzumachen wie bisher, werde »das Land in den Bankrott führen«.
Demnach tritt er inzwischen für Marktwirtschaft sans phrase ein, sagt er doch auch, deren Vorzüge seien »weltweit erwiesen«, und die Frage bestehe »nur darin, ob unter den Marktverhältnissen eine hohe soziale Sicherheit gewährleistet werden kann«. Die Antwort laute: »gerade die regulierbare [regulierte?] Marktwirtschaft wird es gestatten, den gesellschaftlichen Reichtum so zu vergrößern, dass das Lebensniveau aller steigen wird. Und natürlich haben wir die Staatsmacht in unseren Händen, die […] den Prozess des Übergangs zur Marktwirtschaft nicht ›ausufern‹ lassen« werde. Zwar dürfe man nicht mit den Preisen beginnen, aber die Preisreform sei unvermeidlich.
Trotz meiner Zweifel an der sozialen Leistungsfähigkeit der Marktwirtschaft überzeugen mich die Argumente, die Gorbatschow gegen bestimmte in unserem westlichen Sinn »linke« Kritiken vorbringt. Angesprochen von einem Arbeiter, wann endlich Ordnung herrschen wird und es keine Schieber mehr geben wird, erwidert er: der Markt, und nicht die Polizei, müsse das erledigen. Und noch einmal: Auf die Frage des Sekretärs eines Gebietskomitees: »Können Sie das tun, was Andropow getan hat?«, habe er geantwortet: »Die Bekämpfung des Schwarzmarkts ist zu 80 Prozent eine ökonomische Frage. [Beifall] Wenn es keine entwickelte Wirtschaft gibt, wird sich der Schieber gesundstoßen [Beifall], am Mangel schmarotzen all diese Jobber der Schattenwirtschaft und korrumpierten Elemente.«
Zur Landwirtschaft bekräftigt G nur das x-mal Gesagte: »Veränderung der Produktionsverhältnisse auf der Grundlage der Gesetze über das Eigentum, über den Grund und Boden, über die Pacht, und andrerseits die Hilfeleistung für die Infrastruktur, […] für den Bau von Landmaschinen usw.«. Konfiguration: 1) »allen freiwilligen Entscheidungen freien Spielraum zu gewähren«; 2) den Austausch Stadt-Land ins Gleichgewicht zu bringen; 3) die Lebensverhältnisse auf dem Land zu verbessern; 4) Ökologie gleichrangig mit Lebensmittelproduktion. – Wunderbar, aber im Sinn von Wunder verlangend. »Von daher wurde deutlich, dass die Macht eines Präsidenten gebraucht wird«.
13. Juli 1990
Gestern Abend erklärte Jelzin im Großen Saal des Kreml seinen Parteiaustritt, sehr wirksam, vor laufenden Fernsehkameras, man hätte eine Nadel fallen hören. Dann verließ er den Saal. Empörte Rufe: »Schande, Schande«, plötzlich sehr müde wirkende Gesichter. Die Demokratische Plattform hat sich nun abgespalten und konstituiert sich als eigne Partei. Jelzin erklärte, als russischer Präsident müsse er überparteilich sein, Präsident aller Russen, der sich nicht an die Linie der KPdSU binden könne. Er hat damit weiteren Wind aus Gorbatschows Segeln genommen.
Gestreikt wurde auch in Workuta, wo Arbeiter ihre Parteibücher in einen großen Papiersack warfen.
FAZ-Reißmüller: »Nur wenn die Partei nicht mehr der Staat ist, kann der Leninismus absterben, das Grundübel in der Sowjetunion.«
*
Die FAZ setzt ihre auf Säuberung der DDR-Universitäten gerichtete Serie fort: Ralf Georg Reuth (»Weiter auf antikapitalistischem Weg. Die PDS-Gesellschaftswissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität geben nicht auf«) stellt vor allem Heinrich Fink an den Pranger. Er steht im Wege als widerständiges, weil unbelastetes Element. Dieter Segert wird an zweiter Stelle angegriffen, an dritter Michael Brie, der aber mit seinem Bruder André verwechselt und zum Wahlkampfleiter der PDS erklärt wird. Brie habe Kontakte zu Markus Wolf, wird mitgeteilt, als ob das Stasi bedeute. Dieter Klein kriegt vorgehalten, auf dem SEDParteitag vom Dezember 1989 eine wirkliche Herrschaft des Volkes, nicht eine bloße Westkopie angestrebt zu haben.
14. Juli 1990
Außer Gorbatschow und Iwaschko lauter Neue im Politbüro gewählt. Schewardnadse nicht. In der FAZ interpretiert Werner Adam es als eine Art Halbherzigkeit, fast Feigheit, dass Gorbatschow »sich nicht dazu durchringen mochte«, die sozialistische Wahl zu widerrufen und zum Kapitalismus überzugehen.
15. Juli 1990
Laut Fernsehen 400 000 auf dem Platz der Manege. Keine Rede, in der die KPdSU nicht »verbrecherisch« genannt wurde. Ihre Führer sollen vor Gericht gestellt, ihr Eigentum beschlagnahmt werden. Gorbatschow habe sich zu den »Konservativen« geschlagen. Durch seinen Austritt scheint Jelzin diese Deutung festgelegt zu haben.
Später ein Bericht über sowjetische Faschisten, schwarz uniformiert, vom Popen gesegnet, mit Judenhass und Zarenemblemen. Sie sehen tatsächlich den unsrigen ähnlich und wünschen auch, mit diesen in Kontakt zu treten. Juden verlassen zu Zehntausenden das Land, in Israel eine Wohnungskrise.
16. Juli 1990
In seinem Schlusswort sagte Gorbatschow, dies sei nicht der letzte Parteitag der KPdSU und nicht ihr Begräbnis, wie vorhergesagt worden war. »Die Kommunistische Partei lebt und wird leben. Sie wird ihren historischen Beitrag zum Fortschritt des Landes und zum Fortschritt der Weltzivilisation leisten.« Ein Rückfall in die »alten Gewohnheiten« würde den »Tod der Partei« bedeuten. Er werde »alle verfassungsmäßige Macht als sowjetischer Präsident« gebrauchen, um die Politik der Umgestaltung durchzusetzen und zu verhindern, dass irgendjemand »die Perestrojka zerbricht«.
Die Resolution »Für einen humanen, demokratischen Sozialismus« erklärt sich für die Überwindung der »historischen Spaltung der Arbeiterbewegung«, für Zusammenarbeit von »Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, national-demokratischen Parteien sowie allen Organisationen und Bewegungen, die für Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt kämpfen«. Die innere Situation der SU sei bestimmt durch die Polarisierung zwischen einer »konservativ-dogmatischen Strömung«, die zurück zum autoritären Sozialismus der Vergangenheit will, und einem radikalen Antisozialismus, ja Faschismus und Monarchismus; in den nationalen Bewegungen immer mehr Chauvinismus.
Gorbatschow hat den Rückzug der KPdSU aus der Kontrolle der Massenmedien dekretiert. BBC brachte das in Zusammenhang mit der gestrigen Demonstration. Engelbrecht, den ich mit einigem Glück am Telefon erwische, sagt, der »konservative« Angriff sei dauerhaft abgewehrt. Daher sei die Demonstration auf dem Manegeplatz »die richtige Veranstaltung zum falschen Zeitpunkt« gewesen; nach dem russischen Parteitag wäre sie angemessen gewesen, jetzt nicht mehr. – Ich sage, im Fernsehen sei von 400 000 Demonstranten die Rede gewesen. E. erwidert, ich solle getrost die Hälfte streichen. Er war dort. Der Platz nur locker besetzt. Die Schaulustigen überwogen. Ein harter Kern von einigen Zigtausend umschloss die Rednertribüne. Weiter hinten zündeten die radikalen Sprüche nicht. Nicht die geballte Kampfstimmung wie im Februar oder April. Awaliani verglich er mit der SA. Dieser rechtsdemagogische Populismus sei gefährlich.
Wir hätten uns vom sinnlichen Eindruck zunächst irreführen lassen, als wir die Grundstimmung für machtkonservativ hielten. Was wir für »rechts« (er spricht diese Sprache allzu bedenkenlos) hielten, sei Ignoranz, Ungeübtheit, Verständnislosigkeit, Nicht-Mitkommen mit dem Neuen gewesen. Frei nach: Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Für das Folgenreichste hält E. rückblickend Gorbatschows Treffen mit den Sekretären der Grundorganisationen. Sie habe er gewonnen. Daraus sei ein zweiseitiger Energietransfer gefolgt. Kraft für ihn, Orientierung für die Verunsicherten.
Auf Gorbatschows Wunschliste (85 Namen) standen Gelman, Roy Medwedjew, Falin u.a. Sie hatten zwar mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, aber auch viele Gegenstimmen. Es bedurfte des massiven Auftretens von Gorbatschow u.a., die Beschwörung, nicht alles Erreichte des Kongresses in letzter Minute wieder zunichte zu machen, um die Delegierten dazu zu bewegen, das ZK entsprechend zu erweitern. – Der Opportunist Iwan Frolow hat es ins Politbüro geschafft. Ist aber nicht für »Ideologie« zuständig; dieses Ressort wurde Aleksandr Dsachossow (1934) übertragen, der den Ausschuss für Internationales im Obersten Sowjet leitet. Eine einzige Frau im Politbüro, anscheinend das übliche schamlose Feigenblatt: Galina Semenowa, Chefredakteurin der Zeitschrift »Krestjanka« (Die Bäuerin) seit 1981, nunmehr zuständig für Frauenfragen.