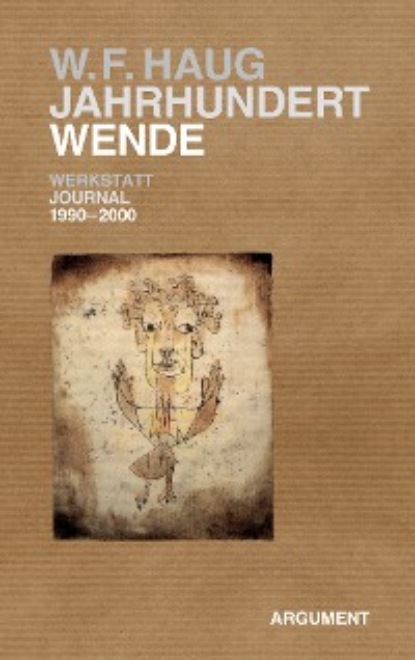- -
- 100%
- +
Verliererseite: Die PDS hat aus Furcht vor Terroranschlägen ihre für heute Abend geplante Großkundgebung abgesagt. – Siegerseite: Die FAZ hat zur Feier des Einheitstages den Umbruch verändert: Leitartikel quer über eine halbe Seite. Mehr denn je Regierungsblatt. Kohl füllt eine Seite mit Sätzen wie: Nun ist »der geistige Klammergriff der kommunistischen Ideologie beseitigt«. De Maizière fungiert nur in einem Inserat der Bundesbahn.
Ina Merkel gestern voller Unbehagen über das Unbehagen an Deutschland. Aber sie empfindet es selbst. Auch ich werde der Sache nicht froh. Die Machtverdichtung hier wird uns als Subjekte hinterrücks mitverwandeln, weil sie die Art, in der wir als Deutsche in die Welt eingeschrieben sind, verändern wird. Für die anderen sind wir nun einmal Repräsentanten bzw. Partizipanten Deutschlands.
Pit Jehle bemerkte die systemische Intelligenz einer Staatsordnung, in der es mehrere Instanzen gibt, deren keine gänzlich kompetent ist. Selbst die Generalkompetenz der Zweidrittelmehrheit des Parlaments vielfach gebrochen. Jetzt das BVG-Urteil. U.a. hatte die »verabscheute« PDS zum ersten Mal das Verfassungsgericht angerufen und gleich Recht bekommen. Das ist eine bemerkenswerte Verfassungslektion, die da der PDS erteilt wird. Die Instanzen könnten einander freilich auch blockieren.
*
Die enorme Erleichterung wird überlagert vom Eroberergestus der bundesdeutschen Herrschenden und Machthabenden. Mehrere Siege, die einander durchkreuzen. Obenauf die Kreuzzügler des »Privateigentums«, nein: des Kapitalismus.
Jens Jessen (FAZ, 29.9.): »Wiedervereinigung« = »Entmachtung einer ganzen Priesterkaste«. »Noch ehe den deutschen Intellektuellen mangelnde Unterstützung des Wiedervereinigungsprozesses vorgeworfen werden konnte, verstanden sie, dass der Vereinigungsprozess gegen sie gerichtet war.« F. K. Fromme ebenda über »das stille Zusammensinken der DDR«.
*
Michael Brie hielt seine erste Vorlesung zu Luhmanns Artikel übers Ende der DDR. »Was lernen die Landtiere aus dem Verenden der Fische? Nichts!«
2. Oktober 1990 (2)
Im Gorki-Theater bei der Abschiedsvorstellung der DDR. Klaus Pierwoß, der als Dramaturg an dieses Theater gegangen ist, hat mich eingeladen. Die Schauspieler und Schriftsteller sitzen im Licht, eine stille Feierlichkeit des Saales auf sie gerichtet wie auf ein stellvertretendes Wir. Volker Braun liest die »Kolonie«, eine Kafka-Paraphrase vom Frühjahr 1989, die noch immer prophetisch wirkt, obwohl sie schon mehrfach veröffentlicht ist, darunter auch im Argument. Ich registriere diesen Unterschied unserer Textproduktionen, dass diese Wirkung mir verwehrt ist. Ich muss meine schwitzende Unvollkommenheit beim möglichst klaren Sagen immer wieder neu anstrengen.
Volker, klassisch: »Ich bleibe hier, mein Land geht in den Westen …«. Ein anderer liest von Thomas Brasch: »Bleiben will ich, wo ich niemals war …« Biermann: »Das bisherige Stück ist aus. Nun habe ich endlich nicht mehr Recht.« Heißt: Recht gegen seinesgleichen. Und Heiner Müller: »Dies ist eine Zeit, in der man die Lehren vergraben muss, so tief, dass die Hunde nicht rankommen.«
Nicht mehr Recht haben gegen Mächtige, die sich auf dieselbe Tradition wie wir berufen. Jetzt predigen wir, ganz normal, den Fischen. Jetzt haben wir »Recht« gegen Mechanismen.
Nach der Pause muss ich aufs Diskussionspodium. Wenn vorher Feierlichkeit die literarische Nostalgie entgegennahm, so lässt der Saal nun den Hund raus nach einem Zwischenruf, warum keine Frauen auf dem Podium. Lasse mich von Pierwoß, der das zu verantworten hat, in den sicheren Untergang schicken. Analyseversuche gehen im Lärm unter. Ich habe kein Glück bei meinen öffentlichen Auftritten in der DDR. Das Gefühl, hier nichts zu suchen zu haben. Ursula Werner, die man schließlich zur Ausfüllung der Frauenrolle aufs Podium geholt hat: »Wenn uns jetzt die Gesellschaft der Warenproduktion überrollt …«, und Langhoff sieht die Zahnärzte und Gynäkologen mit ihren brillantenbehängten Damen das Theater besetzen. Als Lyrik die Nostalgie peinlich, als politische Meinung unerträglich. Neben mir Frank Castorf, der an der Volksbühne Aufsehen erregt hat mit seiner Inszenierung der Räuber. Für ihn ist die Bombe (werfen) das politische Ding an sich, von dem abgebracht zu werden die Kunst freisetzt.
Ich versuche, etwas über den Funktionswandel des Theaters nach der Freisetzung der Öffentlichkeit zu sagen. Vor allem versuche ich, die Zweideutigkeit der Situation in Worte zu fassen, die Überlagerung von Erleichterung und Bedrückung. Einerseits eine Befreiung; dem Zensurstaat nicht nachzuweinen. Andrerseits kommt die Emanzipation als Unterordnung. Aber nicht zu leugnen, dass der Bundesrepublik auch eine eigne Dignität zugewachsen ist. Unglück, wenn die Intellektuellen drinnen jammern, während das Volk draußen feiert. Wir sind getrennt von der Freude des Volkes. Das ist ein Unglück. Auf dem Podium nimmt keiner den Faden auf. Nur aus dem Publikum erhalte ich Schützenhilfe von Claus-Henning Bachmann, der über die Volksuni als Versuch, Intellektuelle und Volk zusammenzubringen, spricht und an seine Prägung vom »wissenschaftlichen Volksfest« erinnert.
3. Oktober 1990
Als es auf Mitternacht zuging, schoben Anneli, Arne (die Tochter) und Volker Braun und ich uns mit der, durch die, gegen die Menge dem Brandenburger Tor entgegen, das wir aber nicht erreichten. Die Straße Unter den Linden war mit einer Million zertretener Plastikbecher und unzähligen leeren Flaschen und Dosen bedeckt.
In unvorstellbarem Gedränge erreichte ich den Bahnsteig, quetschte mich in einen total überfüllten Zug, der an ebenso überfüllten Bahnsteigen vorbei zum Zoo fuhr.
*
Mathias Schreiber zieht (in der FAZ vom 29.9.) über Lafontaine her, weil dieser »übereilt die gerade mühsam erworbene Einheit-in-Freiheit an das ›Europäische‹ abtreten möchte«. Führt einen ungenannten SPDler vor, weil dieser der DDR empfohlen haben soll, es doch eher mit Österreich zu probieren. Lafontaines Bemerkung, auch Gesamtdeutschland sei ein Provisorium, weil ja Europa konstituiert werden müsse, kontert er im Carl-Schmitt-Ton: »Die Taktlosigkeit solcher Witzeleien entspricht der Unangemessenheit provisorischen Verhaltens in entscheidenden Situationen.« Das erste Mal, dass ich in der FAZ Kursivdruck gesehen habe. Selbst typographisch herrscht der Ausnahmezustand.
Morgan Stanley rechnet damit, dass in Deutschland die Zinsen auf über 10 Prozent steigen, woanders noch höher, weil aus der BRD wegen der Ostinvestitionen enorm viel weniger Kapital exportiert werden wird. »Schwere Schläge« werde das »außerdeutsche Europa« erleiden durch steigende Ölpreise und höhere Kapitalkosten. Was aber, wenn Weltwirtschaftskrise? Wie schlüge diese nach Deutschland herein? Hier denken sie nicht weiter.
Die Schieder-Gruppe, mit 1,17 Mrd DM Umsatz stärkstes Möbelkapital Europas, baut in Polen aus. Bislang 95 Prozent der dortigen Produktion in den Westen exportiert. Terms of trade: Holz kostet 50 Prozent im Vergleich zu hier, Arbeit weniger als 10 Prozent (220 DM pro Monat, Überstunden am Wochenende mit Handkuss, Krankenquote die Hälfte im Vergleich zur BRD). In Polen nun zwei neue Polstermöbelwerke fürs »untere Preissegment«, in Ostberlin eines fürs mittlere. Ein Ausdehnungshemmnis: die Bundesrepublik lässt polnische Auszubildende nicht ins Land.
4. Oktober 1990
Erhaschte Bruchstücke zweier Sendungen, von einer jener unzähligen »Talkshows« (welch ein Sprachbastard!) und einer Sendung aus Weimar, wo Jugendliche aus Erlangen und solche aus der DDR ihre Meinung sagen durften. Erstere gemütlich-langweilig. Die DDR-Jungen eine Überraschung: genau blickend, unberauscht.
»In den Schoß gefallen« ist den (uns) Deutschen diese Einheit. »Geschichte« passiv, tangential zur aktiven Geschichte: am Rande der Perestrojka.
Was versagt hatte: die Zentralverwaltung durch eine Staatspartei, die entsprechende Produktionsverhältnisse mit einem strukturhomologen politischen und ideologischen Überbau versah. Wenn eine Partei diktiert, dehnt sich der Staat überall dorthin aus, wo sie zugange ist, und holt auch die Diktierende in sich hinein. Die Parteiverhältnisse werden staatsförmig. Es ist ein absolutistischer Staat, der rekrutiert und kooptiert, gesichert durch universelle Kontrolle (informationelle Durchdringung, Disposition über Chancen und Sanktionen, Repression). Nicht feudal, aber absolutistisch: der moderne Fürst. Aufgeklärt, informiert durch Marx, Engels und Lenin: So hat mir das schon vor einem Menschenalter der Architekt Weise erklärt, einer der Erbauer der Stalinallee. Deren Symmetrie demonstriert eine absolute Generalvernunft. In ästhetischer Form drückt sie die reale Subsumtion der Gesellschaft unter den Staat aus.
Das Ersticken von Initiative antisozialistisch. Der Staat hochwidersprüchlich: unmittelbare Bedingung von Sozialismus und antisozialistische Tatsache in einem. Letztere hat den Sozialismus bestimmt.
Man müsste im öffentlichen Diskurs das interessierte Amalgam aus Kapital und dezentraler Handlungsstruktur auseinanderlegen. Zumal die Imperien des transnationalen Kapitals Transversalstaaten sind, die Profitkriterien als Korrekturinstanz gegen bloßen Administrationismus haben.
*
Verfassungsgerichtsurteil: Spontan sagte ich mir, »es gibt noch Richter«. Bei zweitem Überlegen: das Urteil auch ein Schachzug gegen die SPD. Diese hatte ja vor allem die Ausschaltung der Linkskonkurrenz PDS betrieben, um widerstrebende Linke zu zwingen, wieder einmal das kleinere Übel SPD zu wählen. Nun werden die Stimmen sich aufsplittern, und die linken Teile werden sich nicht wie Teile einer Linken verhalten können. Dennoch das Urteil gut für die Linke, zumal der Sieg der Konservativen ohnehin gesichert erscheint. Wenigstens Aspekte von Übergang, Experiment und Neuerungschance werden gegeben sein.
Vom DDR-Staat schreibt Fromme in der heutigen FAZ, dass er »den Zugang zum Innern des Menschen nicht fand«. Reißmüller, unzufrieden damit, dass Bundespräsident von Weizsäcker der Jugendrevolte von 1968 »ein demokratisches Verdienst« zugesprochen hat: »Auf den roten Fahnen der Marschierer von damals stand nicht Demokratie, sondern Gewalt, Rohheit, Zerstörung.« Sehen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in spätbourgeoisen Augen so aus?
Der Vizepräsident der Bundesbank (Schlesinger): Die konjunkturellen Voraussetzungen der BRD für die »Vereinigung« »könnten kaum besser sein«.
Die FAZ, in der noch immer Konzerne in ganzseitigen Anzeigen Deutschland (be)grüßen, verbraucht unendlich viel Platz für Stimmungsberichte. Eine große nationale Sektparty hält an. Nichts spiegelt sich in solchen Medien von der Skepsis vieler. Bei Butter-Beck murmelte die Verkäuferin am 2.10.: »ein Trauertag«.
Im ZDF die erste Sitzung des um Volkskammerabgeordnete erweiterten Bundestags. Dass Ullmann und Gysi ihre Jungfernreden hielten, wurde erwähnt, aber kein Wort davon gesendet, nur die beiden Kahlköpfe wurden gezeigt. Im Ost-Fernsehen dagegen kriegte jeder ein paar Sekunden. Man hat die dortigen Redakteure noch nicht ausgewechselt.
5. Oktober 1990
Der US-Dollar auf historischem Tiefstand, nachdem die Fed verlauten ließ, man wolle keine neuen Zinssteigerungen. Um dennoch, in Konkurrenz mit dem deutschen Kapitalbedarf, Geld ins Land zu kriegen, muss man das eigene für die Ausländer verbilligen: billiger Dollar als Ersatz für teures Geld.
Barbier weitet in der FAZ hierfür den Begriff des Teilens aus: Nachdem alle Politiker davon gesprochen haben, im neuen Deutschland müssten die Reicheren mit den Ärmeren (d.h. denen aus der DDR) teilen, die Regierung der Reichen aber entsprechende Steuererhöhungen (vor den Wahlen) ausschließt, erklärt die FAZ nun die Finanzierung über den Kapitalmarkt »mit ihrer rationierenden Wirkung« zu einer Form des Teilens, weil diese Kreditaufnahmen die Zinsen hochtreiben. Natürlich schweigt das vom Nehmen, blendet die Zinsnehmer aus.
In der BRD nahm die Arbeitslosigkeit im September um 85 000 ab (auf 1,73 Mio), in der DDR nahm sie um 83 500 zu und stieg auf 450 000. Das sieht nach einem Nullsummenspiel aus: was die DDR verliert, gewinnt die BRD. Das täuscht aber. In der DDR nahmen die Kurzarbeiter um 271 700 auf 1,8 Mio zu, und das Neusprech wurde um den paradoxen Euphemismus »Nullarbeit« bereichert. Mindestens 20 Prozent der »Kurzarbeiter« sind auf »Nullarbeit« gesetzt, also »Nullkurzarbeiter« oder kaschierte Arbeitslose, was deren Zahl fast verdoppelt. Seit dem Vorjahr hat die Zahl der Arbeitsplätze in der BRD um 700 000 zugenommen.
Zum Auftakt der deutschen Einheit alle Generäle der NVA entlassen, ebenso alle Regionaldirektoren der »Treuhand«, die man durch westdeutsche Unternehmer bzw. deren Manager ersetzt.
Vietnam lehnt sich an China an.
6. Oktober 1990
Ligatschow nannte die Rechts-links-Unterscheidung im gegenwärtigen politischen Spektrum der SU »primitiv«. Hauptgegner der KPdSU seien »national-separatistische und revisionistische (?) Kräfte«, die einen »bourgeoisen Entwicklungsweg« bei Auflösung der Sowjetunion wollten. L. schreibt an seinen Erinnerungen.
*
Klaus Bochmann erzählt, sein Ältester (Martin, 14), der nie etwas für die FdJ übriggehabt hat, sei am Tag der Einheit im Blauhemd zur Schule gegangen. Seine Clique hatte das so verabredet.
Brief von Kathrin A., jener Pädagogikstudentin aus Leipzig, die in Philosophie (oder war es »Gesellschaftswissenschaft«?) eine Abschlussarbeit über meine Schriften machen sollte. Auch dieses Projekt einer nachholenden Rezeption ist nun abgebrochen.
Obwohl in Zeitnot, schreibe ich ihr postwendend: Dein Brief hat mich bewegt, mehr, als Du annehmen magst. Seine Trauer steckte mich an, denn die Erfahrungen, die wir mit der neuen Einheit auf unseren Tätigkeitsgebieten inzwischen machen konnten, stimmen nicht froh. Aus der Ex-DDR spüren wir einen enormen Opportunitätsdruck, der es noch schwerer macht, kritische Positionen aufrechtzuerhalten. Dazu bedrückt es, ohnmächtiger Zeuge zu sein, wie unsere Herrschenden generalstabsmäßig die Machtpositionen besetzen, als wäre da ein Krieg verloren worden, und wie sie außerhalb aller Demokratie einen Kreuzzug des Kapitalismus gegen alle ihm nicht unmittelbar subsumierten Eigentumsformen durchführen (ich denke vor allem an Genossenschaften). Vieles, was jetzt passiert, ist mir zuwider. Zumal, was Du aus der Hochschullandschaft schilderst. Fred Jameson, ein amerikanischer Marxist (ja, das gibt es), den ich heute traf, verglich die Art, wie der BRD-Staat mit der DDR umspringt, mit der Besetzung der Südstaaten durch den Norden nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Offenbar hat man auch damals zielgerichtet jegliche politische Eigenständigkeit zerstört. – Und doch fiel mir beim dritten Überlegen auf, dass mir viel wohler sein könnte, wenn Du und Deine Generation nicht mit Nostalgie reagierten. Nachweinen können wir dem, was als bessere Möglichkeit für einen viel zu kurzen historischen Moment aufschien, nicht aber dem alten Regime. Und weil dieses in Wahrheit schon lange keine Zukunft mehr hatte und also auch jemandem wie Dir keine bieten konnte, ist Dein, wie Du schreibst, »eigenartiges Gefühl, mit 22 Jahren eine Vergangenheit zu haben«, eine Selbsttäuschung. Es ist vielleicht doch das Ende einer vormundschaftlichen Imagination, was Du mit derart gemischten Gefühlen nur halbklar registrierst. Nicht dass es keine Hoffnungen und Ziele gäbe, um die jetzt gebangt werden muss. In jenem Imaginären steckt auch unendlich Wertvolles und hoffentlich irgendwann einmal Zukunftsfähiges, das jetzt unterschiedslos niedergemacht werden soll. Um es zu retten, müssen wir es aber kritisieren und ins Illusionslose übersetzen. Momentan fürchte ich mich vor der Rückblickshaltung, die Dein Brief ausdrückt, weil sie erwarten lässt, dass Dich so die einzig wirkliche Zukunft gleichsam von hinten ereilt. Es ist nicht einmal auszuschließen, dass diese Rückwärtsgewandtheit bei vielen nur ein kurzes Durchgangsstadium ist, um sich später desto rückhaltloser nach der neuen Decke zu strecken. – Es geht mir mit diesen Andeutungen nicht um Altersweisheiten, wie Du als jemand, die noch in der Straße der Jugend wohnt, annehmen magst: sondern um die Verteidigung einer Hoffnung, die ich in Dich und Deinesgleichen setze. Bitte schreibe, wie es Dir weiter ergeht, und schau mal wieder vorbei. Ich schicke Dir mit gleicher Post mein »Perestrojka-Journal«, von dem ich vermutlich erzählt habe. Bin neugierig zu erfahren, was Dir daran fremd ist und ob es etwas gibt, wo unsere Welten zusammenhängen.
7. Oktober 1990
Sibylle Haberditzl schreibt zum Perestrojka-Journal: »Ich habe heut Nacht bis 1/2 vier Uhr früh in Deinem Journal gelesen und möchte Dir für Deine Arbeit und Ungeschminktheit danken. Viele Einzelheiten sind da wie Eislers Fliege in Bernstein aufbewahrt, sehr bewegend und nützlich. Ein Meisterstück Deine und Friggas Aufzeichnungen aus Moskau. – Die Silvesterfeier mit den Eisler-Liedern7 war übrigens erst 1969/70 – also noch zwei Jahre länger war Eisler hier unbekannt.«
*
Schewardnadse auf der 45. UNO-Vollversammlung: Das Ende des Kalten Krieges ermöglicht die Renaissance der UNO. Ein »Lichtjahr« Entfernung zurückgelegt seit 1989. Die Zwangsmaßnahmen gegen den Irak artikuliert er als Ausdruck des Neuen Denkens mit seiner Dominanz gesamtmenschlicher Interessen. Seine Aussagen beschreiben aber natürlich keinen Zustand, sondern ein Seinsollen, eine Bestrebung, die hegemonial werden soll: »Von nun an ist die Weltgemeinschaft gewillt, nach einheitlichen Normen zu handeln.« Daraus folgt: »Dass der Rüstungsstand eines Landes nicht sein ausschließliches Recht und seine Prärogative sein, dass ihm in dieser Hinsicht nicht freie Hand gelassen werden darf.« Die UNO soll mit militärischer Exekutive ausgestattet werden. – Schewardnadse sieht die Gefahr, dass auf den Eisernen Vorhang der Elendsvorhang zwischen Norden und Süden folgt. Die UNO soll sich gegen wissenschaftlich-technischen Monopolismus einsetzen.
In der FAZ vom 15.9.90 berichtet Walter Haubrich über die von Octavio Paz organisierte Intellektuellenkonferenz, von der mir Bolívar Echeverría erzählt hat. »Semprun konstatierte erfreut das Verschwinden des Parteien und Regierungen eng verbundenen ›organischen‹ Intellektuellen, der er selbst ja als Mitglied des Politbüros der KP Spaniens gewesen war, und meinte, die westliche Linke habe die Dissidenten in Osteuropa nicht genügend unterstützt. Die Marktwirtschaft […] habe endgültig [!] ihre Überlegenheit bewiesen, und die Geschichte habe gezeigt, dass die Arbeiterklasse nicht die Gesellschaft führen könne. Als ›organische‹ Intellektuelle im Sinne Sempruns wurden […] auch Heidegger und Lukács wegen ihrer Unterstützung totalitärer Diktaturen kritisiert. Dagegen pries der ungarische Philosoph Ferenc Feher [in der FAZ: Seher] den tschechoslowakischen Präsidenten Vaclav Hável als Beispiel eines ›unorganischen, aktiven, post-machiavellistischen Intellektuellen‹.«
Hans-Christoph Rauh, der mich noch vor kurzem (1988?), als das in seinem Land noch einer üblen Nachrede gleichkam, zum Postmarxisten machte, ist jetzt Postmarxist.
9. Oktober 1990, Flug nach Stuttgart
Die Mauer aus der Luft – nur mehr eine Schneise in der Landschaft, eine Straße vielleicht; ich meine schon zu sehen, wie sich diese Verletzung der Landschaft wieder schließt, allenfalls Narben hinterlassend, wie einmal der römische Limes.
Die bisherige Weltordnung des Ost-West-Antagonismus definierte für unsere Mächtigen übermächtige Zwänge, auf die sie Rücksicht zu nehmen hatten. Wer zu den Herrschenden antagonistisch stand, konnte sich gleichsam an jene Struktur anlehnen. Für die Bundesrepublik hieß das: das Deutsch-Nationale war durchkreuzt. Jetzt ist diese Blockierung weg; wir sind mit unseren Herren und unseren politischen Antagonismen allein.
*
Analysiert man die Gemengelage der Motivationen genau, zeigt sich, dass viele heimlich der Diktatur nachweinen. Mein Journal ein Probemedium, damit der Umbau nachvollziehbar, Treue im Verrat.
9. Oktober 1990 (2)
Vom Flughafen zu Theo Bergmann. Er ist Spitzenkandidat der Linken Liste/PDS. Finde ihn vom Laster der Politiker eingeholt: ruppig-schnelle Urteile, schwach im Zuhören.
Lesung aus dem Perestrojka-Journal in Stuttgart: Wendelin Niedlich, dieser Glücksfall eines Buchhändlers, fand mich zu romantisch. Die Träume zu sehr im Vordergrund.
10. Oktober 1990
Als es meiner Mutter schlecht ging, sah in einem Sessel ihre Mutter, im anderen mein Vater. Die Toten stehen ihr bei. Ihre Toten.
*
Abends, als ich durch Stuttgarts Innenstadt der Buchhandlung Niedlich zustrebe, meine ich zu sehen, dass diese multinationale Straßenbevölkerung das Proletariat von heute sei.
In der Diskussion wendet sich jemand gegen »das Gerede von der Revolution« in der DDR: kein anderes Volk könnte seine Regierung durch Davonlaufen erpressen.
Der Taxifahrer gegen Rommel (den Oberbürgermeister), weil der Ausländer ins Mietshaus reingesetzt habe. Irrsinnige Geschichten, wohlgehütetes Imaginäres, um den Hass gegen »die Ausländer« zu hegen: Muslime, die mitten auf der Treppe oder mitten auf der Straße vor seinem Auto, »im Dreck!«, wenn er es eilig hat, ihren Gebetsteppich ausbreiten und »zum Neckar« – so übersetzt er Mekka – hin beten. – Die Ausländerfrage = das Auseinander der Arbeiterklasse.
Derselbe Taxist, unermüdlich gesprächig, hatte eine merkwürdige Mischung aus potenziell kritischem Wissen und Entschärfungen der Kritik auf Lager. Von verfälschten Lebensmitteln und dass es noch keinem geschadet habe und so. Hengstenbergs angebliches Filderkraut, das aus Jugoslawien stammt. Er ist Ostpreuße, aus Allenstein; seine Kinder und Enkel lernen und kultivieren angeblich den ostpreußischen Dialekt, sozusagen als Zweitdialekt neben dem Schwäbischen, das ihre wirkliche Heimatsprache ist.
*
Was wir vom »Argument« nicht geschafft haben, das hat »Niemandsland« geschafft: die Fusion mit einer der DDR-Neugründungen.
*
Meine Mutter schwankt. Mal wollen ihre Toten sie zu sich holen, mal stehen sie ihr bei. Ich versuche, sie darin zu bestärken, dass sie ihr beistehen.
Die Tränen meiner Mutter. Jetzt, im Zug, die meinen. Ob wir uns noch einmal sehen, fragte sie.
11. Oktober 1990
Leere Säle in Stuttgart und Ulm, wo ich aus dem Perestrojka-Journal vorlesen soll. Das Thema tot. Der Wind bläst mir ins Gesicht. In Ulm, in der kalten, lauten ehemaligen Fabrikhalle des Roxy 20 Leute, darunter zwei »Groupies«, ein von vorneherein Abgeneigter, der bald geräuschvoll geht, ein Ex-Maoist, alles immer schon besserwissend, ein Verdrehter, dem man die wie auch immer bewirkte Zerstörung seiner Vernunft nicht ansieht. In Stuttgart, bei Wendelin Niedlich, waren es nur sieben, dafür ausnahmslos gute Gesichter.
12. Oktober 1990, Dubrovnik, Inter-University-Center
West-östliches Seminar über Ästhetik und Politik
Valeri Podoroga über Eisensteins Gewalt-Ästhetik, die er sehr »russisch«, aber merkwürdigerweise mit Foucault (Überwachen und Strafen) artikuliert, vorführt. Aus Eisensteins »Streik«: Schlachthausszene mit Streikenden vs. Soldaten geschnitten. Zelebrierte Verstrickung. Ich komme mir diesseitig, ja hausbacken vor. Körperzauber: »Nur der zerstörte menschliche Körper kann die Grenzen seiner Expressivität realisieren.« Protoplasmatische Körper: alles Solide zerstört und rekonstruiert, so dass sie Spuren oder Erinnerung der Zerstörung an sich tragen.
Die unheimliche Arbeit am Bild. Die Wahrheit über das Nehmen desselben. Das zeitaufwendig Hochkomponierte dem flüchtig-momentanen Verbrauch dargeboten, der nicht anders kann, als sich unmittelbar absorbieren zu lassen.