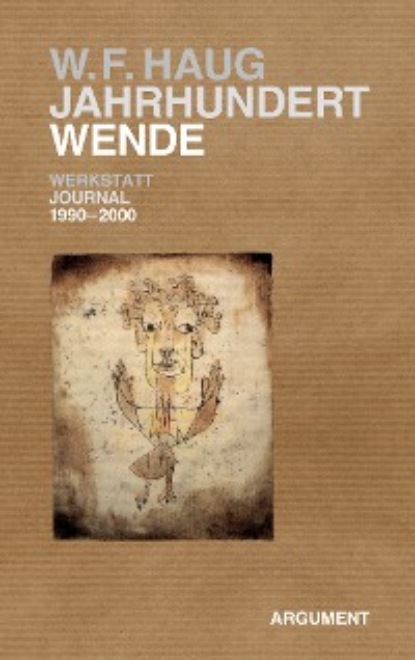- -
- 100%
- +
Man schießt Fotos. Aufnahme konnotiert anders: a take. Im Gebrauch liegen die Grenzen anders.
*
Vor allem seinetwegen habe ich Fred Jamesons und Susan Buck-Morss’ Einladung angenommen: Merab Mamardaschwili aus Tbilisi. Nelly Motroschilowa hatte von ihm respektvoll geraunt. Vielleicht zehn Jahre älter als ich, kahl, an Foucault erinnernd und im Gestus etwas Französisch-Mediterranes. 1946, »im dunkelsten Tunnel«, entschloss er sich (kam ihm »der Funke in den Sinn«), ein linguistisches Fenster aufzumachen: lernte Englisch, und zwar mittels eines Radios Marke Mende (Nordmende?). Die Bücher, die nicht da sein sollten und sich doch einfanden: Dickens, Hemingway, wurden zu Stützpunkten einer anderen Weltmöglichkeit. Später lernte er Französisch, Italienisch, Spanisch; er liest Deutsch.
Die Brücke zwischen Ost- und Westintellektuellen muss gebaut werden, sage ich. Ja, erwidert er, und sie kann nur persönlich gebaut werden, im Gespräch. – Deshalb bin ich hergekommen, sage ich. Aber das Gespräch ist rätselhaft schwierig.
Unser (westlicher) Marxismus hat vielleicht die gleiche Funktion wie ihr (östlicher) Mystizismus: Distanznahme im Verhältnis zur legitimierenden Macht des Faktischen der Herrschaft.
Das Gefühl, dass auch ich meine Art von Rückzug antreten muss, aber in der widerständigen Materie einer sozialen Denkwelt, deren Besseres niemals preisgegeben werden darf.
Valerij Podorogas Interesse für die Ästhetik des Schreckens – Bohrer wäre sein Gesprächspartner. Ich verstehe nur vage und per analogiam, warum dieses Thema, und warum so? Ich müsste seinen archimedischen Interessenspunkt suchen, um ihn durch Kritik zu verstehen. Variante des Gefühls der Ohnmacht im Verhältnis von Diskursformationen: nicht kritisieren zu können. Hermeneutischer Stierkampf. Vorm Untergehen suche ich mich zu retten, indem ich mitten im unverstandenen Vortrag Notizbuch führe – wie früher im Café. Die anderen mögen denken, ich schriebe mit. So trage ich bei zum Seminarbluff.
Merab bricht in den hermetischen Diskurs durch Vergleiche ein, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Behandlung des Auges bei Eisenstein im Unterschied zu Buñuels Chien andalou.
Valerij fasziniert von Hitlers Megalomanie, der phantasmatischen Architektur, den Plätzen, die von der Masse auszufüllen, die nur in Simulation leben könne. Bei Eisenstein das Schafott in die Inszenierung geschlüpft.
Fred Jameson versucht, seinen westmarxistischen Diskurs anzuknüpfen, spricht von der unaufhebbaren Spannung zwischen Freud und Marx, von der Frage, ob Gewalt aus der Kindheit oder aus der gesellschaftlichen Umgebung komme, aber das bleibt äußerlich. Podoroga repliziert mit der Produktivität der Gewalt. Jeder von uns, jede Epoche, habe einen eigenen Gewaltstil.
Jameson kann als fast plumper Vertreter gesunden Menschenverstandes ungemein imponieren. Man ahnt das US-Milieu, die Konkurrenzen und Gremien, worin er trotz seines Marxismus seinen Weg gemacht hat.
Die Gruppe »Objektive Philosophie« zieht die Worte Mumie und Simulakrum zu »Mumakrum der Macht« zusammen, und meint damit das Lenin-Mausoleum. Großes Gelächter bei einigen Moskauern. Das inspiriert Merab, einen Witz von 1954 zu erzählen, als Stalin noch neben Lenin im Mausoleum lag. Fragt einer, wer ist das? Antwort: Stalin. Und, auf den einbalsamierten Lenin deutend, wer ist das? Antwort: Stalins Lenin-Orden.
13. Oktober 1990
Boris Groys gehörte zum Freundeskreis von Komar & Melamid (Sots Art). Er sei aus der SU als Marxist weggegangen. Behauptet eine Homologie zwischen Stalin und dem Künstler als diktatorischem Absolutisten totaler Weltrekonstruktion.
Die SU als Konsumentenstaat. Dominanz der Frage, was können wir vom Westen nehmen, nie, was können wir geben.
14. Oktober 1990, Sonntag
In der International Herald Tribune von vorgestern ein Abgesang von William Pfaff auf Reaganomics und Thatcherismus (»The Economics of Innocence Gets its Comeuppance«, ursprünglich für die Los Angeles Times geschrieben). Nicht der Appell an den Eigennutz sei ihre stärkste Zugkraft gewesen, sondern ihre »Unschuld«, ihr »Rousseauismus«: die gute Natur korrumpiert durch menschliche Einmischung … Pfaff reflektiert nicht darüber, dass hier unter »Natur« das Gewimmel menschlichen Wirtschaftshandelns gedacht wird, während »der Mensch« für den intervenierenden Staat steht. Diese Eigentümlichkeit zu analysieren, würde den Diskurs zu weit führen. Er will ja nicht auch nur den Schatten eines Zweifels auf die kapitalistische Wirtschaftsform werfen, sondern innerhalb derselben eine etwas andere Wirtschaftspolitik. Das Ende der Reaganomics sei vergangenen Freitag gekommen, als George Bush »shut down the American government for lack of money to pay to go on«, womit Thatchers Kapitulation vor der deutschen Währungspolitik zusammengefallen sei. In England die Zinsen heute so hoch und der Wirtschaftszustand so schlecht wie damals, als Thatcher zur Macht kam; die Inflation doppelt so hoch wie bei den westeuropäischen Konkurrenten. In den USA war die Illusion geschürt worden, man könne alles haben, ohne zu bezahlen: »Weltführungsrolle, hohe Militärausgaben, Raumforschung, old-age-entitlements, billiges Benzin, Sparkassenbetrug (Savings-and-Loan-Krise), Armeen an den Golf«. Umsonst, weil man glaubte, Steuersenkung würde die Konjunktur anheizen und das Steueraufkommen vergrößern. Der Thatcherismus nicht so naiv. »Er war eine harte Doktrin gnadenloser Privatisierungen, dem Markt überlassend, was immer ihm überlassen werden konnte: Flüge & Züge, Wasser & Strom, Gesundheit, Kunst, Unterhaltung, Bildung, Forschung, die Zukunft der Nation selbst«. Gewaltsame Operationalisierung von Adam Smith: »Es machte ein Prinzip der theoretischen Ökonomie zu einer operationalen Doktrin.« Annahmen: Effizienz als solche = gesellschaftlich nützlich, ja sogar ethisch gut. Jetzt flottieren die Zinsen für Hypotheken auf Grundbesitz, d.h. die Eigenheimbesitzer müssen bluten. Das geht an den englischen Nerv.
Die Kritik von links hatte immer gelautet: Institutionalisierung und Ausbeutung des Eigennutzes mit dem Effekt, die Reichen reicher und die Armen ärmer zu machen. Pfaff haut sie mit ihren Waffen: sie sind im Grunde vom selben Schlag, aus dem die »Saint-Justs, Lenins und Pol Pots« entspringen. Prima! Nun haben die Kritiker ihr Fett weg, und niemand soll merken, dass Pfaff sich in den Aporien des Kapitalismus herumtreibt.
*
Dragan über die jugoslawischen Verhältnisse: 1000 DM vor einem Jahr noch ein Vermögen, jetzt kaum mehr viel. Die Löhne verdoppelt, aber die Preise verdreifacht. Sieht keine Chance. Eine unproduktive Gesellschaft.
15. Oktober 1990
Merab: Individualität, Diskontinuität, Irreversibilität – postklassische Gesichtspunkte. Nietzsche und Heidegger als Zeitgenossen, Marx der erste, dem der Zweifel dämmerte.
*
Kaum ist die Nachkriegszeit beendet, ist eine neue Vorkriegszeit angebrochen. Die FAZ spielt mit dem Konzept.
Auf dem Korso der Altstadt von Dubrovnik beobachte ich folgende Gebrauchsweise von Jeans: über einem schwarzen Trikot Jeans, denen die Hosenbeine abgerissen sind, und zwar irre weit oben, heiße Höschen: die Trägerin vielleicht 15, mit ihren Freunden flanierend.
*
Valerij Podoroga: Nachdem Ligatschow weg ist, gibt es nur mehr ein letztes Hindernis für die Perestrojka, und das ist Gorbatschow selbst. Ich fragte Merab Mamardaschwili nach seiner Meinung dazu. Er erwiderte, er habe keine, weil Gorbatschow für ihn kein Gegenstand seines Nachdenkens sei – seit 20 Jahren habe er sich geweigert, Politiker auch nur wahrzunehmen. Keiner der Mächtigen soll ihm in der Sonne stehen.
Valerij will mir die Bedeutung von Nikolai Trawkin (Chef der Demokratischen Partei) einschärfen, der viel wichtiger sei als G. Popow. Merab ironisch: Ja, er ist schön exotisch.
Heidegger ist Merab unangenehm, aber fast einziger Zeitgenosse für ihn. Beschreibt ihn als verführt von seiner eigenen Sprachkraft, Poesie, was seinen Gedanken immer zu früh enden lasse. Er selber arbeite an einer Metatheorie des Bewusstseins. Hat soeben ein Buch über Descartes in Druck gegeben.
Was uns auseinanderwirft –
*
Bei Rozarij, wo man den besten frischen Fisch in Dubrovnik bekommt, wird am Nebentisch über den Round Table von Cavtat gesprochen. Ein Amerikaner sagt, er habe einen Brief von Paul Sweezy erhalten.
Im Unterschied zu FH, die für Teile der Frauenbewegung arbeitet und von ihnen getragen wird, keine soziale Bewegung, für die zu arbeiten. – Zu lehren wird mir immer suspekter.
*
Perestrojka. – Die Prawda soll fürchterlich niedergehen. Freund Frolow hat alle gegen sich, die »Konservativen« und die »Liberalen«; die ersten, weil er ihnen Gorbatschows Kurs aufzwingt, die zweiten, weil er keine Ahnung von Journalismus hat. Jetzt soll die Prawda autonom werden. Bin neugierig, wo das Stehaufmännchen wiederkehrt.
Le Monde vom Samstag behauptet, die Japaner seien verbittert, weil nur Deutschland jetzt seine Vergangenheit als besiegtes Land losgeworden sei.
Assad kriegt die pax syriana im Libanon als Gegenleistung für sein Bündnis mit den USA. Ägypten gewarnt durch die Ermordung des zweiten Mannes im Staat. Jameson meinte, auch das Attentat gegen Schäuble sei in diesem Zusammenhang zu sehen. Er machte mich auf den Artikel von Rafic Boustani und Philippe Fargues aufmerksam: »Entre Golfe et Méditerranée« (Le Monde, 13.10.). Klientelisierung der arabischen Welt durch das Petrogeld der Golfregion. Die Ökonomie des arabischen Nahen Ostens, des »Mashrek«, dreht sich seither um die Verwaltung des Einkommens. Der kosmopolitischste Arbeitsmarkt der Welt. Auch darauf hatte Fred geachtet: der Artikel zeigt, dass beide viktimisierte Länder, der Libanon wie Kuweit, eine in der arabischen Welt beispiellos freie Presse gehabt hatten, die nunmehr ausgeschaltet ist. Der König war nackt: die Verschiebung des Gravitationszentrums des Mittelmeers an den Golf hat den Leuten nichts gebracht.
George Bush laut FJ »in freiem Fall«.
15. Oktober 1990 (2)
Mein Vortrag über Jeanskultur hat auf Aluna (vom Philosophie-Institut der moskauer Akademie der Wissenschaft) wie ein Werbespot gewirkt. Sie bekam Lust, stante pede in die Altstadt zu gehen und Jeans zu kaufen. Verlangen nach diesem Imaginären.
Merab sprach von der Unmittelbarkeit der Vergesellschaftung bei Marx, die der künstlichen Welt von Markt und Geld nicht bedürfen soll. Aber wie, fragte er, kommen wir dann in Kontakt mit den anderen?
*
Am Strand gehört, Gorbatschow habe den Nobelpreis erhalten. Merab gesteht zu, dass er diesen verdient habe. Michail Kusnezow, der an der Grenze zum Hanswurst agiert, mit ständigem Kopfnicken mich umdienernd, alle Worte mehrfach hervorstoßend, bis ihnen allmählich die Folgewörter anwachsen – zu G äußert er sich knapp und scharf: da sei keine Kontinuität, nie könne man wissen, was er als nächstes tun werde. »Muss man das?« wirft Merab ein. Er kehrt den Kyniker hervor. Meine Versuche, Herrschaft zu analysieren, buttert er in conditio humana und Gott unter. Wenn ich von einem bestimmten Nichtwissen spreche, wird er unweigerlich sagen: »Hat der Mensch je etwas gewusst?« Mittendrin erwähnt er Foucaults »fürchterlichen Tod« (an AIDS). Will sich ein Reise-Texterfassungsgerät (Sinclair) zu seinem Macintosh anschaffen.
Fred Jameson sagt, binnen 14 Tagen seien die USA zum Krieg bereit.
16. Oktober 1990
Iwailo Ditschew aus Sofia, auf dessen Visitenkarte kurz »Writer« steht und der die Mumakrum-Show mitaufgezogen hat: die »sozialistische« Gesellschaft lässt sich anders als die bürgerliche Gesellschaft mit ihren ausdifferenzierten Organisationen nicht von innen beschreiben.
*
Laut Washington Post hat man in Saudi-Arabien riesige zusätzliche Erdöllager entdeckt, die bis ins 22. Jahrhundert den derzeitigen Ausstoß garantieren sollen. Man hat diese Informationen angesichts der Golfkrise gerade jetzt herausgelassen, zusammen mit der Ankündigung verstärkter Lieferungen. Das wirkt unmittelbar aufs Ölpreisniveau, mittelbar auf die Interessen der Hauptölverbraucher am Ausgang des Golfkonflikts.
Schlanke Produktion. – James P. Womack, Daniel T. Jones & Daniel Roos: The Machine that Changed the World (New York 1991). MIT-Studie über Autoproduktion (1985–90). Überschrift des FAZ-Berichts: »Die in Japan entwickelte Produktionsweise wird die Welt erobern«. Verdrängung der »mass production« durch »lean production« (»lean« bedeutet mager, schlank, entschlackt). Die neue Produktionsweise brauche von fast allem weniger, zumal Arbeit, aber auch Zeit, Lagerbestände, Stückzahl zur Rentabilität. 90 Fabriken in 17 Ländern vergleichend untersucht mit dem Resultat, dass bei VW die Produktivität nur halb so hoch wie bei japanischen Spitzenbetrieben. Veränderte »Industrie-Organisation« als Ausdehnung des Polyzentrismus auf die Zulieferer, die tendenziell wie ein unabhängig arbeitendes Profitcenter im eigenen Verbund aufgefasst werden. Der Informationsaustausch mit ihnen wird »maximiert und nicht minimiert«. Die Zulieferer entwickeln oft die zugelieferten Teile relativ selbständig. Ferner werden horizontale Verbundsysteme (Keiretsu) aus Unternehmen vieler Branchen gebildet, die den Mitgliedern finanzielle Reserven, Sicherheit vor feindlichen Übernahmen, Innovations- und Rationalisierungsimpulse, überhaupt einen Ideenpool, sowie Synergie-Effekte vermitteln. Räumliche Nähe zum Endverbraucher macht es vorteilhaft, in jedem der drei großen Märkte (Nordamerika, Europa, Asien) eigenständige Produktionssysteme aufzubauen. Das verlangt eine »post-nationale« Unternehmenskultur mit Personaltransfer in allen Richtungen und globaler Produkt- und Finanzstrategie. Die Studie kommt zum Schluss, dass sich internationale Keiretsu-Verbünde und Zuliefer-Partnerschaften herausbilden werden. Der transnationale Kapitalismus nimmt Form an. Die Keiretsu modifizieren schon jetzt die Konkurrenz. Einiges an dem Modell könnte bei der Mafia abgeguckt sein.
17. Oktober 1990
Gestern Abend löste ich durch eine Nebenbemerkung einen thematischen Sprung aus. Karen Sjörup über Astrologie: Donnerstags bricht das Telefonnetz im Roskilde Universitetscenter zusammen, weil es im Horoskopdienst der Post die neuen Ansagen gibt.
Manchmal erscheinen die Lippen wie von innen ausgebissen; bitter und bissig erinnert der Mund an den der Schwarzer. Auf das Scheitern der ersten Frauenbewegung sei die unzufriedenste Frauenbewegung aller Zeiten gefolgt. Sie habe die Söhne als ihre Ersatzmänner behandelt, sie von den Vätern getrennt: Muttersöhne, deren Männlichkeit von Frauen geformt war. Die Töchter seien von ihren Müttern rausagitiert worden aus dem Frauen-(Mutter-)Universum: Bildungserwerb, Selbstverdienerin werden! Frei, ihre eignen Bilder davon zu machen, was eine Frau sein sollte. Verweist auf Dorothy Dinnerstein: The Minotaur and the Mermaid, über inneres Matriarchat in beiden Geschlechtern.
Der Muttersohn unterhalte keine Beziehungen zu anderen Männern, weil nie in Männlichkeit initiiert. Die Institutionen des Patriarchats zusammengebrochen. Nun werde sich ein neues postmodernes Patriarchat bilden.
Laut Slavoj Žižek wird das jugoslawische Imaginäre vom umgekehrten Nullsummenspiel beherrscht: Jede Nation glaube, dass sie in wenigen Jahren in einer Art Schweiz des Wohlstands leben könnte, würden die anderen Nationen ihr nichts wegnehmen.
Žižek in Blue Jeans und dunkelblauem Hemd; knapper gepflegter Vollbart; Schatten unter den Augen. Spricht mit leichtem Sprachfehler, das S gerät leicht zum Sch, dabei schnell wie ein Maschinengewehr, die locker gelassenen Backen und Lippen schüttelnd, immer am Rande des Kasperns, immer mit Witzen Überraschungsangriffe führend. Ich frage mich, an wen mich die Art erinnert, wie er den Kopf herumwirft. Sagt, er sei vor zehn Jahren als Nichtmarxist aus seinem Job geworfen worden, jetzt von derselben Amtsperson als Marxist. Sieht in Slowenien, seiner Heimat, eine neue moralische Mehrheit zurück auf dem Weg zum NS. Sieht das etwa darin angedeutet, dass letzte Woche der Kultusminister den Lehrerinnen das Tragen von Hosen verboten habe.
18. Oktober 1990, am Flughafen von Dubrovnik
Vaclav Havel lobte Gorbatschow als »Beschleuniger des Unausweichlichen«.
Merab. – Der Philosoph – Bürger des unbekannten Landes. Hier lebe er wie ein Spion. Möglichst wenig auffallen. – Das kam mir vor, wie die Beschreibung eines Theologen von Nietzsches »unbekanntem Gotte«. Während des Abschiedsessens summte Merab vor sich hin. Er isolierte sich, wie mir schien, in einer Aura des Selbstgefallens. Man hatte uns, »die zwei Foucaults«, nebeneinander platziert.
Dragans kurzes Lächeln in den Mundwinkeln. Er stellt sich dar als einen, der es nicht nötig hat. Rief mir ein Taxi, rührte indes keinen Finger, als ich mich mit den Gepäckstücken mühte. Etwas von einem Puma, gelassen, mit einer Art von Gleichgültigkeit, die etwas Verächtliches hat. Fred Jameson erschien nicht zum Abschied.
Bin mir selbst im Wege, aneckend-versöhnlich, als wären die Widerhaken falsch angebracht. Schwierigkeit, eine Sprache gegen den Diskurs zu finden. Wieder das Gefühl des Außenseiters.
Dass ich am Wahrheitsbegriff festhalte, kommentierte Jameson mit »bullshit«; er wurde böse, als ich Foucaults Entdeckung der Geschichtlichkeit des Sexualitätsbegriffs rühmte, die er eine Erfindung (im Sinne von Fiktion) genannt haben wollte. Die Psychoanalyse-Anhänger hatten anscheinend das Gefühl, es werde am Ast gesägt, den sie als Sitzplatz schätzen. Dabei hatte ich nur gesagt, sie müssten auf ihr »natürliches« Maß schrumpfen, d.h. auf die Situation und den Prozess therapeutischer Analyse.
Ideologie – das sind die andern! Darauf achten, wo ich dieses Muster gleichfalls bediene.
Auch »Wissenschaft« wurde fallengelassen. Alles Kunst? Schlimmer: alles Material für Diskurse.
Fred hat als neuestes Paradigma Reichelts Kapitallogik entdeckt. Susan Buck-Morss verschwimmend. Wo sie eingreift, ist sie mir zugänglicher, so dass ich immer wieder in der Diskussion ihren Gedanken weiterführte, was allerdings nicht erwidert wurde. Mit Grausen sehe ich einiges für mich voraus.
18. Oktober 1990 (2), unterwegs
Günter Matthes schreibt im Tagesspiegel den erstaunlich einsichtigen Satz: »Dass Marx und Lenin das Scheitern ihrer Ideologie überleben, wissen wir.« Es geht um Denkmäler.
*
Proton ein »vibrierendes Bündel aus drei Quarks, 2 up und ein down Quark«. Inzwischen glaubt man, 6 Quarks zu kennen: Charm, Strange, Top, Bottom, Up, Down. (Comic strip-Sprache). Diese sollen mit den sogenannten Leptonen die gesamte Materie aufbauen. Das Wort Quark soll Gell-Mann aus Joyce, Finnegan’s Wake, übernommen haben (»Drei Quarks für Muster Mark.«).
*
Mörikes Maler Nolten. –Es beginnt mit einer Bildbeschreibung, von der man allmählich verstehen wird, dass sie die fatale Verschlingung der Neigungen vorwegnimmt, die der Roman entfalten wird: Auf offener See in einem Kahn ein derber Satyr mit einem schönen Knaben, den er soeben einer verliebten Nymphe gewaltsam überliefert … Man »vergisst das Ungeheuer über der Schönheit des menschlichen Teils«. – Verknotung: obgleich der Satyr »der Nymphe durch den Raub und die Herbeischaffung des herrlichen Lieblings einen Dienst erweisen wollte, so straft ihn jetzt die heftigste Liebe zu ihr mit unverhoffter Eifersucht«. – Satyr: Seine »muskulöse Figur steht […] seitwärts […] überragt die übrigen. Eine stumme Leidenschaft spricht aus seinen Zügen«. – Ambivalenz: Er möchte sich […] abkehren, allein er zwingt sich zu ruhiger Betrachtung, er sucht einen bittern Genuss darin.« – Ambivalenz des Knaben: Er »beugt sich angstvoll zurück und streckt, doch unwillkürlich, einen Arm entgegen« – fast entflieht ihm »das leichte, nur noch über die Schultern geschlungene Tuch«. – Nymphe: Sie sucht »mit erhobenen Armen den reizenden Gegenstand ihrer Wünsche zu empfangen«.
Ineinander verschachtelte Ambivalenzen: der junge Nolten gegenüber Elsbeth; Quidproquo: der Freund und die Fremde zwischen ihm und seiner Braut.
Bisher: »strebte mit Heftigkeit an mich zu reißen, was mir notwendige Bedingung meines Glücks schien«; – Buße: »bitter«; – Verzicht: »ich habe nun der Welt, habe der Liebe entsagt«; – Sublimation: Liebe »wird ein unvergänglicher Besitz meines Inneren bleiben«, »darf mir nicht mehr angehören, als mir die Wolke angehört, deren Anblick mir eine alte Sehnsucht immer neu erzeugt«; – Philosophie: Große Verluste bringen dem Menschen die höhere Aufgabe seines Wesens nahe […] zu seinem Frieden; – Ästhetische Rekompensation (11): arm-Verlust = reich: »Nichts bleibt mir übrig als die Kunst, aber ganz erfahre ich […] ihren heiligen Wert […] Befreit von der Herzensnot jeder ängstlichen Leidenschaft […] Fast glaub’ ich wieder der Knabe zu sein, der auf des Vaters oberem Boden vor jenem Bilde gekniet«.
Der aufdringliche Knabe, der Modell gestanden hatte: »ein Anteros!«, lautet Noltens anzüglicher Kommentar, einer, der wiederliebt, bei dem man auf Gegenliebe stößt. Der alte Maler Tillsen, in dessen Haus der Bildhauer Raimund einen Raum als Atelier nutzen darf, beschreibt den Jungen so: »Wirklich ein delikates Füllen, schmutzig, jedoch zum Küssen die Gestalt« (2. Buch, 25). Als Raimund seine Verlobte herumgekriegt hat, ihm Modell zu sitzen, wird der Knabe, »Muster« für »einen Amor aus Ton«, entlassen. »Jetzt liegt ihm die aufdringliche Kröte, die sich gar gut gestanden, tagtäglich auf dem Hals, und dass der Junge nicht schon im Hemdchen unters Haus kommt, ist alles.« Hat sogar der »Braut« mit einem Stock aufgelauert.
Larkens: »leidenschaftlich« zu Nolten, dem »Geliebten« (17); dessen Mentor. Pflegt das »gebrochene Liebesverhältnis« Nolten/Agnes, um sich »an der eingebildeten Liebe eines so reinen Wesens« zu freuen. Dazu muss er der Unreine sein mit Sex-Vergangenheit. Selbstmord-Perspektive, Abreise. Er ist gegen den ideologischen Fundamentalismus (er soll Hypochonder wegen früherer Sexualausschweifungen sein, 16): »Wirst insgeheim gegängelt von einem imaginären spiritus familiaris, der in deines Vaters Rumpelkammer spukt.« (12)
Nolten: keine »Diätetik des Enthusiasmus« (14); Kunst kompensiert: »Versuch zu ersetzen, was uns die Wirklichkeit versagt«.
Unerwartet bei Mörike dem Ausdruck Fernsehen begegnet, der eine divinatorische Kraft meint. Höchst sonderbar, was das für die Rezeption bewirkt, wenn ein Ausdruck so stark und fremd eingeholt wird. Ein »Fernsehen nach Zeit und Raum«, »Vorgesicht«, »zweites Gesicht«.
19. Oktober 1990
Frank Heidenreich schickte mir Rainer Lands im Sonntag erschienenen Artikel über meine »Wahrnehmungs-Versuche«. Franks Kommentar zu Land trifft den Punkt: »Er zieht nicht nur gegen eine bestimmte historische Realität des Sozialismus, der sich vom (kapitalistischen) Weltmarktzusammenhang abkoppelte, zu Felde, sondern auch gegen das Vor-Denken einer alternativen ökonomischen Logik«. Land portraitiert mich als Anhänger eines Systembegriffs von »Sozialismus«, obgleich ich mich dagegen in mehreren der Texte ausspreche.
20. Oktober 1990
Ernst Günter Vetter verkündet im Wirtschaftsleitartikel der heutigen FAZ, »dass die politische Kraft der Imperien in der Geschichte auf deren ökonomischer Leistungsfähigkeit beruhte. Sie zerfielen, wenn ihre Wirtschaft erlahmte. Die Auflösung der russischen Weltmacht ist das aktuellste Beispiel für diese These.« So begünstigt diese Zeit einen bürgerlichen Ökonomismus. Freilich zieht das die Frage nach sich, ob in Gestalt der Wirtschaftskraft der BRD, die sich kraft Einverleibung der DDR und Hegemonisierung Mittel- und Osteuropas derzeit potenziert, sich am Ende »eine Basis für eine neue Macht imperialen Ausmaßes« bildet. Denn ohne Zweifel wird die BRD »zu einem ökonomischen Kraftzentrum in Europa«. Er denkt wohl (wie ich): zum stärksten und folglich hegemonialen Zentrum. Er lässt François Furet sagen: »die wirtschaftliche Logik, die heute die Machtverhältnisse bestimmt, ist kaum beruhigender als die militärische«. Um die andern Westeuropäer zu beruhigen, wechselt er das Terrain von der Ökonomie als Basis für imperialistische Politik zur Stimmungslage der Leute: »Die Deutschen träumen von Wohlstand – nicht von der Größe.«