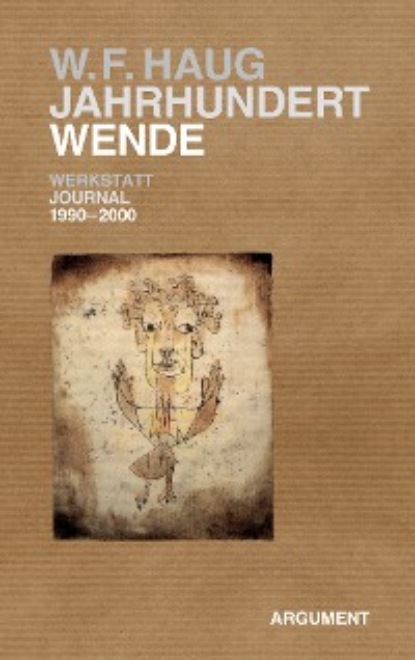- -
- 100%
- +
22. Oktober 1990
Enrique Curiel, bis vor wenigen Jahren stellvertretender Vorsitzender der KP Spaniens, erklärte: »Die von Lenin begonnene Reise ist jetzt endgültig zu Ende.« Gemeinsam mit 200 anderen trat er der Spanischen Sozialdemokratie (PSOE) bei.
Auf der Suche nach einem Motto für die nächste Volksuni: Rückwärts in die Zukunft. Oder: Verzweifelte Hoffnung Deutschland. Oder: Deutschland, Deutschland unter anderen.
*
Helmut Dubiel (»Die demokratische Frage«, in: Blätter, 4/90): Dem affirmativen Institutionalismus setzten die Linken Anti-Institutionalismus entgegen. So fehle es an Demokratietheorie. Jede Mediatisierung des »Willens des Volkes« werde von den Linken gewohnheitsmäßig abgelehnt. – Falsche Kategorie, rousseauistischer Zungenschlag in diesem doppelten Singular: der (eine) Wille des (einigen) Volkes, statt Cluster oder Assoziation oder wie immer von Willen der Bevölkerung. – Linke Staatstheorie sieht Dubiel »zwischen Herrschaftsdämonisierung und politischer Romantik« (411ff). Er trifft etwas, zum Beispiel auch beim Projekt Ideologie-Theorie. Aber er kippt dann doch zu sehr in die affirmative Grauzone (besser: rosa Zone).
Claude Lefort bestimmt in Anlehnung an Hannah Ahrendt das »symbolische Dispositiv der Demokratie«: 1. radikaler Abbau transzendenter Rechtfertigung politischer Herrschaft, die vollends entzaubert wird; 2. »alle Themen zulässige Streitgegenstände im öffentlichen Diskurs« (das heißt in einem »sozial unabgeschlossenen Diskurs«); 3. Artikulation der realen Vielfalt muss möglich sein. Erst dann lässt sich von Zivilgesellschaft sprechen: »Assoziation von Bürgern, die sich nicht mehr als eine fest gegliederte, historisch abgeschlossene quasi körperhafte Einheit erfährt, sondern buchstäblich als ein zur Zukunft hin offenes ›politisches Projekt‹, das die Bedingungen seiner eigenen Programmierung ständig zur öffentlichen Disposition stellt.« (417f) Dubiel sieht diesen Impuls in der osteuropäischen Umwälzung am Werk. Terminologie: »nur ein Dispositiv« bedeutet bei ihm: »ermöglichende Struktur« (418). Dagegen steht »Flucht in vordemokratische Einheitssymbolisierungen wie ›Volk‹ oder ›Nation‹«.
Was Dubiel nicht weiß (oder unterschlägt), ist die Tatsache, dass im Projekt eines »Pluralen Marxismus« seit einem guten Jahrzehnt solche Aspekte zunehmend deutlich in marxistisches Denken eingearbeitet werden, freilich eingebettet in eine viel komplexere Wirklichkeitsanalyse. Für ihn scheint Herrschaft vor allem ein Seminarthema.
*
Zivilgesellschaft. – »Zivile Gesellschaft« bestimmt Volker Gransow als »Entstaatlichung von Gesellschaft als Ziel und Prozess. Das bedeutet nicht ›Absterben des Staates‹, sondern einen staatlich garantierten Bereich individueller Freiheiten und autonomer Sozialbeziehungen.« (»Bocksprung in die Zivile Gesellschaft?«, in: Blätter …, 12/89) Merkwürdigerweise sieht er dergleichen schon bei Aristoteles. »Die Neudiskussion des von Aristoteles bis Gramsci bekannten Begriffs begann als Reaktion auf die entstehende autonome Organisation von Teilen der polnischen Gesellschaft um 1980. Es ist möglich, dass ›Zivile Gesellschaft‹ zum Schlüsselbegriff einer neuen Kritischen Theorie wird, weil hier wichtige Elemente sowohl der radikalen Demokratie wie des Sozialismus ›aufgehoben‹ werden.« (1443) Verweist auf Andrew Arato, »Civil Society, History & Socialism«, in: Praxis International, 1/2, 1989.
23. Oktober 1990
Die Jugendlichen aus der DDR stolzer, Deutsche zu sein, als die gleichaltrigen Westdeutschen.
Mathias Schreiber (in der FAZ vom 19.10.) über die »Namensnot« beim Reden über das, was bislang DDR hieß. Dieses Zeichen, DDR, erklärt er für »ein eklig belastetes Stasi-Propagandakürzel«. So mimetisiert der feine Herr Ästhet eine Wut von unten. Manche sprechen jetzt von den »fünf neuen Bundesländern« oder einfach von den »fünf neuen Ländern«. »Ost-Deutschland« lehnt er ab, weil dieses Namenlose die Mitte sei. Die Bundespost nennt die DDR »VGO« (heißt das »Verwaltungs-Gebiet Ost«?), lässt aber sicherheitshalber auch »DDR« auf die Säcke schreiben. In unserem Reichelt-Supermarkt hängen Schilder an den Kassen, die einem mitteilen, dass DDR-Münzen bis 50 Pfennig »nur in der DDR gelten«, daraus entnehme ich, dass es, wo’s ums Geld geht, die DDR noch gibt.
In der Hauptstadtfrage droht der FAZ-Herausgeber Fack den Berlinern an, falls sie wieder mehrheitlich rot-grün wählen, »wird Bonn das Rennen machen« (19.10.).
In Moskau stellte vergangene Woche Abel Aganbegjan Gorbatschows Wirtschaftsprogramm vor. G sei tatsächlich »der Hauptautor des Dokumentes«; er habe mehrere Tage daran gearbeitet, und »jeder Punkt wurde mit ihm abgesprochen«. Laut TASS ist es nun klar: »Es wird keinen Kapitalismus in der UdSSR geben.« Die einzelnen Republiken sollen über das Tempo der Durchführung entscheiden sowie über »Sein oder Nichtsein« des Privateigentums an Boden.
Die Hass-Reaktion habe ich ja in Dubrovnik zu spüren bekommen, etwa aus dem Munde von Valerij Podoroga. In Moskau gründete sich jetzt eine »Demokratische Union« als antisozialistische Sammlungsbewegung.
Bourgeoise Ausbeutungskritik. – Nach dem Sturz des ›realsozialistischen‹ Sicherheitsstaats eröffnet Ernst-Otto Maetzke in der FAZ (19.10.) eine neue Front, die er, den Sozialismus beerbend, als Front des Kampfes gegen Ausbeutung artikuliert: »Nicht mehr die Herrschenden saugen den Bürger aus, […] sondern die Bürger erwürgen den Staat mit Ansprüchen.« Diese Gefahr malt er als tödlich: »Der realexistierende Sozialismus ist untergegangen; die realexistierende Demokratie ist nicht davor gefeit«. Anlass für das Alarmgeschrei ist, dass die Reichen mehr Steuern zahlen sollen. Die Haushaltskrise in den USA und der Generalstreik in Griechenland dienen als Demonstrationsobjekte.
*
Nicht vergessen: Die Zensurgeschichte, die mir Wladimir in Dubrovnik erzählt hat. Als er die Fernseh-Diskussion »Marx-Lenin-Gorbatschow« übersetzt hatte, veranlasste Frolow die Streichung eines einzigen Satzes, und zwar einer Äußerung von mir: Als Nelly Motroschilowa mir vorgehalten hatte, es sei schade, dass ich die sowjetische Philosophie-Literatur in den »Woprossy« nicht verfolgt habe, sagte ich: »Das war, als müsste man in einem Heuhaufen nach einer Stecknadel suchen.« Anscheinend fühlte er sich mit-gemeint.
25. Oktober 1990 – Flug nach München
Die PAN-AM, der Quasimonopolist im Westberlin-Flugverkehr einer ganzen Epoche, kapituliert vor der Lufthansa, und das Witzige ist, dass das zusammenhängt mit der Kapitulation der DDR vor der Bundesrepublik.
Seit dem Ende des Kalten Krieges (der Systemkonkurrenz) führen die USA Kriege in Granada, Libyen, Irak – alles unbotmäßige Drittweltländer.
Peter Glotzens Kommentar, als Achim ihm bei der Frankfurter Buchmesse mein Perestrojka-Journal in die Hand gedrückt hatte und er den Titel (Versuch, beim täglichen Verlieren des Bodens unter den Füßen neuen Grund zu gewinnen) gelesen hatte: »Das macht der Haug doch seit dreißig Jahren.«
Merkwürdig, dass es in München wie in Berlin kaum Hochhäuser gibt, was doch heute die meisten Drittweltstädte haben. Vielleicht hängt das mit der größeren Solidität des deutschen Kapitalismus zusammen, wie ein Gleichnis für breite Bodenständigkeit.
26. Oktober 1990 – Abflug von München
Im Pschorr-Keller auf Einladung eines Bildungskreises aus dem DKPUmfeld aus dem Perestrojka-Journal gelesen. Es lief nicht schlecht, obwohl die Diskussion zur politischen Diskussion wurde. Nur Horst Holzer, bis zur Ruben-Affäre im Umkreis Buhrs, schien zu verstehen, dass nicht allein theoretische These und politischer Leitartikel unserer derzeitigen Situation angemessen sind, sondern dass auch ins Traumhafte übergehende Beschreibungen eine unentbehrliche Möglichkeit bieten, gewisse »Zwischenlagen« auszudrücken. Holzer lebt übrigens seit Jahren von Medienforschung für den Bayrischen Rundfunk. Aus der akademischen Lehre ist er längst ausgeschieden. Als Gegenleistung für sein freiwilliges Verlassen der Universität verzichtete der Staat auf die Rückforderung von zehn Jahren Gehalt.
Meine Gastgeber Brigitte und Leo Mayer wohnen in einem Siedlungsvorort des münchener Ostens, umschlossen von Industrie- und Gewerbegebieten. Das Haus ein Schmuckkästchen. Ich frage mich, wer es sauber hält. Brigitte ist Buchhalterin in einer kleinen Druckerei, Leo Ingenieur bei Siemens. Die Kinder schon außer Haus. Ich schlief im Zimmer des Sohnes, der Elektro- oder Fernmeldeingenieur studiert und bei Siemens Praktikum gemacht hat. Computerspiele, die ihn süchtig machten: das sowjetische eine Art Puzzle, wo es darum geht, aus abstrakten Figuren eine Mauer zu bauen. Um sich der Versuchung zu entledigen, formatierte (löschte) er kurzerhand alle Spieldisketten. »Es kommt mir keine mehr ins Haus.« Die Simulationen erfuhr er als Raub an Handlungsfähigkeit.
Brigitte und Leo haben übrigens als Modelle gedient für eine Werbekampagne der IG Metall. Sie sind das Musterpaar, das ich schon in Inseraten gesehen habe. Man hat sie mit zwei (fremden) Kindern, 7 und 10, professionellen Fotomodellen, ausgestattet. Nur das Künstliche sieht heutzutage wirklich natürlich aus.
Ich höre von Spannungen zwischen Linker Liste und PDS. Die LL »wird es nicht bringen«, sagt man mir.
*
Bildersturm. – F. K. Fromme im heutigen FAZ-Leitartikel: Der Marx-Kopf in Chemnitz »muss schon aus ästhetischen Gründen weichen. Man könnte sogar sagen: aus Respekt vor dem Philosophen, der in einem nicht kleinen Teil der Welt Rechtfertigungen für Herrschaft hergegeben hat. Auch Lenin-Denkmäler aber verdienen ihren Platz nicht mehr. Sie bedeuten eine Verherrlichung des Terrors«. Als »Auswuchs« müsse auch der Name »Ho-Chi-Minh-Straße« beseitigt werden. Frankfurter Machiavellismus: »Die Symbole der alten SED wegzubringen, ist geboten. […] Mit dem Fall der Symbole vollendet sich der Absturz von der Macht.«
Einem Nebukadnezar-Regime, einer altasiatischen Despotie gleichend, aber zugleich ein soziales Modernisierungsregime mit Marxismus-Leninismus als weltlicher Religion.
26. Oktober 1990 (2)
Staat und Wirtschaft, ineinandergreifend. – Der »Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände«, also einer der korporativen Sprecher der BRD-Kapitalisten, rief dieselben auf, sich über die Staatsagentur (»Treuhand«) in die Leitungsebene der DDR-Ökonomie einsetzen zu lassen: »Gehen Sie in die Aufsichtsräte oder, wenn möglich, in die Geschäftsführungen der Ost-Unternehmen, oder senden Sie fähige Mitarbeiter dorthin!«
Konrad Adam schreibt Engels die Lehre zu: »Die Familie wird aufgelöst, das Eigentum verboten, der Staat stirbt ab«. »Engels’ Antipode« Hajek behalte recht: Familie & Eigentum als Grundfesten des Staates. Adam riskiert den Satz, dass »der Versuch, Krankenhäuser, Schulhäuser und Elternhäuser betriebswirtschaftlich zu taxieren, zwangsläufig in die […] Barbarei führen muss«. Verrückterweise ist das gegen den Sozialstaat, nicht gegen den Thatcherismus gemünzt. Denn ohne meine Auslassung heißt es: »zwangsläufig in die Irre sozialstaatlicher Barbarei führen muss«.
27. Oktober 1990
Heute Gorbatschows Wirtschaftsreformplan erhalten. Das Dokument beginnt: »Es gibt keine Alternative zum Übergang zur Marktwirtschaft.« Das »Ziel besteht darin, eine sozial orientierte Wirtschaft aufzubauen, die gesamte Produktion nach den Interessen des Konsumenten auszurichten, den Warenmangel und die Schmach des Schlangestehens zu überwinden, die wirtschaftliche Freiheit der Bürger tatsächlich zu sichern, Bedingungen für die Förderung des Fleißes, der Kreativität, der Initiative und der hohen Produktivität herbeizuführen.« Ob Spätere einmal das Schweigen mithören und die Euphemismen erkennen werden?
Aus Halle schreibt André Gursky, an der dortigen Uni würden Westberliner (er nennt Christian Fenner) zur Zeit den Ton angeben und sich »als ›Besatzer‹, in gewisser ›Siegerpose‹ und teilweise arrogant geben«. Ab kommenden Montag wird André in Darmstadt vielleicht doch ein liberalkritischeres Klima erfahren. Bin neugierig auf seinen Bericht.
Die »Scientology Church« preist in der ehemaligen DDR groß ihr »Reinigungsprogramm« an.
28. Oktober 1990
Gregor Gysi umhergeschleudert im Zusammenwirken von (alten?) Kräften aus der PDS und den Vernichtungsstrategien, denen die PDS von rechts ausgesetzt ist. Das riesige Vermögen wird, vom Gegner populistisch genutzt, zum Unvermögen der PDS.
Die Ungarn erregen das Missvergnügen der FAZ, weil sie »ganz unmarktwirtschaftlich jede Preissteigerung zu einem Drama« machen. »Markt« für die FAZ etwas Quasi-Religiöses, daher »unmarktwirtschaftlich« zu sein ein bedenklicher Charakterfehler. Führe zu einer »Anspruchsgesellschaft«. »Die Ungarn waren schon immer anspruchsvoll. Was sie früher gehindert hat, die kommunistische Herrschaft ergeben hinzunehmen […], droht nun unter demokratischen Umständen den Erfolg zu gefährden.« – Anlass war die Heraufsetzung der Benzinpreise um 60 Prozent.
Die FAZ druckt eine Rede Dmitri Lichatschows über »die Mission der russischen Kultur in der modernen Welt«. Die Russen, sagt dieser, sind innerlich polarisiert, sie leben und sterben für eine Vergangenheit oder für eine Zukunft, sind aber ohne Gegenwart. Das gelte fürs Volk wie für die Intellektuellen. »Die russische Literatur zerquetscht die Gegenwart zwischen Vergangenheit und Zukunft.«
29. Oktober 1990
Die SU wertet kraft Verordnung von Gorbatschow den Rubel ab und räumt ausländischem Kapital auch ohne die bislang geforderte sowjetische Beteiligung die Wirkungsmöglichkeit ein. Wjatscheslaw Kostikow schreibt in einem Kommentar in »Sowjetunion heute«: »Somit ist die Frage, ob die jetzige Generation der Sowjetbürger vielleicht im Kapitalismus leben wird, keineswegs gegenstandslos. […] Die akzeptabelste Bezeichnung für die Gesellschaft, die unter großen Qualen aus den Ruinen des sowjetischen Totalitarismus erwächst, wäre sicherlich Rechtsstaat. […] Der Sozialismus als hohes humanistisches Ideal existiert und wird existieren.« – Er wird in die Transzendenz verbannt. Das Diesseits liefert sich dem Kapitalismus aus.
30. Oktober 1990
In der SU scheint die Rede von der »Auflösung des letzten Imperiums« eine Art von Realität zu erhalten. Jede erdenkliche ethnisch-linguistische Unterscheidung wird nun zum Titel national-staatlicher Verselbständigung. Die Not des Nicht-mehr-und-noch-nicht führt zum Rette-sich-wer-kann. Dabei fragt sich jeder, wann und wie die militärische Zwangsgewalt auf den Plan tritt. Gorbatschow vor dem Dilemma, unabkömmlich zu sein und wegzumüssen, um Kredite zu beschaffen.
Lew Kopelew hat gestern in Köln gesagt, ein totaler Zusammenbruch Russlands »wäre verderblicher als tausende Tschernobyl-Katastrophen und würde verderblicher für alle Völker in Ost und West auf dem ganzen Planeten sein«. Der praktische Sinn dieser apokalyptischen Warnung ist es, Hilfe fürs Überstehen dieses Winters zu mobilisieren.
Die FAZ (Jens Jessen) beschreibt das Schicksal, das die neue »Normalität« den deutschen Schriftstellern bereitet: »Die Äußerungen der Autoren, mögen sie noch so polemisch sein, sinken zurück in jenes Stimmengewirr, von dem eine pluralistische Gesellschaft ohnehin beherrscht wird.« Soll heißen: das in einer pluralistischen Gesellschaft herrscht, die ohnehin hinterrücks beherrscht wird.
*
Mörike, Maler Nolten. – Ich staune beim Wiederlesen, wie wenig mir früher die sonderbare Behandlung der Geschlechterverhältnisse und der »Liebe« zwischen Männern aufgefallen ist. Larkens redet den Maler an mit »Liebling meiner Seele« (II.30). Danach arg idyllisch bei Agnes. Die Volker-Geschichte: er wollte nichts von Frauen wissen, wie seine Mutter einst nichts von Männern: der Wind hat ihn mit ihr gezeugt (77). Der Präsident, der mit seiner Frau eine Hassbeziehung unterhält, fragt sich, »warum jenes namenlose Weh, das alle Mannheit, alle Lust und Kraft der Seele bald bänglich schmelzend untergräbt, bald zornig aus den Grenzen treibt, warum doch jene Heimatlosigkeit des Geistes […] das Erbteil herrlicher Naturen sein muss?« Dann verabschiedet er sich von Nolten mit den Worten: »Schlafen Sie wohl! Lieben Sie mich!« (115) – Die »Bildung« bei Mörike als Quer-Ordnung geschildert, weil sie Stützpunkte unter den Reichen hält. Larkens geht unter Handwerker (Arbeiter), ja, er geht ins Proletariat. Dort zu leben, ist wie eine Verkleidung. Aber warum bringt er sich um? – Auch die Frauen merkwürdig umgetrieben: Margots Leidenschaft für Agnes. Elsbeth: durch Nacht und Dornen »keuchte sehnende Liebe«. Das Liebesverlangen bringt die Menschen fatal überkreuz. »Das Unerträgliche, das Fürchterliche dabei ist, dass hier weder Vernunft noch Gewalt etwas tun können.« (161)
31. Oktober 1990
In der FAZ die Rede von »jener Entente zwischen den traditionellen deutschen Machteliten und der nationalsozialistischen Bewegung, auf deren Grundlage das Kabinett Papen-Schleicher am 30. Januar 1933 zur politischen Macht gekommen war« (Reinhold Brender, der sich vermutlich verschreibt beim Zitieren aus Ulrich Heinemanns Buch über den Grafen von der Schulenburg). So wünschen sie sich rückblickend die Geschichte, frei nach dem Motto alles für das Volk, nichts durch das Volk, dem Motto, das von der Schulenburg bereits am 1. Februar 1932 in die NSDAP eintreten ließ.
Hans D. Barbier beruhigt im FAZ-Leitartikel die wegen der hochschnellenden Staatsverschuldung beunruhigten Bürger. »Der Zins ist sozusagen die Brücke zur Zukunft. Wenn morgen mit Sicherheit der Weltuntergang zu erwarten wäre, dann brächen alle Zinssätze auf Null zusammen.« Hübsche Modellannahme. Vielleicht umgekehrt: die Zinsen sprängen hoch, da niemand mehr Geld herleihen, sondern es verjubeln würde.
Die SPD scheint die bevorstehenden Wahlen schon verloren zu haben. Kohl hatte das Glück, dass die DDR-Mehrheit auf »Wiedervereinigung« drängte und die internationale politische Konstellation deren Verwirklichung erlaubte. Er tat das Seine, den Zusammenbruch der DDR zu beschleunigen, und ist jetzt im Wort, die große Suppe auslöffelbar zu machen. Verständlich, dass die Leute an ihm festhalten. Ohne dieses »historische« – das heißt paradoxerweise: ohne großes Zutun in den Schoß gefallene – Geschenk hätte er vermutlich die Wahl an Lafontaine verloren. Diesem blieb jetzt nur die Rolle des Warners, dessen, der trotz Vorbehalten nicht dagegen sein konnte.
Die Vorwürfe an die PDS werden immer feiner. Jetzt beschwert man sich, dass sie bei ihrer Vermögensaufstellung die Grundstückspreise vom Ende letzten Jahres zugrunde gelegt habe, statt die jüngste Bodenspekulation zu berücksichtigen.
Die westeuropäische Integration hat nicht nur Mittel- und Osteuropa in ihr Kraftfeld gerissen und zunächst jede eigenständige Wirtschaftspolitik desartikuliert, sondern sie hat auch wieder andere abgekoppelt. So Neuseeland, das sich als Land ohne Zukunft fühlen soll, seit sein Lammfleisch an den Zollschranken der EG hängenbleibt. Hoffnungslosigkeit hat sich breitgemacht, und viele denken an Auswanderung. In ebendieses Land hat Yuri seine ganzen Hoffnungen investiert.
*
Von APN erhielt ich das Dokument »Hauptrichtungen zur Stabilisierung der Volkswirtschaft und des Übergangs zur Marktwirtschaft«. Marktwirtschaft ohne den Zusatz »sozialistisch«, nicht einmal mehr »sozial«. Dementsprechend »Entstaatlichung und Privatisierung des Eigentums«, Ausschluss also anderer Formen von Entstaatlichung? Der Kompromisscharakter kommt in einem der aufweichenden Zusätze zum Ausdruck: »Unter der Privatisierung ist dabei nicht unbedingt ein Übergang zum Privateigentum, sondern ein allgemeiner Prozess des Wechsels des Eigentümers durch Übergabe oder Verkauf des Staatseigentums […] an Kollektive, Kooperativen, Aktiengesellschaften, ausländische Firmen und Privatpersonen zu verstehen.« Faul! Und noch immer ein »staatliches Kontraktsystem« als Korsett der Wirtschaft. Auch soll »ein Verzeichnis der Tätigkeitsarten bestätigt werden, die verboten oder ein Staatsmonopol oder nur nach dem Erhalt einer staatlichen Lizenz zulässig sind«.
Für die dritte Phase ist die Bildung des Wohnungsmarktes vorgesehen. »Sie wird gestatten, eine besonders wichtige Ware in den Umsatz einzuschalten, die dazu angetan ist, einen beträchtlichen Teil der kaufkräftigen Nachfrage der Bevölkerung zu absorbieren und derart zum Gleichgewicht auf dem Verbrauchermarkt und zur Stimulierung der Arbeitsaktivität beizutragen.«
Merkwürdig, dass in der vierten Phase, in der es darum gehen soll, »den Marktmechanismus auf vollen Touren laufen zu lassen«, noch immer die Schattenwirtschaft »verstärkt« bekämpft werden soll. Der Abschnitt zur Bodenreform klammert die Eigentumsfrage aus, spricht von »einer Wirtschaft mit mehreren ökonomischen Formationen im Agrarbereich«. Am Schluss ist dann von einer »sozial orientierten Marktwirtschaft« die Rede. Keinerlei realutopisches Potenzial. Die weiße Flagge ist gehisst.
1. November 1990
André Gursky rief an aus Darmstadt: Er staunt über liberale Eigen-Sinnigkeit und kritische Haltung bei den gastgebenden Professoren (Schumann und Böhme). In Halle dagegen walten Kommissare einer Gleichschaltung, die sich als Reeducation à la 1945 geriert. Ich rate André, sich mit Helmut Dubiel und dem Institut für Sozialforschung ins Benehmen zu setzen und den Anschluss an die Diskussion über zivilgesellschaftliche Demokratie zu suchen.
2. November 1990
In der Sowjetunion herrscht die Logik des Zerfalls. Russland tritt de facto aus; zugleich desintegriert es sich selbst. In Moldawien haben die Gagausen ein Parlament gewählt, geschützt vor der Bevölkerungsmehrheit durch Sowjettruppen. Gorbatschow hat Studenten im Kreml empfangen und vier Stunden mit ihnen diskutiert. Bald werde die neue Ordnung auftauchen. Ich, der ich zur Zeit für ein Seminar über die Spätantike lese, entdecke überall Parallelen. Auf »Vernunft« nicht zu bauen, solange die »mechanischen« Bewegungen die Sache auseinandertreiben. Man muss also sehen, wie diese »Mechanik« der Verhältnisse sich entwickelt und welche Eindrücke sie morgen auf die Bevölkerungen machen wird. Gestern hat die russische Republik Jelzins 500-Tage-Plan des Übergangs zu Marktwirtschaft und der Privatisierung in Kraft gesetzt.
In Deutschland spricht sich Thomas Ebermann in einer Wahlbroschüre der »Linken Liste/PDS« für Wahlboykott aus. Er arbeite »am Aufbau einer linksradikalen Kristallisationsbewegung«, und »über die Volksmassen sollte man sich nie Illusionen machen«. Die »Linke Liste/PDS« »verkörpert eigentlich all das, weswegen ich die Grünen verlassen habe«. Jan Feddersen, der das Gespräch geführt hat, sagt merkwürdigerweise von Antje Vollmer und ihrer Richtung, dass sie »sich heute als Protagonisten einer alternativen Weltpolizeikultur verstehen – gegen die Kritiker einer Verparlamentarisierung. – Die Broschüre, die »Streitschrift« heißt, wirkt schwach auf uns, und das Motto auf der Rückseite demotivierend: »Alle wollen regieren. Wir nicht.«
3. November 1990
Nachdem Gorbatschow aus Spanien dankend 40 Mio Zigaretten als Gastgeschenk mitnahm, hat die sowjetische Regierung das Tausendfache in der BRD bestellt, um im bevorstehenden Winter, der schrecklich zu werden verspricht, eine explosive Reibungsfläche weniger zu haben. Das ist in etwa der Verbrauch eines Monats.
Mit Frigga nach Ostberlin zu einer Konferenz »Krise des Sozialismus«, zu der die Stiftung Gesellschaftsanalyse, Nachfolgerin der alten Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, eingeladen hatte. Im Haus am Köllnischen Park, das als Mitveranstalter fungierte, wusste man nichts von der Tagung. So nutzten wir den plötzlich freigewordenen Samstag für einen ausgiebigen Spaziergang durchs immer noch seltsam fremde Ostberlin, das Anflüge einer schönen Stadt hat, immer wieder denkend, dass wir das jetzige Stadtbild vielleicht zum letzten Mal sähen.