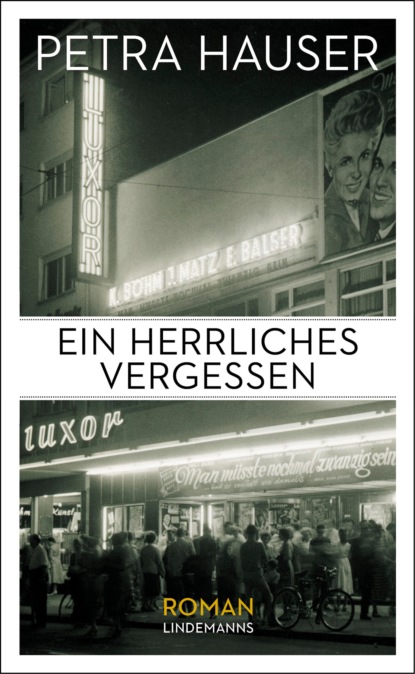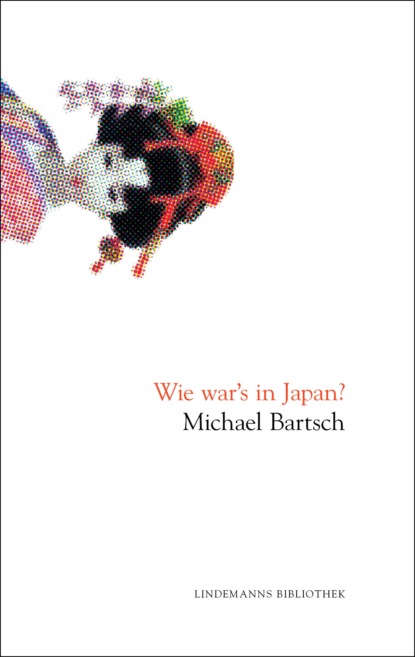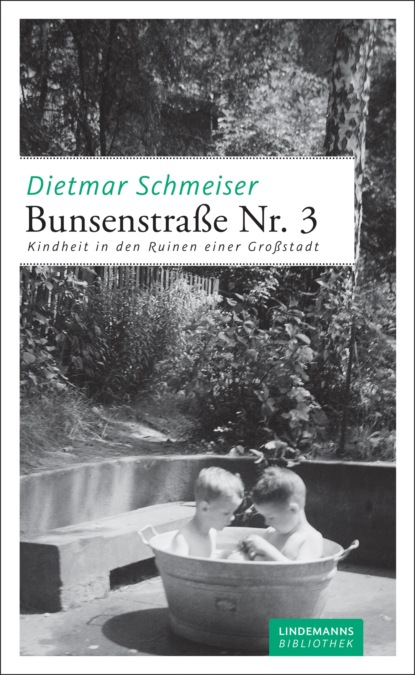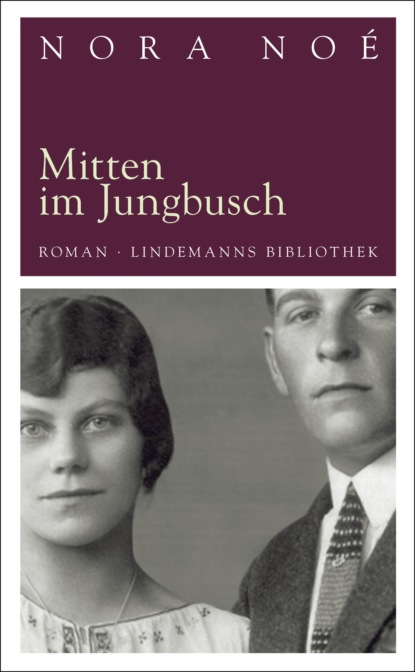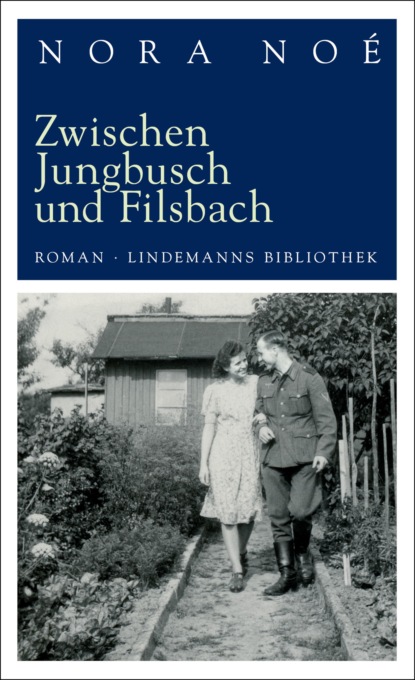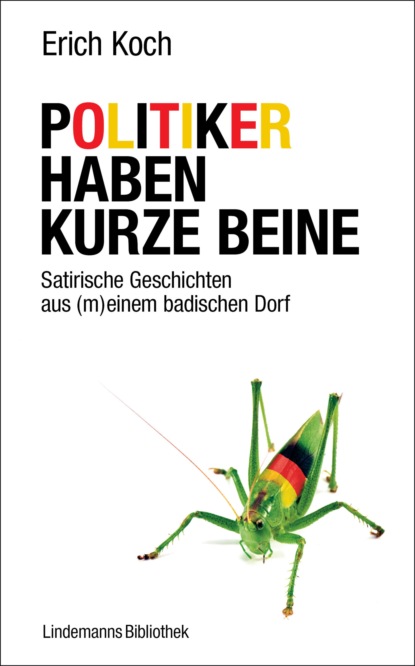- -
- 100%
- +
Das war dann schon später, da hatte sich die Welt schon sehr verändert. Doch noch bevor der Krieg zu Ende ging, bevor Deutschland eine Republik wurde, so wie es Georg sich doch eigentlich immer gewünscht hatte, spürte man in Straßburg Gegenwind. Während Georg und Käthe nun dauerhaft in Badenweiler arbeiteten, hatte sich Mine mit dem Kind zu den Ihren zurückgezogen, kam gerade noch rechtzeitig, um der Mutter bei der Pflege ihres Vaters helfen zu können, den nacheinander drei Schlaganfälle trafen, jeder folgende schwerer als der zuvor und der dritte schließlich so, dass er nur noch ein großer Fleischberg war, der sich mit pfeifenden Atemgeräuschen gegen den Tod stemmte, tagelang, bis der Sensemann schließlich die Spannung aus ihm nahm und die Last von den Schultern seiner Angehörigen.
Kaum hatte man den alten Ponard seiner Heimaterde anvertraut, begann man von seiner Witwe als der „Deutschen“ zu sprechen, tuschelte hinter ihrem Rücken, äffte ihre Sprechweise nach und drehte ihr die kalte Schulter hin. Wie eine ansteckende Krankheit verbreitete sich diese Haltung.
Mine spürte mehr davon als die vor Gram und Trauer gebeugte Mutter. Sie begann zu überlegen, ob der geliebte Heimatort, die schönen Tannen, die Burg auf dem Rift, die Kastanienbäume, die nassen Wiesen in der Senke, ob all das kostbarer wäre als Achtung und freie Luft zum Atmen. Ganz zu schweigen von der Notwendigkeit, das tägliche Brot zu verdienen in diesem vergifteten Klima! Da kam ein Brief aus der Heimat der Mutter den beiden zu Hilfe. Mines Tante Karola beklagte sich darüber, dass ihr die Leitung ihres schönen Gemischtwarenladens in der Meersburger Altstadt zunehmend schwerer falle, seit auch ihr Mann von einem Schlag getroffen und halbseitig gelähmt sei. Da bot Mine in einem kurzen Schreiben ihre und der Mutter Hilfe an und stellte in Aussicht, dass auch ihr Ehemann Friedrich zwei geschickte Hände habe, selbst aus einem Geschäftshaushalt stamme und vorhabe, sich zu verändern.
Der kleine Willi saß derweil hinterm Haus der Ponards bei den Hühnern und bei Chouchou, dem kleinen schwarzen Schnauzerhund, er hatte aus Hölzchen und Steinen ein Gärtchen angelegt, das Chouchou immer wieder mutwillig zerstörte, wenn er ihm hinterherlief und ihn bei seiner Suche nach neuem Baumaterial unterstützen wollte. Chouchou war sein liebster, eigentlich sein einziger Freund und Spielgeselle.
Die Revolution in Berlin, der Matrosenaufstand in Kiel, das Elend der 21 Millionen Kriegsinvaliden, die Tränen der Mütter, Frauen, Schwestern, Töchter, all das scherte den kleinen Buben nicht. Es beunruhigte ihn auch nicht, dass die Menschen, die er alle vier gleich lieb hatte, obwohl sie so unterschiedlich viel Zeit mit ihm verbrachten, ähnlich wie die Herren im Eisenbahnwagen in Compiègne stundenlang hinter verschlossenen Türen redeten und redeten, dabei rote Ohren bekamen und Tränen in die Augen, weil dort sein weiteres Schicksal verhandelt wurde. Käthe litt dabei am meisten. Sie fühlte sich eingeklemmt zwischen der Forderung ihres Mannes, sie an seiner Seite zu haben und ihrem eigenen Bedürfnis, ihrem Kind nah zu sein, das – so viel war auch ihr klar – im Augenblick in der Obhut von Mine besser untergebracht war als irgendwo sonst. Was Käthe im Herzen stecken blieb wie ein vergifteter Pfeil, war die Erkenntnis, dass Georg das Kind „mitlaufen“ lassen wollte.
„Das ergibt sich schon“, behauptete er.
Wie soll sich das ergeben? Ergeben. Ein sprechender Begriff. Sich ergeben heißt, den eigenen Willen aufgeben, ihn beugen unter den der anderen, unter die Umstände, unter etwas, was den sich Ergebenden drücken würde, erdrücken oder zerquetschen könnte.
Wenn man die feinen Hemdchen sah, die Käthe ihrem Sohn selbst genäht hatte, mit aufgesticktem Monogramm, einem geschwungenen W und einem in das W hineinverflochtenen H, wenn man die blank gewichsten dunkelroten Lederstiefelchen sah, die knielangen Samthosen, das schulterlange flachsblonde Haar, man hätte denken können, man habe einen kleinen Prinzen vor sich. Viele Abende verbrachte Käthe sitzend auf ihrem Bett, todmüde, bei jedem Nadelstich dachte sie an den Kleinen und ließ all seine Schlauheiten Revue passieren, die sie in den wenigen Stunden mitbekam, wenn sie ihn besuchte, oder die sie immer wieder aus Mines Briefen herauslas, Wort für Wort. So kam es dazu, dass sie ihn weggab, hinüber an den See, wohin Mine und Madame Ponard bald schon zogen und wohin Friedrich ihnen fast umgehend folgte.
10
Seinen vierten Geburtstag verbrachte Willi in dem sehr schönen Haus am Hang mitten zwischen Weinreben gelegen, er saß neben Herrn Regelmanns Rollstuhl und las dem alten Mann aus seinem Bilderbuch vor oder tat jedenfalls so, indem er alles, was er sah, in Wörter und Sätze verwandelte. Herr Regelmann fühlte sich gut unterhalten und Willi war unter Aufsicht in den Stunden, die sowohl seine Mamamine, wie er sie inzwischen nannte, als auch die anderen beiden Frauen im Laden rund zwanzig Gehminuten vom Haus entfernt, zu tun hatten. Amalie, die Haushälterin der Regelmanns, selbst eine fünffache Großmutter, hatte keine Mühe damit, neben Herrn Regelmann auch den kleinen, sehr braven und anhänglichen Pflegesohn der Frau Frei mit zu beaufsichtigen, der ihr bisweilen auf Schritt und Tritt folgte und ihr Löcher in den Kopf fragte.
So vergingen zwei weitere Jahre seines Lebens. Während in Deutschland Tumult tobte, die Sozis mit den Kommunisten stritten und eine Zentrale Mitte verzweifelt sich mühte, den Kahn wieder ins ruhigere Wasser zu manövrieren, lernte Willi, sich die Schnürsenkel selbst zu binden, er malte die ersten Kopffüßler, benannte die Tiere im Garten, den Hahn, die Hühner, die Zwerghasen, die Bienen, die Wespen, die Amseln, Raben und Tauben; dem kleinen Chouchou warf er Stöckchen und lehrte ihn die Zeitung zu Herrn Regelmann hinaufzutragen, der sie dann mit seligem Lächeln eine Weile in der gesunden Hand hielt, so als ob er sie jeden Moment aufschlagen und lesen wollte.
Mine schrieb Briefe nach Badenweiler, legte Zeichnungen und mit einem Seidenband zusammengehaltene Löckchen bei. Käthe freute sich, wenn alles bei ihr eintraf, aber manchmal dauerte es ein, zwei Tage, bis Georg Zeit hatte, darauf zu schauen. Dass er nichts sagte, wenn er diese Briefe las, dass er die Löckchen zur Seite legte, mochte seine Art sein, den Trennungsschmerz zu verdrängen.
Ein paar Briefe kamen auch zurück, öfter mal eine schöne Postkarte, da stand nur Kuss von Mama und Papa drauf, weil Willi das schon lesen konnte, wie er es nannte. Aber in keinem der Briefe konnte Käthe erzählen, was sie der Freundin vielleicht zugeflüstert hätte, wenn sie noch in der Nähe gewesen wäre. Dass es ihr eine Woche lang schlecht gegangen war. Sie war hinüber über den Rhein gefahren, nicht ganz ungefährlich zu dieser Zeit, hatte die Pannier bitten müssen, ihr zu helfen. Die schüttelte den Kopf und hielt ihr eine Standpauke.
„Jamais, jamais je ne le ferais encore une fois, tu entends, toi?“, hatte sie mit zischender Stimme geflüstert und ihr dann genaue Anweisungen gegeben, was sie tun müsse, damit sie nicht mehr in eine solche Situation käme. Käthe hatte diese Entscheidung vollkommen allein getroffen. Sie hatte Georg nur gebeten, ihr das Geld zu geben. Es aus den Ersparnissen herauszunehmen. Und dann gab es kein weiteres Wort darüber. Danach dauerte es lange, bis er sie wieder anfassen wollte. Als sie endlich wieder einmal Arm in Arm müde beieinanderlagen, spürte Käthe plötzlich etwas Nasses an ihrer Wange. Sie drehte den Kopf und sah, dass ihm Tränen übers Gesicht liefen.
„Ich hätte gar nicht heiraten dürfen“, sagte er.
„Meinst du das wirklich, Georg? Oder was meinst du eigentlich? Wir hätten keine Kinder haben dürfen? Auch ihn nicht?“
Ihr Mann blieb stumm und regte sich nicht.
„Ich liebe ihn sehr. Er ist mir sehr, sehr wichtig.“
„Wichtiger als ich, das weiß ich.“
Jetzt blieb sie stumm.
Beim nächsten Besuch fuhr er mit an den See. Ohne Erklärung. Hatte sogar eine kleine bunt bemalte Holzeisenbahn und einen Kreis Holzschienen besorgt aus seinem Heimatdorf. Setzte sich auf den Boden und verbrachte dort einen ganzen Nachmittag zu Füßen des staunenden Herrn Regelmann zusammen mit dem glückseligen Willi, während Käthe für alle Maultaschen mit Fleisch füllte und in der Brühe kochte, dazu Zwiebelringe in Butter dünstete, Petersilienzweige ins schwimmende Fett tauchte und das starre Sträußchen zwischen die zu einem Berg aufgehäuften Teigtaschen steckte. Das war einer der glücklichsten Tage in Käthes Leben. Viele Male würde sie ihn sich ins Gedächtnis rufen, wenn schwere Sorgen sie davon abhielten in den Schlaf zu fallen.
11
Der fünfjährige Willi fühlte sich wohl im gemütlichen alten Haus in den Weinbergen über dem Bodensee, das der Familie Regelmann gehörte. Familie Regelmann bestand aus dem halbseitig gelähmten Herrn Regelmann und seiner Frau, Mine und Fried Frei, Mines Mutter, Madame Ponard, und der Haushälterin, Frau Amalie Köhler, die nun während der Woche oben unterm Dach in einem eigenen Zimmer wohnte. Mitten zwischen ihnen allen befand sich Willi in einer Prinz-auf-der-Erbse-Situation. Sein Selbstwertgefühl war stark und unerschütterlich, denn viele Male am Tag wurde er gelobt, selten wurde er ermahnt. Die Tadel, die strengen Blicke, gerunzelten Stirnen lösten, wenn sie ihn trafen, Unbehagen bei ihm aus, sodass er sich bemühte, solche Spannungen schnell wieder zu beheben, indem er genau das tat, was man von ihm erwartete. Vordergründig jedenfalls. Ohne Freude daran, gar mit Widerwillen, aber gerade das waren die lehrreichsten Momente, wenn er nämlich spürte, wie gut er das konnte: etwas tun, was ihm nicht gefiel, weil es andere für richtig hielten. Er musste nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Mit seinem verträumten Blick saß er da, klein und zierlich, hellblond, fein gekleidet, und wartete einfach auf die Lücken in der Zeit, die sich von selbst ergaben, in die er hineinschlüpfen konnte und damit raus aus dem Korsett, das die Großen ihm anlegten.
Wenn die Frauen weg waren, Amalie beschäftigt und Herr Regelmann in eines seiner vielen täglichen Schläfchen versunken war, dann schlich Willi sich hinaus in den großen Garten. Dann kam die Stunde, die er allein regierte. Langsam, Zentimeter für Zentimeter, nahm er das terrassenförmige Grundstück in Besitz. Er bewegte sich in größer werdenden Kreisen weg vom Haus bis an die Ränder des Gartens, die von dicken Haselnussbüschen gesäumt waren. Er öffnete das Gatter zum Hühnerstall, tappte durch den matschigen, rutschigen grüngrauen Kot der Hühner, versuchte sie zu packen und musste den Kopf schütteln angesichts ihres hektischen Aufflatterns und ängstlichen Kreischens, all ihrer Anstrengungen, ihm zu entkommen. Warum nur wollten sie nicht mit ihm spielen? Er hatte ihnen doch Haferflocken mitgebracht, stibitzt aus Amalies Schrank. Sorgfältig schloss er das Gatter wieder hinter sich, nachdem er sich genug über die Sturheit der Hennen und das aufgeplusterte Gehabe des Hahnes gewundert hatte. Diese dummen Hennen waren kein Ersatz für Chouchou, der inzwischen in den „Hundehimmel“ geflogen war, irgendwann nachts, Willi hätte das gerne gesehen, einen fliegenden Hund. Leider hatte er es verpasst und in ihm blieb eine tiefe Enttäuschung über Chouchous klammheimliches Verschwinden.
Willi setzte seine Expedition fort, ging den Mittelweg zwischen den Beeten entlang und schließlich durchs Gras hinüber zum Spalierobst und zu den auf ein Holzgestänge aufgebundenen Brombeerranken. Er horchte auf die Glockenschläge der beiden Kirchen, zählte: eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn sie sechs schlugen, dann konnte es sein, dass bald schon Papafried heimkam, und mit ihm begann eine ganz besondere Zeit. Von dem Augenblick, an dem Fried die Tür zum Haus öffnete, heftete Willi sich an seine Fersen, und das hieß, er wurde Zeuge, wie Fried überall nach dem „Rechten“ sah. Alles Lose, Schiefe oder Wackelige wurde zurechtgerückt: das Gatter um den Hühnerstall, das Schloss am Gartentor, der Klappladen am Schlafzimmer der Regelmanns, der mit seinem Gescheppere verhinderte, dass Frau Regelmann wenigstens eine Mütze voll Schlaf nehmen konnte zwischen all dem Tun und Machen der Nächte an der Seite des kranken Ehemannes. Manchmal auch gab es nichts zurechtzurücken, dann hatte Fried irgendeine Idee und sagte: „Komm mit in die Werkstatt, Willi, wir haben was zu tun, wir zwei beide.“
Ideen gingen Fried nicht aus. Sie bastelten zum Beispiel ein raffiniertes Gestell. Es sah aus wie ein großer Vogel, stand auf hohen Beinen, hatte allerdings drei Beine, nicht nur zwei.
„Damit es nicht kippt, verstehst du?“
Dann wurden Wäscheklammern auf einen Rahmen geschraubt. „Da, rüttel’ mal dran, das ist stabil, da kannst du einen Ochsen dran aufhängen.“ Nun musste nur einer, das konnte gut Willi sein, weil er die ganze Konstruktion mit entworfen hatte und sozusagen dadurch ein Experte war, die Zeitung einklemmen und damit hatte Herr Regelmann die Möglichkeit, sie auch zu lesen, denn das konnte er noch, wenn man sie ihm hinhielt.
Auch beim Umblättern wäre Willi wieder gefragt. Damit Herr Regelmann bestimmen konnte, wie nah er die Zeitung brauchte, schraubte Fried noch an jedes Bein ein Rädchen, das sich in einer Aufhängung drehte und so und so und dahin und dorthin geschubst oder gezogen werden konnte. Willi war fasziniert von diesem besonderen Gestell.
„Jetzt könnet ihr ein Patent anmelden, Fried“. Mine war ebenso begeistert wie Willi und wie Herr Regelmann.
„Ein Patent?“
„Mhm, ja, also komm mal her, setz dich auf meinen Schoß, dann erklär ich dir das ...“
Patent, patent. Der Papafried war patent. Was für ein Glück hatte Willi, so einem patenten Papa helfen zu dürfen. Er liebte diese Nachmittage der geschäftigen Zweisamkeit und freute sich während der elendig langen Tagesstunden darauf. Aber auch die Tageszeit lernte er zu meistern. Er streifte umher im Haus, im Garten. Eines Tages entdeckte er dort, wo die Haselsträucher von unten her holzig wurden, zwischen ihren Blättern etwas, das seine Aufmerksamkeit magisch anzog. Einen Blick aus zwei grün-grauen Augen. Zwei Augen, die einen betrachten so wie man sie, das ist immer wieder etwas Aufregendes, etwas, das zu Herzen geht, das gegen verschlossene Türen in uns stößt und sie auftut.
Willis Neugier konnte nur befriedigt werden, indem er die Haselzweige wegbog und sich zum Maschendrahtzaun durcharbeitete, der den Regelmann’schen Garten vom Nachbargrundstück abgrenzte. Dort hockte zwischen noch mehr Gestrüpp ein kleines Mädchen mit einem goldbraunen Lockenkopf. Tausende von Haarkringelchen flimmerten und glänzten in einem Sonnenstrahlenbündel, das sich auf sie ergoss.
„Bist du denn der Willi?“, fragte das Mädchen sehr vernünftig.
„Ja, und wie heißt du?“
„Helene, aber meine Familie ruft mich Heli, obwohl ich das nicht so gerne mag. Was meinst du, kannst du mir mal helfen, hier das Loch größer zu machen, dann könnten wir zusammen spielen, dort bei dir oder hier bei mir, wie du willst.“
Willi staunte, was sie bereits geschafft hatte. Eine brüchige Stelle im Maschendraht hatte sie zum Ausgangspunkt gewählt für eine gezielte Befreiungsaktion. Sie hatte die Maschen aufgebogen, eine nach der anderen, aber das entstandene Loch war kaum groß genug, einen Kinderkopf hindurchzustecken und befand sich noch direkt am Boden.
Willi kniete sich ins weiche Unkraut und begann Helene zu unterstützen. Kurze Zeit später schob sie sich durch die entstandene Öffnung hindurch zu Willi und da kniete sie vor ihm und lächelte ihn an.
Als sie nebeneinanderstanden, stellte Willi fest, dass sie ihn ein winziges bisschen überragte.
„Wie alt bist du?“
„Ich bin sechs, aber ich werde bald sieben sein. Und du?“
„Ich bin schon fünf.“
„Gut“, nickte sie, so als ob es eine Bedeutung hätte.
In diesem Augenblick ertönte ein Ruf aus der Ferne: „Heeeli, kommst du bitte sofort hierher, wir müssen jetzt gehen.“
„Wohnst du denn gar nicht da nebenan? Wohin musst du denn gehen? Kommst du bald wieder?“
Willi schoss seine Fragen ab auf das gekrümmte Hinterteil seiner neuen, seiner ersten wirklichen Freundin, voll Angst, er könne sie, kaum gewonnen, schon wieder verloren haben.
„Ja, ich muss. Hier wohnen meine Großeltern. Aber ich komme wieder. Bald.“
Schon war sie weg, wie eine Elfe aus dem Märchen.
Von da an hatten Willis Tage einen neuen Programmpunkt: Sobald er sich aus dem Dunstkreis der Erwachsenen stehlen oder mit ihrer Erlaubnis und der Aufforderung „geh spielen“ in den Garten begeben konnte, bahnte er sich einen Weg zum Loch im Maschendraht. Bald musste er sich mit einem Stock den Weg freischaffen, weil die Brombeerhecken schlangengleiche Stängel trieben, und mancher Kratzer blieb dabei auf seinen Händen, Armen und sogar in seinem Gesicht zurück. Dann stellte er sich an den Zaun zum Nachbargarten und starrte hinüber zum Nachbarhaus, merkte kaum, dass es dunkel wurde um ihn her, manchmal erlösten ihn erst Mines ängstliche Rufe aus einer traumähnlichen Erstarrung.
Eines Tages erschien sie wieder. Heli! Da krabbelte er das erste Mal hinüber in den Nachbargarten. Sie spielten mit Helenes Ball, ihren Puppen. Beim nächsten Mal brachte Willi seinen Reifen mit und sie wagten sich auf den Hof des Nachbarhauses, spielten zwischen der Teppichstange und unter den Wäscheseilen. Irgendwann einmal kam ein großes Mädchen dazu, das genau die gleichen Haare hatte wie Helene. Auch sie begrüßte ihn: „Bist du der Willi?“
Sie lächelte ihn an und schenkte ihm ein Stück Schokolade. Als sie wieder im Haus verschwand, erklärte Helene ihm, dass das ihre Mutter gewesen sei.
Da wollte er Schluss machen mit dem Versteckspiel. Beim Abendessen, als sich die ganze erweiterte Regelmannfamilie um den Tisch versammelt hatte, erzählte er von seiner Eroberung und merkte lange nicht, dass alle Erwachsenen ihn anstarrten, Messer und Gabel zur Seite legten und aufhörten zu kauen. Er sah nicht, dass sie einander Blicke zuwarfen, und erst als Frau Regelmann hervorstieß: „Da muss man was unternehmen“, bemerkte er die Spannung im Raum.
Beim Gutenachtkuss, den Mine ihm immer nach dem Beten gab, fing sie an, ihm zu erklären, dass er das nicht dürfe, nicht mit „diesem Kind“ von „dieser Frau“ spielen, weil das kein „guter Umgang“ für ihn sei. Mehr erklärte sie nicht. Man sah ihr an, wie halbherzig ihre Argumente vorgetragen wurden.
„Was ist Umgang?“
Mine seufzte.
„Weißt du, Willi, man muss sehr gut aufpassen, mit wem man sich zusammentut.“
„Sie ist so lieb und wir spielen so schön zusammen und ihre Mama hat mir einmal Schokolade geschenkt ...“
„Ihre Mutter, hast du die denn auch gesehen?“
Wie sollte man einem Kind erklären, dass das Produkt aus einer höchst zweifelhaften Liaison eines ganz jungen Mädchens mit einem verheirateten Mann, einem Herrn von Stand, wie man munkelte, manche behaupteten sogar es sei ein ortsbekannter Politiker, andere sprachen davon, dass er Professor sei an der Universität Tübingen, dass so eine Frucht der Sünde eben einfach kein Umgang ist für ein Bürgerkind, noch dazu eines, das einem anvertraut ist von den Eltern, die sich in der Ferne darauf verlassen wollen, dass ihrem Kind kein Leid geschieht.
Helene war der erste Grund für unbeugsamen Ungehorsam. Willi ließ nicht ab von ihr, auch nicht, als das Loch im Zaun geschlossen wurde. Willi fand weiter unten im abschüssigen Teil des Gartens eine andere marode Stelle, da konnte er den Maschenzaun mit großer Kraftanstrengung niederdrücken, so weit, dass es ihm gelang, ihn mit Hilfe eines alten Hockers, den er im Keller gefunden hatte, zu überklettern. Mit einem kühnen Sprung landete er genau vor Helenes Füßen und manchmal auch in ihren weit geöffneten Armen. Er sprang direkt in ihr wunderschönes liebes Lächeln hinein. Zurück ging er erhobenen Hauptes aus der Gartentür der Nachbarn, am Zaun entlang zur Haustür des Regelmann Hauses und es war ihm egal, wer ihm öffnen würde. Er überlegte sich allerdings einige passende Erklärungen, die ausreichen könnten, sein Vergehen zu beschönigen. Wenn man sich nämlich genug Mühe gab und sich eine gute Erklärung für seine Handlungsweise ausdachte, dann kam man ganz gut damit durch.
12
Die paradiesische Epoche in Willis Leben endete kurz vor seinem sechsten Geburtstag, als er eingeschult werden musste. Von da an wollte Georg seinen Sohn bei sich haben. Seine „Ausbildung“ wollte er bestimmen. Und endlich den großen Abstand zwischen Eltern und Kind beseitigen, denn von Badenweiler aus war es fast eine Tagesreise hinüber zum See.
Schluss also mit patenten Gedanken. Ade Brombeerhecken, Helene, Weinberge. Den lächelnden Herrn Regelmann und Frau Amalies Speckpfannkuchen mit Rhabarberkompott, all das musste er hinter sich lassen. Und die Mamamine, den Papafried, die beiden liebsten Menschen auch. Das war das Schlimmste. Obwohl die Mutter und der Vater ihm versicherten, er würde sie wiedersehen, oft, nämlich zum Beispiel in den Schulferien. Also wäre es wichtig, sich schnell im Kalender, überhaupt mal in der Zeit, der Woche, den Monaten und dem ganzen Jahr einzurichten, wie eben ein großer Junge das sollte und auch konnte, wenn er brav auf die Schule ginge und dort schön lernte, was man ihm vortrug.
Georg und Käthe waren wieder einmal nach beruflichen Abstechern in die Umgebung, nach Rippoldsau, Freudenstadt und Baden-Baden in der Kurstadt Badenweiler gelandet. Georgs Lieblingsbruder Albert und seine Verlobte Irmi waren mit von der Partie. Albert als Sommelier, Irmi stand am Empfang mit streng zurückgekämmten kurzen Haaren, knallrot geschminkten Lippen und Perlenohrringen. Die blonde quirlige Irmi hatte sich den anderen zugesellt, nachdem Albert sie aus der Parfümerie Borel in Baden-Baden, in der sie als Verkäuferin angestellt war, gelockt hatte mit seinem Charme und seinem Lächeln, seiner verheißungsvollen Unnahbarkeit. Es knisterte manchmal zwischen Käthe und Irmi. Irmi war schon 39 Jahre alt, unverheiratet und vielleicht kein unbeschriebenes Blatt. Einen eigenen Kopf hatte sie jedenfalls. Aber tüchtig! Und sie lachte den ganzen Tag, schwirrte um Albert herum wie ein Schmetterling; abends verschwand sie ganz ohne Zaudern und Zagen in seinem Zimmer. Wohin sollte das führen? Käthe presste die Lippen aufeinander und eine scharfe Falte grub sich zwischen ihre Augenbrauen. Auch wenn Irmi sich um ihren alten vornehmen Stammgast, den Direktor Rademacher, kümmerte mit Schmeicheln und Zwitschern, sich bei ihm einhängte, als ob sie seine – ja was nun, Tochter oder ... das andere wollte man nicht benennen – wäre, wenn sie ihn morgens vom Lift zu seinem Frühstückstisch begleitete, ihm die Serviette auf den Schoß legte, sich zu ihm beugte, bis ihre Gesichter nur Millimeter weit voneinander entfernt waren, um seine Bestellung aufzunehmen.
„Das mag er, der alte Herr, glaub’s mir, Käthe. Er ist ganz verrückt nach ihr. Und das ist gut fürs Geschäft.“ Alberts Blindheit, seine Liebste betreffend, beanspruchte Käthes Nerven und erzeugte Spannungen zwischen ihr und Georg, der abwinkte: „Sei doch nicht so kleinlich. Alles, was unseren Betrieb am Laufen hält, ist erlaubt.“
Unseren Betrieb nannte Georg das. Es war nicht „unser“ Betrieb. Sie waren angestellt für diese Saison und vielleicht auch die nächste, konnten aber jederzeit ersetzt werden. Der eigene Betrieb war nur ein Traum. Nicht mehr als ein langsam wachsender Zahlenspiegel auf der Bank. Ein kleiner Schatz, der wuchs und schwand und wuchs und schwand. Käthe musste ihre Einwände unterdrücken, damit wieder Friede herrschte im Haus. Das kostete sie Kraft. Unseriös nannte sie Irmis Verhalten und eigentlich waren Georg und sie sich doch einmal einig gewesen, dass es gewisse Gesetze gab in ihrem Beruf, ungeschriebene, aber dennoch eherne Gesetze. Bei diesem Mädchen galten die plötzlich nicht mehr.
Willi reiste also an mit seinem ledernen Koffer, um den Fried einen seiner alten Armeegürtel geschnallt hatte, weil die Schlösser sonst nachgegeben hätten bei all dem Kram, den Willi unbedingt brauchte und mitnehmen wollte. Es war kurz vor Weihnachten. Am ersten Dezember hatten seine Eltern eine gemietete Villa am Hang bezogen. Sie stand in einem großen verwunschenen Garten mit vielen alten Bäumen, Tannenbäumen, wie aus dem Wald herübergewandert und dort stehen geblieben. Ihre Äste breiteten sie aus, Arme in einem dunkelgrünen Gewand, ausgestreckt über die struppigen Reste der Stauden und Gräser, der alten Rhododendren und Azaleen mit ihren herabhängenden traurigen Blättern und den dicken Knospen im Wartestand.