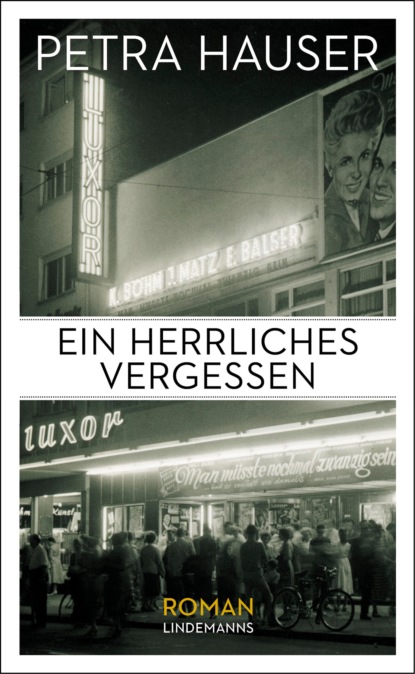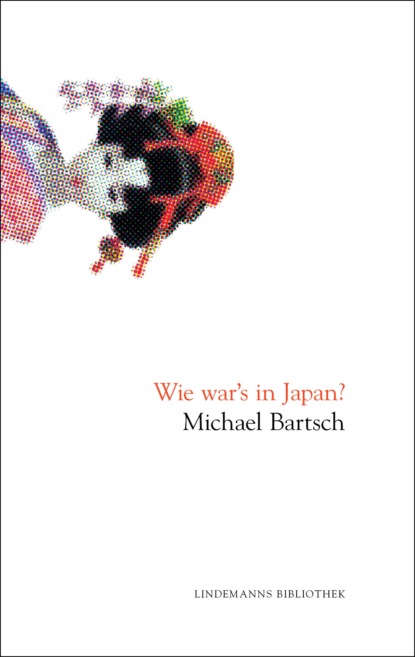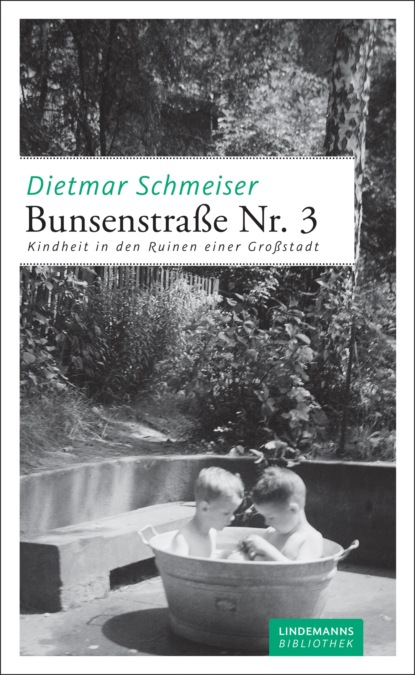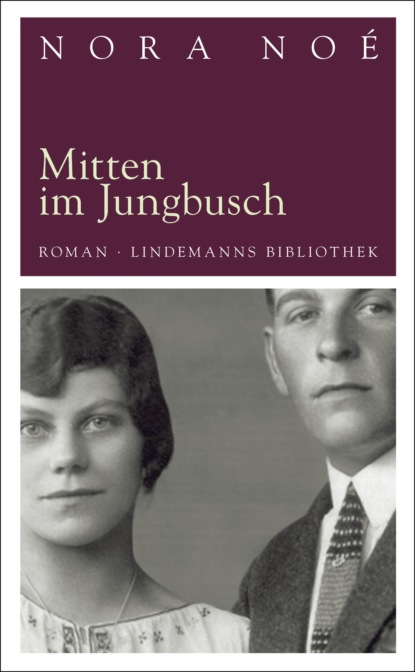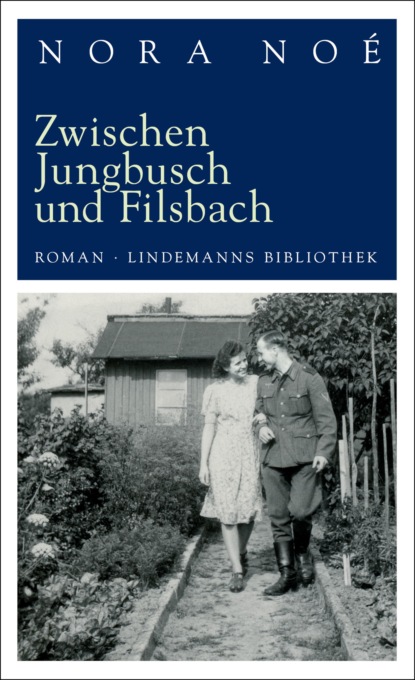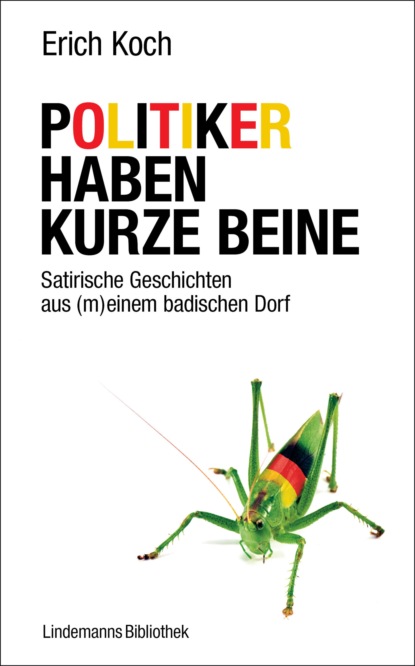- -
- 100%
- +
Am Tag nahm Käthe den Kleinen mit und schob ihn dahin und dorthin. In der Küche gab es einen Hocker, auf den legte man ein Schneidebrett, das ergab einen kleinen Tisch für Willi, der auf einem Fußschemel davor saß und malen durfte. Immer wieder stand er auf, ging auf Wanderschaft, neugierig stellte er sich zwischen all die in der Küche umhereilenden schwitzenden Menschen und als die kleine Küchenhilfe Annegret an ihn stieß und die ganze Schüssel mit heißem Grießbrei fallen ließ, blieb Käthe fast das Herz stehen. Was würde Georg dazu sagen? Nichts sagte er, denn das Schlamassel wurde schnell und gründlich beseitigt. Dass es genau am 24. Dezember war, noch im Jahr 1920 und kurz vor seinem sechsten Geburtstag, das würde Willi sich merken. Denn mit dem Hinweis auf dieses Missgeschick wurde er schon früh am Abend in die Villa gebracht, in sein Bett, noch bevor man das große Diner servierte.
„Jetzt schlaf schön. Wir kommen bald“, sagte seine Mutter und verschwand wieder. Schloss die Haustür von außen ab, nahm den Schlüssel mit.
Schlafen konnte Willi nicht. Es gab so viele Geräusche rings um ihn her. Die Fensterläden ratterten, wenn der Wind sie streifte, der Dielenboden knackte, so als ob unsichtbare Füße über ihn tappten. Es knisterte, kleine unregelmäßige Klopftöne kamen näher und verloren sich wieder in der Ferne und eine Kutsche rollte draußen vorbei, die Peitsche knallte, die Räder knirschten über Sand und Kieselsteine und das Pferd blies seine heiße Atemluft durch die Nüstern, nein, das konnte nicht sein, er konnte das nicht gehört haben, das Pferd war weit weg, alle Rollläden zu, das Haus stand einige Meter zurück von der Straße. Willi zog die Decke über den Kopf und lauschte seinem Atem, bis ihn auch der erschreckte. Dann hatte er plötzlich genug von dem ganzen Spuk. Er wollte nicht, dass all das geschah und er selbst bewegungslos inmitten der geisterhaften Geschehnisse saß, wie von einem Zauber gebannt.
Mit einem Ruck warf er die Bettdecke von sich. Auf dem Stuhl neben dem Bett lagen seine Kleider. Er streifte sie über, schlich vorsichtig zur Tür und suchte mit der Hand den Lichtschalter. Ein bisschen musste er sich danach strecken. Dort hing sein Mantel an einem Haken, die Mütze, der Schal. Er zog auch das alles an, schloss die Knöpfe, schlüpfte in seine dunkelroten Lederstiefelchen, band eine Schleife, so wie er es kurz vor seiner Abreise von Mamamine gezeigt bekommen hatte, öffnete sachte die Tür und lauschte hinaus. Dann betrat er den Flur und suchte dort den Lichtschalter, tapste weiter von Raum zu Raum und machte alle Lichter an im Haus. Im großen Salon zog er sich einen Stuhl vors Fenster, öffnete es und löste den Haken der Klappläden. Stieß die beiden Holzbretter mit der herzförmigen Öffnung weg, schloss das Fenster wieder. Ging nun weiter von Fenster zu Fenster; überallhin, wo es ihm gelang, öffnete er die Verschläge. Damit er die Sterne am Himmel sehen konnte und den Mond, eine schmale Sichel zwischen den Tannenwipfeln. Jetzt suchte er nach Kerzen. In der Küche, in allen Schränken, im Flur, im Badezimmer. Da fand er sie endlich, fein säuberlich nebeneinandergelegt in einem kleinen Korb auf der weiß lackierten Kommode neben den Handtüchern und Waschlappen. Die grauen Halter aus Email aufeinandergestapelt, ordentlich wie immer, wie alles, was die Mutter versorgte. Die Streichhölzer daneben. Mit leichtem Druck steckte er die erste Kerze in einen Halter. Richtete sie aus, ganz gerade, ließ sich Zeit dabei, betrachtete sie von oben, von der Seite. Jetzt! Anzünden. Konnte er das denn? Konnte er ein Streichholz anzünden? Er durfte es nicht und hatte es doch oft schon versucht, weil er das Geräusch mochte und das Aufflammen des hölzernen Stäbchens. Den schweflichen Geruch. Ein, zwei Hölzchen zerbrachen, bevor es ihm gelang, eine Flamme zu entzünden. Die erste Kerze brannte, die zweite trug er zuerst an einen anderen Ort, dann machte er auch sie an. Dann die dritte und alle anderen. Verteilte sie im Haus. Schließlich kam er ins Wohnzimmer, wo der Baum stand, eingepasst in einen schweren eisernen Ständer. Soweit hatte es der Vater noch geschafft am Vortag. Die Kartons mit den silbernen Kugeln lagen daneben. Aufgeklappt. Das Lametta, die Kerzenhalter, die man an die Zweige stecken musste, als ob es Wäscheklammern wären. Zuerst schmückte Willi die unteren Zweige, dann zog er sich einen Stuhl heran und hängte die nächsten Kugeln auf. Das mit den Kerzenhaltern war schwieriger, die dicken weißen Kerzen aus dem Badezimmer passten nicht hinein. Andere Kerzen fand er nicht. Was für ein Glück! Denn wohin hätte das wohl geführt.
Er ging wieder zurück, freute sich an all dem Licht, dem stillen, flackernden Leuchten in dunkler Nacht. Merkte schließlich, dass er fror. Trotz der milden Temperaturen in diesem Winter hatten die Schwarzwaldnächte ein eiskaltes Kleid an. Weihnacht 1920. Er hatte sie sich hell gemacht. Ganz alleine. Und er war jetzt müde. Mit all seinen Kleidern, dem Mantel, der Mütze, dem Schal legte er sich in sein Bett. Schwer waren seine Lider. Dass er sie offen halten wollte, dachte er, dass er warten wollte auf seine Eltern, die doch bald schon kommen würden, daran klammerte er sich, während ihm die Augen endgültig zufielen.
Als Käthe und Georg zu später Stunde mit müden großen Schritten den Berg hinaufgingen, sahen sie von Ferne schon den flackernden Lichtschein hinter den Fensterscheiben. Hatten sie denn nicht die Läden vorgeklappt? Sie schauten einander an und beschleunigten ihre Schritte. Atemlos schlossen sie die Tür auf und standen im hell erleuchteten Haus, rochen die Kerzen, einige von ihnen waren schon abgebrannt. Die Eltern eilten hinauf ins Kinderzimmer und sahen ihn dort liegen, ihren Sohn, seine ihm Schlaf aufgelösten Züge. Die Mütze neben das Bett gefallen.
„Das ist doch ...“
Bevor Georg weitersprechen konnte, sagt Käthe: „Eine frohe Weihnacht. Die wünsch ich dir und ihm und mir.“
Sie sah ihn an mit weit geöffneten Augen und zusammengepressten Lippen. Georg hielt diesen Blick nicht aus. Er schlug die Augen nieder. Dann stand er auf und verließ wortlos den Raum. Käthe zog Willi vorsichtig den Mantel aus und die Stiefelchen. Er war zu erschöpft gewesen, um sie aufzuschnüren, dachte sie, und ihr Herz tat weh dabei. Sie strich ihm das Haar aus der Stirn, nahm den Kerzenhalter, in dem gerade der letzte Rest des Dochtes verglühte, und beim Hinausgehen schaltete sie das Licht aus.
13
Willis Geburtstag. Die Mutter hatte ihm eine eigene Torte gebacken, sie mit kleinen Marzipanhasen und Mohrrübchen verziert, Büschelchen aus Minzeblättern darum dekoriert und mittenhinein die sechs kleinen goldenen Kerzen gesteckt, die er mit einem Atemzug ausblasen sollte, das bringt nämlich Glück, und wer kann das nicht brauchen? Jeder brauchte das doch, sonst gelang nichts im Leben. Aber eigentlich war das nur ein Moment, ein winziges Loch in der Zeit. Die Routine des Hoteltages verschlang diesen Glückssplitter und machte ihn fast ungeschehen. Wäre die kleine braune Ledertasche nicht ab jetzt in Willis Zimmer auf dem Korbsessel gelegen, das Schwämmchen nicht an ihr heruntergebaumelt und hätte es sich nicht immer wieder sachte bewegt, wenn man beim Vorbeigehen ein bisschen Wind machte, dann hätte er geglaubt, er hätte diesen Geburtstag nur geträumt. In der Tasche lag das große Kuvert mit vielen Zeitungsausschnitten von Fried und Mine, die ihn an den Bodensee erinnern sollten, auf dass er ihn nicht vergessen möge. Die Schultasche hatten die beiden von Frieds Bruder fertigen lassen aus weichem Kalbsleder, das herrlich roch.
Zwischen Weihnachten und Ostern verflogen die Wochen. Der kalte Westwind brachte ergiebige Schneefälle. Es schneite so sehr, dass man keinen Hund vor die Tür schickte. An Schlittenfahren war nicht zu denken, jedoch es gab so viel zu sehen und zu erleben im Hotel. Die vielen Menschen im Haus. Denn wenn auch nur wenige Kurgäste im Winter kamen, so musste doch der Betrieb laufen und dazu wurde eine ganze Mannschaft verschiedener dienstbarer Geister gebraucht. Ständig gab es einen, der dem kleinen Bub die Haare zerzauselte oder ihm einen kleinen Klapps hintendrauf gab, ganz freundschaftlich, versteht sich, aber er stand eben auch oft im Weg herum, war ein ins Räderwerk geratenes Sandkorn, das man loswerden musste, wenn die Maschinerie laufen sollte.
Dann kam die Sonne und man konnte Schlitten fahren. Einmal ging sogar der Vater mit, kurz bevor es dunkel wurde, in der Zeit, bevor er sich zum abendlichen Service umziehen musste. Er lachte beim Schlitteln! Er hielt seinen Arm fest um seinen Sohn geschlungen und Käthes Augen leuchteten, als sie die beiden den Abhang heruntersausen sah. Ihre Hände hatte sie im Muff versteckt, mit den Füßen trappelte sie hin und her, weil die Kälte in ihre Zehen biss. Willi schloss die Augen und lachte auch.
Die Tage wurden bald wieder länger, der Schnee taute und plötzlich war der große Tag da.
„Ach Gott, heute ist das schon, fast hätt’ ich’s vergessen!“
Muttersein war noch keine Routine für Käthe, das musste sie erst noch üben. Eine Schultüte konnte in allerletzter Minute von Imogen, dem Zimmermädchen, in einer Papeterie in der Freiburger Straße erworben und mit Süßigkeiten gefüllt werden. Dazu steckte sie noch zwei Bleistifte und einen Notizblock aus der Rezeption. Karl, der Portier, warf zuallerletzt einen silbernen Suppenlöffel hinein, einen von den kleineren, die man zur Schildkrötensuppe servierte. Er meinte später, er habe etwas Bleibendes dazu geben wollen, als gutes Omen, damit das Kind es leicht haben möge in der Schule. Vermutlich dachte er mit Grausen an die eigene Schulzeit zurück, vor allem an die Tatzen, die Züchtigungen auf seine dünnen Fingerchen und später auf den gekrümmten Rücken, an alles, was maßgeblich verhinderte, dass seine Orthografie fehlerfrei und die Rechenergebnisse richtig werden konnten.
Irmi kam mit dem ihr eigenen Aufwand, kurz bevor Käthe Willi endlich aus der Tür zog, vorbei und spuckte ihm auf den Kopf, sagte dazu „Toi-toi-toi“ und streichelte ihm dann die Locken aus der Stirn. Sie rannten im Schweinsgalopp hin zur Schule und Käthe kniete sich vor ihren Sohn, bevor sie ihn zu den anderen Kindern ließ, streichelte über die angeklebten Haare und sagte: „Das meiste, was du dort hörst, wird dich interessieren. Wenn dir etwas nicht gefällt, versuch, es nicht so ernst zu nehmen. Vor allem, denk dran, die Schule ist nie wichtiger als wir, dein Papa und deine Mama und dein Zuhause.“
Sie dachte verzweifelt darüber nach, ob sie irgendeinen wichtigen Gedanken vergessen hatte, denn sie bekam eine Gänsehaut angesichts der Tatsache, dass das nun ein historischer Augenblick im Leben ihres Sohnes war, von dem viel für seine Zukunft abhängen würde. Und insgeheim wusste sie, dass sie gerade geschwindelt hatte. Wie wichtig ist die Schule für das ganze Leben. Und um wie viel mehr Zeit würde er dort verbringen als zusammen mit seinen Eltern.
14
Da Willi es nicht gewöhnt war, sich mit einer größeren Anzahl Gleichaltriger zu vergnügen, wurde er nur wenig abgelenkt durch die Dummheiten seiner Klassenkameraden und wandte einen Großteil seiner Aufmerksamkeit dem Herrn Lauble zu, seinem Klassenlehrer.
Herr Lauble war eigentlich Musiker, sowohl ausgebildeter Organist als auch ein sehr guter Geiger. Er verfügte über einen angenehmen Bariton und Sang und Klang bedeuteten ihm ebenso viel wie die Luft zum Atmen. Jeder Schultag begann und endete mit einem Lied. Einfache Weisen, die er die Kinder zuerst nur summen ließ. „Im schönsten Wiesengrunde liegt meiner Heimat Haus“ stimmten sie zusammen an. Mit den Händen sollten sie die Veränderungen der Tonhöhe darstellen, mit den Füßen dazu den Takt schlagen, eine akrobatische Leistung, die nur wenigen von Anfang an gelang. Aber immerhin ließen sie sich darauf ein, es zu probieren, und somit erzeugte Herr Lauble ganz ungezwungen Konzentration, wo sein Kollege Achenbach schon am ersten Tag den Stock zückte. Herr Lehrer Lauble beschäftigte die klugen, fleißigen Schüler mit Aufgaben, denen sie gerade eben gewachsen waren, und widmete sich dann verstärkt denjenigen, die wohl nie mehr als ihren Namen und ihre Adresse würden schreiben können. Er lobte viel, sein schlimmster Tadel war ein verkniffener Mund, ein lippenloses Verbeißen seiner Enttäuschung und seines Unmutes über das, was nicht gelingen wollte oder konnte. Während des Unterrichtens ging er beständig zwischen den Reihen und Bänken auf und ab, brachte sich so in einen direkten persönlichen Bezug zu jedem einzelnen Kind, sprach es unmittelbar an, sodass es sich ernst genommen und in eine persönliche Verantwortung hineingezogen fühlte.
Mit weniger Worten gesagt, er war ein pädagogisches Naturtalent und ein ausgeglichener, optimistischer Mensch. Sein einziger Schwachpunkt war die Tatsache, dass er vor jedem Eintrag in das Klassenbuch den kopiersicheren Stift an die Zunge führte, damit, was er schrieb, in schönem glänzenden Violett erstrahlte und nicht fadenscheinig gräulich daher käme. So bekam er bis zum Ende des Vormittags eine tief dunkelblaue Zunge, was ihn dem geheimen Spott seiner Schüler aussetzte. Der kleine Friedrich Mager, der schräg hinter Willi saß, kicherte darüber und sagte eines Tages auf dem Pausenhof zu Willi: „Schau mal, heute hat der Blaule Aufsicht.“
Willi brauchte einen winzigen Augenblick, bis er zu grinsen begann und einen anerkennenden Lacher ausstieß. Pfiffig, dieser Friedrich, dachte er.
Wenige Tage darauf fehlte Willis Tischnachbar Adalbert. Da drehte er sich zu Friedrich um, ruckelte einladend mit dem Kopf und Friedrich schnappte sich seine Schiefertafel, das Säckchen mit den Kreiden, der Fibel und seinem Pausenbrot, kletterte über den Tisch und ließ sich neben Willi in die Bank gleiten. So fanden die zwei zusammen, die ohnehin am Rand standen. Willi, der hier nicht geboren war, und Friedrich, von dem man nur wusste, dass er samstags nie in die Schule kam, weil er da beten musste. Beide waren anders und in ihrer Andersartigkeit möglicherweise schwächer als die anderen. Beide wurden häufig von Herrn Lauble wegen ihrer schönen Schrift und der gewissenhaft ausgeführten Hausaufgaben laut gelobt. Das Unbehagen über dieses Herausheben aus der Masse ertrugen sie besser zu zweit.
So waren sie auch zu zweit, als sich der Unmut der anderen Klassenkameraden ballte und eine Horde von fünf oder sechs Burschen ihnen auf dem Nachhauseweg nachschlich. Der Überfall kam plötzlich an einer unbelebten Straßenecke. Friedrich lag schnell am Boden und blutete heftig. Willi wurde von einer brennenden Wut erfüllt. Er stürzte sich auf die Angreifer, sodass sie sich von Friedrich abwandten und ihn in die Mangel nahmen. Er biss in alles, was in die Nähe seiner Zähne kam, kratzte, stieß mit Fäusten und Füßen, schrie dabei wie eine Hyäne.
„Wie eine Hyäne habe ich geschrillt“, erklärte er später, als er neben Friedrich auf einem Hocker in der Hotelküche saß und sich von seiner Mutter das Blut aus dem Gesicht wischen ließ.
„Geschrien, Willi, es heißt geschrien“, warf Imogen ein, die sich gleichzeitig um Friedrichs Blessuren kümmerte.
„Auweia, das wird noch lang zu sehen sein“, sagte sie, als sie ein kaltes nasses Handtuch auf Friedrichs Schläfe drückte.
„Du bist tapfer wie Prinz Eisenherz, weißt du das“, liebevoll strich Imogen Friedrich eine blutige Haarsträhne aus der Stirn.
Da kam plötzlich Georg in die Küche gestürmt.
„Was ist denn hier los? Ist das ein Lazarett? Raus hier aus der Küche.“
Mit flinken Fingern packten die beiden Frauen die kleine Waschschüssel, die Tücher, die Salbentiegel und bedeuteten den Buben mit einem Kopfnicken, sie sollten ihnen folgen. Käthes Lippen waren fest aufeinandergepresst, man konnte sie fast nicht mehr sehen.
Draußen im dunklen Gang wurde der Samariterdienst fortgesetzt. Dann holte Käthe zwei schöne dicke Krapfen aus der Küche und hielt sie den Buben hin.
„Es hat mich gefreut, dass ich jetzt den Friedrich auch mal kennengelernt habe. Du bist also dem Willi sein Freund?“
Friedrich nickte mit vollem Mund und dann sahen die beiden Buben einander an und grinsten.
Am Abend kam der Vater in Willis Zimmer und hielt ihm eine lange zornige Rede. Über die Küche, die ein heiliger Ort der Sauberkeit ist, die Keimzelle von „Gedeih und Verderb“, wie er es ausdrückte. Dass der Sohn des Maître d‘Hôtel und der Leiterin der Kaltküche, oder vielmehr vielleicht der Sohn eines zukünftigen Hotelbesitzers, das solle er sich nur mal merken, dahin strebten sie nämlich, die Mutter und er, und diesen Weg würden sie sich vom Sohn nicht vermasseln lassen, dass solch ein Bub besser wissen muss als alle anderen, was richtig und was falsch ist. Er solle sich gefälligst Respekt verschaffen bei seinen Klassenkameraden. Man lasse sich nicht blutig prügeln. Nicht sein Sohn. Beim nächsten Mal, wenn er verprügelt würde, bekäme er am Abend vom Vater noch was obendrauf, das würde ihn dann vielleicht lehren, so dazustehen, dass keiner es wage, ihn anzurühren. Willi wollte am liebsten weinen. Er sah den Rücken des Vaters stumm mit aufgerissenen Augen und fest aufeinandergepressten Lippen an, als er aus dem Zimmer ging. Da kam die Mutter. Sie nahm ihn in den Arm und erklärte ihm, der Vater meine es nur gut, aber er könne es eben nicht so richtig ausdrücken. Und ja, eigentlich solle sich ein Junge so wie er nicht mit den Gassenbuben prügeln. Das dürfe man erst gar nicht aufkommen lassen. Dann wiegte sie ihn hin und her, küsste ihn auf die Stirn und streichelte ihn, bis ihm die Augen zuzufallen drohten und er sich aus ihren Armen wegsträubte, um sich in sein weiches Kissen fallen lassen zu können. Bevor er einschlief, dachte er an Mamamine und Papafried und stellte sich vor, wie sie sich verhalten hätten in dieser Angelegenheit. Der Vergleich fiel nicht zu Gunsten seines Vaters aus.
15
Es gab wieder eine Routine, eine kleine Geborgenheit inmitten der Hektik des sich ständig wandelnden Hotelalltags. Morgens weckte ihn die Mutter und sagte: „Los, los, keine Müdigkeit vorschützen!“
Er zog sich die Kleider an, die sie ihm irgendwann in der Nacht noch bereitgelegt hatte und griff sich seinen Ranzen, aus dem das Schwämmchen der Schiefertafel baumelte. Dann ging’s an der Hand der Mutter hinunter zum Hotel und dort in irgendein verborgenes Eckchen, wo er möglichst wenig störte, wo ihm aber ein schönes Frühstück aufgetischt wurde. Eine heiße Schokolade und ein duftendes warmes Hefehörnchen. Dann hatte er sich zu beschäftigen, bis es Zeit war für die Schule. Aber wenn es Zeit wäre zu gehen, war keiner da, der ihn daran erinnerte, und die Uhr konnte er noch nicht lesen. Also ging er los, wenn ihm langweilig war oder wenn er mit der Sache fertig war, mit der er sich beschäftigt hatte. Das war oft eine Zeichnung, die seine Konzentration in Anspruch nahm; er wollte sie richtig schön machen, stellte sich vor, wie Mutters Augen strahlten, wenn sie sie in den Händen halten würde, oder auch ein Bild für Herrn Regelmann, auf dem er Herrn Lauble mit blauer Zunge darstellte, in der erhobenen Hand hielt er sein Dirigentenstöckchen. Ach ja, Willi vermisste Herrn Regelmann sehr und er vermisste Helene, also malte er auch für sie ein Bild, das er in den Umschlag schmuggelte, in den Käthe ihren Brief an Mine und Fried steckte, bevor Willi ihn zum Briefkasten tragen durfte.
Er kam zu früh oder zu spät zum Unterricht und lernte den Unterschied zwischen diesen beiden Situationen kennen. Erkenntnisse aber zog Friedrich aus Willis zeitweiligem Versagen. Er machte sich zur Regel, den Freund abzuholen. Kam herüber vom „Bellevue“, da gehörte er nämlich hin, war also ein richtiger „Kollege“, wie die Mutter es nannte, spazierte schnurstracks hinein ins Hotel wie ein feiner Herr und suchte seinen Freund, stupste ihn an und sagte: „Willi, kommst du, s’isch Zeit!“
Willi erreichte von nun an den Unterricht immer pünktlich. Friedrich wurde von ihm Fritz genannt. Fritz behielt von ihrem ersten Kampf eine drei Zentimeter lange Narbe über der Augenbraue, das stellten die beiden an dem Tag fest, an dem sie begannen mit Zentimetern und Metern zu rechnen. Das war schon zwei Jahre später.
Käthe hatte sich im Kurhotel gehalten, eine Saison nach der anderen. Georg ging dahin und dorthin. Zwischendurch auch immer wieder mal nach Baden-Baden, dort auch abends ins Casino, um sein Glück herauszufordern, aber auch hinüber nach Frankreich, um neue Weine auszusuchen zusammen mit dem Albert und mit Irmi, die eben beweglicher war als Käthe in jeglicher Hinsicht.
Dann nahte der Sommer 1923 und Willi und Friedrich mussten sich trennen. Käthe, Georg und Albert hatten zusammen in Baden-Baden das „Krokodil“ übernommen. Gepachtet vorerst, mal sehen, wie es weitergeht. Ein Besitzerwechsel stand an, das hörte Willi, weil es immer wieder laut und leise und vor und hinter den Türen wiederholt wurde. Irmi war nicht mehr dabei. Dafür gab es jetzt Jenny. Albert hatte sie aus München mitgebracht, wo er den letzten Winter im Bayerischen Hof als Sommelier gearbeitet hatte.
Albert erzählte eine aufregende Geschichte von der Revolution in München, wie die aufgebrachte Menge von Menschen marschiert war, die schöne prächtige Ludwigstraße entlang auf den Odeonsplatz zu, wo sich die Feldherrnhalle erhob. Wie dann geschossen wurde und ...
„Warst du dabei, Onkel Albert?“, wollte Willi wissen.
Nicht direkt, sagte Albert, aber fast. Jedenfalls kamen einige aufgeregte Männer die Straße entlanggelaufen und schrien laut: „Das ist noch nicht vorbei, die schießen noch!“
„Und dann, Onkel Albert?“
„Dann war sie zu Ende, die Revolution. Aus und vorbei. Festgenommen haben sie die Putschisten und ins Gefängnis gebracht. Jetzt ist wieder Ruh’ im Land Bayern.“ Aber trotzdem hatte Albert die Jenny gerettet vor der Revolution, indem er sie einfach mitgenommen hatte hierher ins schöne Baden, in den Schwarzwald. Jenny war eine Erbin, was das ist, wusste Willi nicht; alle machten eine Art Verbeugung vor ihr, die man zwar nicht wirklich sah, aber spürte. Jenny war ganz anders als Irmi. Sie war sanft und still und bescheiden und nachgiebig und Käthe hatte nichts gegen sie. Noch vor Silvester würden Albert und Jenny heiraten, dazu fuhren sie noch einmal zurück nach München, wo Jennys Eltern ein großes Fest ausrichteten. Käthe hielt die Stellung, während Georg mitfuhr mit seinem Lieblingsbruder, er war sein Trauzeuge. Willi fühlte sich hin- und hergerissen. Würde er lieber mit dem Vater gehen oder lieber bei der Mutter bleiben? Bevor sich dazu irgendeiner eine Frage stellte, war es klar, dass das eine von Georgs Extratouren sein würde, die Käthe in Frage stellte, und immer seltener konnte sie mit ihren Vorhaltungen warten, bis Willi schlief, immer öfter wurde er Zeuge von lauter und lauter ausgestoßenen schnellen, scharfen Sätzen, die wie Steine zwischen den Eltern hin und her flogen. Meistens bekam Willi Bauchweh davon und wollte dann nichts mehr essen. Erst wenn er sah, wie sie einander anlächelten, wenn sie sich stumm verständigten über dies und das, was sie eben so und nicht anders haben wollten, dann ließ das Tier in seinem Bauch wieder los und er freute sich auf Fleischbrühe mit Markklößchen und einem Sträußchen im Fett herausgebackener Petersilie.
16
Nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über sammelte sich damals in Baden-Baden eine große Anzahl von Flüchtlingen der besonderen Art. In den 20er-Jahren vor allem russische Familien mit oder ohne Vermögen, adlige Großstädter, die den politischen Unruhen der Zeit auswichen, Glücksritter, Diplomaten, Spieler. Dazu die vielen, die das Leben dieser Leute angenehm gestalteten, den Nährboden bereiteten für ihr oft zielloses, aber doch kultiviertes Treiben und Tun. Jedes Hotel war ein Ort der Begegnung, eine Bühne für sie.
„Pass nur auf“, hatte Albert seinem Bruder Georg gesagt, „hier rollt der Rubel! Wenn wir es geschickt anstellen, dann können wir den einen oder anderen in unsere Richtung lenken.“ Auch jetzt in den immer schlechter werdenden Zeiten. Weil die Emigranten alles mitgebracht hatten, den Schmuck und das alte Geld und vor allem auch ihre Kultur, den Wunsch zu tafeln, zu logieren, vielleicht auch zu spielen im Casino und danach den Gewinn zu verprassen, so als ob das Leben morgen schon zu Ende wäre.
Außerdem lebte hier auf dem Schloss die alte badische Großherzogin mit ihrer kleinen, aber feinen Entourage, und dann gab es noch die Familie Biron, drüben in der Villa Eden, mit den drei Buben, den schönen großen Hunden und dem ganzen Tamtam, das die Baden-Badener machten um solche Bewohner.