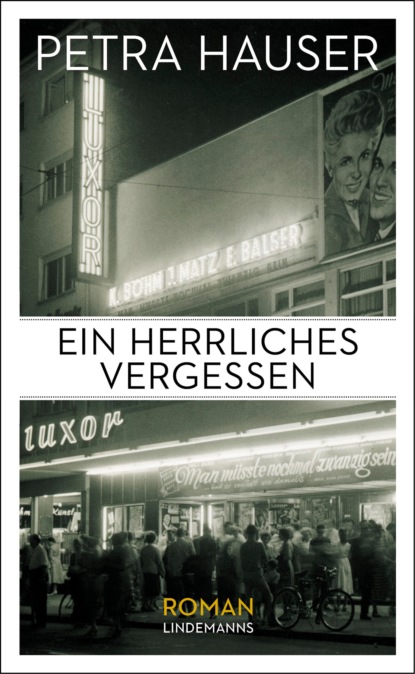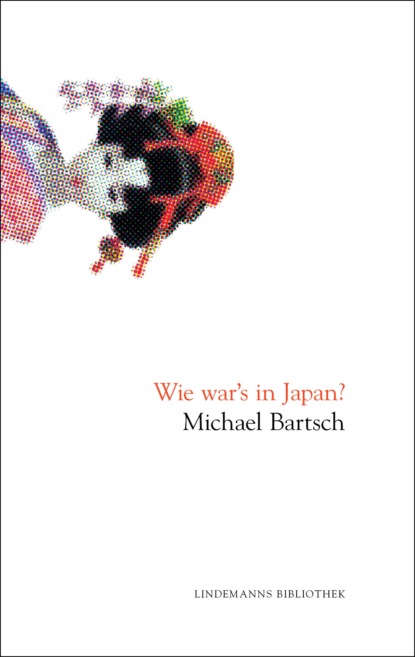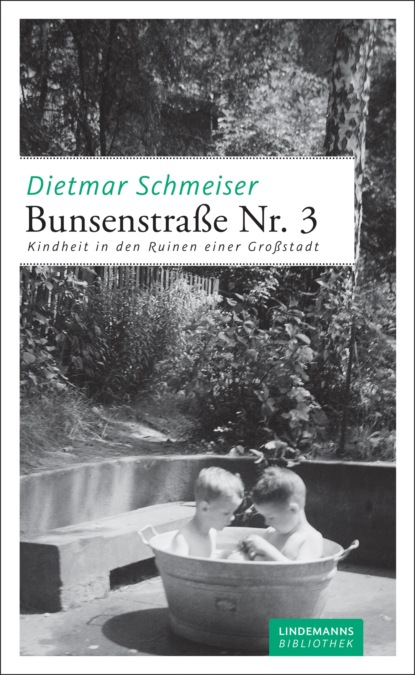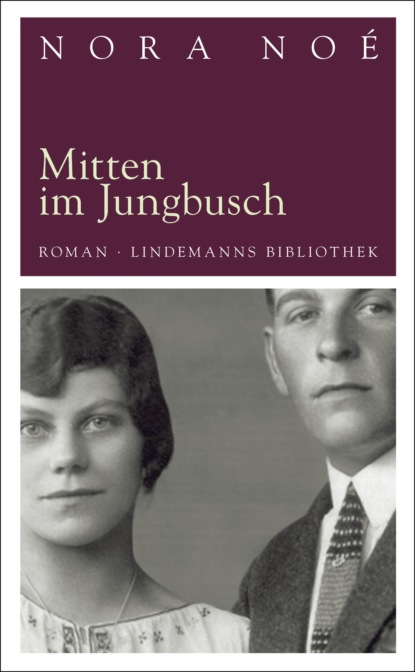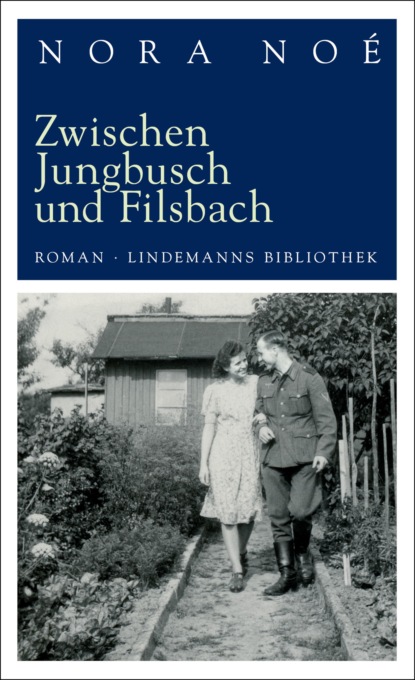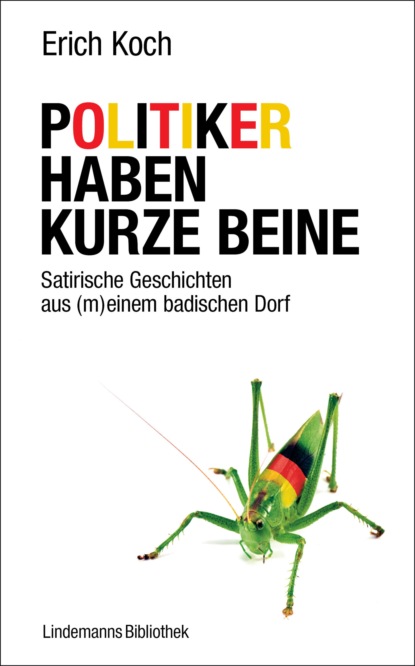- -
- 100%
- +
Georg und Käthe mussten noch mehr arbeiten als bisher. Sie waren eingespannt von der Früh’ bis in die Nacht hinein. Immer zu wenig Schlaf. Immer auf dem Quivive. Alles musste flutschen, die Konkurrenz war groß.
Außer dem Hotelbetrieb nahm man Aufträge an, lieferte dies und das in die privaten Häuser, sogar ins Schloss hinauf, ganz diskret. Die Großherzogin liebte Käthes französische Linzertorte, sie konnte nicht genug davon kriegen, nicht nur im Advent oder für die Festtage, nein, es verlangte ihr immer wieder danach, das ganze Jahr über. Auch ihre Bayerische Creme ließ man schicken. Einmal war Käthe sogar dort im Schloss engagiert für ein Dessertbuffet, als besondere Gäste anwesend waren. Die Kinder der alten Dame, der ehemalige Großherzog und seine Schwester, die schwedische Königin. Das machte Georg stolz. Da wusste er, warum er sie gewollt hatte, seine Käthe.
Mittenhinein in all das hochwohlgeborene Treiben waren sie also jetzt geraten, Georg, Käthe und ihr Sohn. Wieder gab es eine schöne Villa am Hang, darin unter anderem ein Kinderzimmer und einen Salon.
Sein Erscheinen in der neuen Schule hatte Willi zu Hause vor dem großen Garderobenspiegel geprobt. Das Kinn gereckt, breitbeinig, die Daumen in die Riemen seiner Schultasche eingehängt und die Ellbogen rechts und links wie eine Bewehrung ausgestellt, so wollte er auftreten. Auftreten wie der Zirkusdirektor im Zirkus Krone, der im letzten Herbst ein Gastspiel in Freiburg gegeben hatte, wohin ihn Friedrichs Mama eingeladen hatte, sie selbst hatte die beiden Buben chauffiert in ihrem schönen Benz.
Alles klappte hervorragend. Er war der Beste im Kopfrechnen und das erste Diktat ergab eine glatte Eins. Beim Völkerball im Schulhof wurde er von beiden Mannschaftskapitänen angefordert, sie stritten regelrecht um ihn. Und mittags nach der Schule hüpfte er beschwingt zum „Krokodil“ zurück, weil er dort etwas zu essen bekam.
Irgendwo wurde wieder ein kleines Fleckchen leergeräumt, dort stand dann dampfende Suppe oder ein Stück Fleisch mit Soße, ab und zu Dampfnudeln mit Weinschaum. Weinschaum? War denn das was für einen Sechsjährigen? Also bitte, darum konnte man sich nicht auch noch kümmern, ein Kind musste eben ...
„... mitlaufen? Willst du das sagen? Ich kann’s nicht mehr hören, Georg. Wir haben ihn doch gewollt, wir haben uns gefreut über ihn, als er kam.“
„Ja, ja, ja. Aber das sind schwere Zeiten. Da müssen Kinder sich dünn machen. Es ist gut, wenn sie das schnell begreifen.“
Käthe wusste, woher diese Meinung kam. Das hatte Georg so machen müssen, schnell begreifen, wie das Leben lief. Er hatte sich seinen Platz suchen müssen, der kleine Bub, damals zwischen den Brüdern, auch draußen zwischen den Tabakpflanzen und im Winter dann in der engen Bauernhausstube. Dagegen war Käthe ein Einzelkind gewesen. Der Mittelpunkt ihrer kleinen Familie. Wenigstens eine Zeit lang. Vater, Mutter, Kind. Wenigstens bis der Vater krank wurde und dann mehr und mehr die Aufmerksamkeit der Mutter beanspruchte. Bis er starb, bis dann die Mutter krank wurde und sich daraus eine neue Nähe ergab für die beiden, die Mutter und das heranwachsende Mädchen.
„Käthe, hier kommen die frischen Erdbeeren, der Bote will gleich das Geld haben.“
Lang konnte Käthe sich niemals den anderen Gedanken hingeben, denjenigen, die sich nicht um die täglichen Routinen des Hauses drehten. Sie ging an die Theke und suchte die vielen Scheine zusammen, die es brauchte, um diese Schuld zu begleichen.
Manchmal konnte Georg seine kleine Familie auch überraschen mit ausgefallenen Ideen. Aus dem Blauen heraus nahm er Willi eines Tages bei der Hand, setzte ihn an einen leeren Tisch, dessen Damast glitzerte unter den gläsernen Tropfen der Lüster. Schnipste mit den Fingern und ließ ihm auftischen, seinem Sohn. François, der Chef de Salle, wurde herbeizitiert. Er zog sich die weißen Baumwollhandschuhe an, knöpfte sie über dem Puls zu und räkelte alle zehn Finger in ihrer Verhüllung. Dann ging es los. Zwei Teller übereinander. Zwei Gabeln links, zwei Messer rechts, ein größerer Löffel, ein kleinerer Löffel und eine kleine Gabel hinter dem Teller, jedes einzelne Teil noch einmal liebevoll gestreichelt, so sah es aus, wenn die Besteckteile erneut in den behandschuhten Händen zu ihrem makellosen Glanz gerüstet wurden. Die Serviette aus steifem Leinen wurde neben das Gedeck gelegt. Ein kleines Tellerchen mit kleinem Messer links, drei Gläser rechts hinterm Teller. Wieder schnipste der Vater und hielt plötzlich eine Tasse mit zwei Henkeln in der Hand. Wartete dann wortlos, bis Willi endlich verstand, dass er die Serviette vom Tisch nehmen musste, und sie auf seinen Schoß breitete. Die Suppe roch nach Fisch. Willis Magen revoltierte gegen diesen Geruch.
„Bon appétit.“
Das kannte er, diese Zauberformel. Er griff sich den kleinen Löffel, aber bevor er ihn in die Suppe tunken konnte, schleuderte ein schneller scharfer Schlag der väterlichen Hand den Löffel quer über den Tisch. Jetzt kam ein langer Vortrag, wann was wie zu benutzen wäre. Das war der Dessertlöffel, der Suppenlöffel lag hier. Und immer zwischendrin die Lippen mit der Serviette abtupfen. Der Vater ließ die Gläser füllen, nacheinander. Wasser, weißer Wein, roter Wein, ließ die Speisen auftragen. Schon im Mund wurde alles dick und dicker und wollte dann nicht hinunter in den Magen rutschen. Willis Ohren glühten, er schlenkerte mit den Beinen, um seine Nervosität abzuleiten.
Da rief es von hinten und der Vater wurde gebraucht. Willi ließ Gabel und Messer fallen. Gott sei Dank musste er nicht weiteressen, er wollte es nicht und er würde es nicht tun. Er schlich sich hinaus auf die Straße und marschierte los, dabei rannen ihm die Tränen über die Wangen. Irgendwann drehte er um, versuchte seinen Weg zurückzufinden, es dauerte lange, wurde schon dunkel und ihm war kalt. Jetzt würde er noch geschimpft, dass er sich aus dem Haus bewegt hatte, davor graute ihm schon. Aber keiner hatte ihn vermisst. Als er an der Theke auf den Vater traf, lächelte der ihn an und sagte: „Na, Lektion gelernt?“
Da wunderte sich Willi sehr und lächelte zurück. Georg zwinkerte ihm zu, schob ihn in die Küche und ermahnte ihn: „Hausaufgaben nicht vergessen. Käthe, hier kommt dein Sohn, er braucht dich.“ Dann war er verschwunden wie der Zauberer im Märchen. Die Mutter zog ihn in eine Ecke, schob Töpfe und Teller zur Seite und stellte eine Schale mit „Krämalamande“ vor ihn. Die kannte er, die liebte er, die löffelte er schnell. Dann ließ er den Kopf auf die Arme sinken und einen Augenblick später war er eingeschlafen.
Das Gute ist gut oder böse, das Böse kann böse oder gut sein. Das Helle dunkel, das Schwarze grau oder bunt werden. Nichts ist sicher. Aber er wird nicht in einen Bären verzaubert, er weiß, dass Rumpelstilzchen so heißt, dass man der Hexe nicht in ihr Haus folgen darf und nicht in den roten Apfel beißen. Man muss immer auch für den dreizehnten Gast ein Gedeck und einen Stuhl parat haben, und wenn die Hecke riesengroß ums Haus wachsen sollte, dann nimmt man sich eben eines der scharfen Messer aus der Küche und schlägt drauf auf die stacheligen Zweige, bis man wieder einen Weg hinaus gefunden hat. Gott sei Dank hatte er sich alles gut gemerkt, was Mamamine ihm abends im Bett vor dem Einschlafen vorgelesen hatte.
17
Die Sommer kamen in diesen Jahren schnell, Mine holte Willi ab, nahm ihn mit an den See und nach wenigen Tagen war Willi eingetaucht in das andere Leben, in dem die tagtägliche Wiederkehr bekannter Ereignisse und Erlebnisse seinen Erwartungen ein zuverlässiges Muster gab.
Er saß neben Herrn Regelmann auf der Terrasse und schaute den Bienen zu, die sich zwischen den Geranienblüten tummelten, es gab wieder einen Hund im Haus, einen kleinen Schnauzer, der furchteinflößend giftig bellte. Willi warf ihm Stöckchen und sagte dann „aus“, energisch wie ein Offizier – so hatte es Fried ihm beigebracht –, bis Flox das Stöckchen fallen ließ. Das konnte man endlos wiederholen. Es fühlte sich wunderbar an, das warme weiche Fell zu streicheln und dabei in der Sonne zu sitzen, Flox anzusehen, zu spüren, dass er nur darauf wartete, weiterspielen zu können, dass er bereit dazu war, jederzeit. Das macht so zufrieden, dachte Willi.
Heli begegnete er nicht, obwohl er immer wieder ins Gebüsch kroch und sich am Maschendrahtzaun entlangarbeitete, bis das Nachbarhaus in Sicht kam. Die Läden waren alle zugeklappt, die Gartenstühle an den Tisch gekippt, die Blumenkästen leer, in der Wiese blühten überall dicke gelbe Löwenzahnpflanzen und Büschel von Gänseblümchen. Was hatte das zu bedeuten?
„Na, wie gefällt es dir denn in deiner neuen Schule?“, fragte ihn Frau Amalie.
„Gut“, antwortete er knapp und schaute sie nicht an dabei.
Er nahm ihr den Eimer mit den in Haferflocken eingeweichten zerstoßenen Eierschalen ab und brachte ihn zu den Hühnern. Das Gatter war schwer zu öffnen, der Klapphaken ganz verbogen. Das konnte doch so nicht bleiben. Willi wusste, wo Fried sein Werkzeug hatte. Er holte eine Zange und versuchte, den Haken zu biegen. Als das nicht gelingen wollte, holte er sich einen Hammer, zuerst einen großen, der ihm nicht gehorchte, daraufhin den kleineren, den er schließlich in beide Hände nahm. Am Anfang traf nur jeder fünfte Schlag auf den Haken. Willi schwitzte, seine Zunge fuhr zwischen den verkrampften Lippen hin und her. Er ließ nicht locker, die Schläge wurden kräftiger, schneller und schließlich traf er fast jedes Mal und konnte deutlich sehen, dass der Haken sich dorthin bog, wo er gebraucht wurde, um später in seinem Anker zu landen, sicher, genau, verlässlich.
„Da kann man einen Ochsen daran aufhängen“, sagte er zu sich selbst, als er sich sein Werk betrachtete. Der Haken war repariert, das Werkzeug wieder dorthin gebracht worden, wo es Fried suchen würde, und die Zeit hatte einen Riesensprung gemacht, schon konnte Willi an den Gartenzaun stehen, die Straße hinunterschauen, gleich würde Mine dort unten erscheinen, an jedem Arm würde sie eine Tasche tragen, aber nicht lange, denn Willi würde ihr entgegeneilen und ihr die eine abnehmen, vor allem, damit sie ihm das Haar aus der Stirn streichen und fragen konnte: „Na, wie war dein Tag?“
Das gefiel ihm schon besser. Mine hatte genau die richtige Melodie in ihren Sätzen, man merkte, dass sie es wirklich wissen wollte und die Frage nicht nur stellte, um eine Frage zu stellen.
Willi würde also die Tasche tragen und dabei hochmütig an Frau Klemper vorbeischauen, der Nachbarin, weil er sie nicht mochte, seit er gehört hatte, wie sie sich lang und breit über „die Franzosenwirtschaft“ beschwerte bei Amalie. Die Französin lasse so viel Unkraut stehen am Gartenzaun, den Hahn müsse sie endlich mal schlachten, der krähe schon ganz heißer und die Quitten müssten runter vom Baum, was war denn das für eine welsche Wirtschaft da nebenan. Seiner lieben Mamamine durfte man so nicht hinterherreden. Das hieß, wer das tat, war ein Nichts für ihn. Das hatte ihn Jenny gelehrt. Wie man an einer Person vorbeiging, die man strafen wollte für ungebührliches Benehmen: Man strafte sie mit Nichtbeachten, ließ sie so „in der Kälte stehen“.
Schon auf dem Heimweg würde er Mine alles berichten, was an diesem Tag wichtig gewesen war für ihn oder zumindest das, was man erzählen konnte. Vom leeren Garten nebenan, von seiner Sehnsucht, Heli zu sehen, von seiner Traurigkeit, hier noch keinen Kameraden gefunden zu haben, außer Flox natürlich, da wollte er nicht undankbar sein, aber von seiner Not, die zähe Zeit verstreichen zu lassen, würde er nicht sprechen, weil Mine das nur traurig machte. Er wusste ja immer, wie man sich was zu schaffen machen konnte.
Dann kam die Mutter zu Besuch und plötzlich brauchte er sich nichts mehr zu schaffen machen, weil Käthe so viel vorhatte mit ihm. Boot fahren, schwimmen lernen, schöne Steine sammeln; sie zeigte ihm die Marienschlucht und das Echo, zusammen gingen sie in die Meersburg und überlegten sich, ob sie dort gerne hätten leben wollen, sie fuhren mit der Kutsche nach Unteruhldingen und schauten sich die uralten Hütten auf dem Wasser an, wo Menschen „schon vor unserer Zeit“ gelebt hatten.
„Was ist unsere Zeit?“, fragte Willi und Käthe musste seufzen und überlegen, wie sie das erklären sollte. Jetzt flog sie, „unsere Zeit“. Schließlich kam auch der Vater und blieb über Nacht, am nächsten Tag mussten sie sich von Mine und Fried verabschieden, was Willi gar nicht so schwer fiel. Fröhlich winkte er aus dem Zugabteil und hüpfte dann auf und ab, weil er sich auf die Schule freute, den Völkerball, das Kopfrechnen und auch auf Jenny, Imogen, Herrn Kuppinger, den Pförtner, und Herrn von Majakovsky, den Stammgast. So einen gibt es immer und überall. Und diesen neuen liebte er besonders, denn er unterhielt sich immer gern mit Willi, stellte ihm Fragen, erzählte ihm Witze, half ihm bei den Hausaufgaben und schenkte ihm Klebebildchen.
18
Wie schnell wurde es dann stürmisch! In der Gönneranlage gab es fast keine Rosen mehr, von den alten Bäumen in der Lichtenthaler Allee fielen die handtellergroßen bunten Blätter. Eines Tages brachte der jüngste Sohn der Birons ein kleines Fahrrad, das ist für Willi und seine Mutter lässt fragen, ob Käthe am nächsten Sonntag wieder einmal zum Kochen kommen kann. Dann brauchte Willi neue Stiefel und einen Schal und ein dicker Adventskranz wurde in der Eingangshalle aufgehängt.
Seinem Vater wäre es recht gewesen, wenn er sich mit Joseph Warminger angefreundet hätte. Dessen Vater war der Dirigent vom Kurorchester und auch ein Stammkunde, ein gerne gesehener Gast, besonders wenn er die Solokünstler und ihre Entourage mitbrachte, abends nach den Konzerten. Da wehte durch die Halle ein ganz besonderer Wind, der Georg an die Zeit auf der Lusitania erinnerte oder vielleicht sogar ans Adlon, wenn dort die adligen Herren mit Damen am Arm erschienen, die ihre Nasen und Münder diskret hinter langhaarigen Pelzkrägen verbargen, sodass ihre Augen darüber wie Magnete wirkten, in deren Bann man nicht geraten durfte, weil man sonst seine Position vergessen konnte, dass man nämlich ein Niemand war, ein namenloser Schatten, ein Hintergrund, vielleicht ein angenehmer, wenn man seine Sache gut machte, einem weichen Teppich vergleichbar.
Im Advent nahm die Hektik zu und Willi mit seiner Wuseligkeit, seiner Neugier, seiner Energie war wieder einmal überall im Weg.
„Ach Gott, was soll ich sagen, es wird Zeit, dass du mal allein bleibst droben im Haus, es kann dir dort doch nichts passieren und du weißt doch, dass wir dann auch nach Hause kommen.“
„Aber nein, meine liebe Frau Hug“, Herr von Majakovsky verstand, dass das Kind nicht oben in der Villa bleiben wollte. Allein! Er kannte dieses Gefühl des Alleinseins, es war nicht gut, wenn das schon ein Kind verspüren musste. Also bat er um die Erlaubnis, Willi unter seine Fittiche zu nehmen, dann und wann einen kleinen Ausflug mit ihm zu machen.
„Ja, also wenn er Sie nicht stört.“
Nein, im Gegenteil.
So zogen also diese beiden los und Willi wusste nicht, wie ihm geschah, als er mit Herrn von Majakovsky plötzlich in einer großen Halle voller Menschen saß, direkt neben einem Mann, der Klavier spielte, und es dunkel wurde und vorne auf einer großen Fläche Bilder entstanden, die sich bewegten, und sie eintauchen konnten in eine andere Welt, ihre eigene Bedingtheit, ihre Sorgen, die quälenden Unzulänglichkeiten ihres realen Lebens vergessend.
Es war eine aufregende spannende Geschichte von einem kleinen Jungen und einem Mann, die sich zufällig treffen. Der Mann ist Glaser, aber keiner in der Stadt braucht neue Fenster. Da haben sie zusammen eine rettende Idee: Der Junge wirft Steine in die Fenster und rennt schnell weg. Daraufhin kommt der Mann und bietet an, sie zu reparieren, was nun gerne jeder annimmt. Als ein großer dicker Polizist den beiden auf die Schliche kommt, wollte Willi aufstehen und gehen. Gott sei Dank blieb er dann doch sitzen bis zum guten Ende.
Tagelang sah er die Bilder immer wieder vor sich, erinnerte sich an die Geschichte, plagte die Mutter, noch einmal mit ihm dorthin zu gehen zum Kinematographen, aber sie hatte einfach keine Zeit dazu, das musste er doch verstehen. Jenny ließ sich schließlich von ihm gewinnen mitzukommen. Der Mann an der Kasse erinnerte sich noch an ihn, weil Herr von Majakovsky ihn förmlich vorgestellt hatte, „der Kleine aus dem ,Krokodil‘ “, sagte er und der Mann an der Kasse nickte Verstehen.
„Na, mein Freund, hat’s dir so gut gefallen?“, begrüßte er ihn lächelnd. Und Willi nickte.
Von da an machte er sich regelmäßig auf nach dem Mittagessen, wenn die Hausaufgaben fertig waren, und schlenderte hinüber ins Aurelia Kino zu Herrn Beck, so hieß der Besitzer, sein neuer Freund, nur um ihm guten Tag zu sagen oder vielleicht um die Prospekte in der Eingangshalle zu sortieren, die abgerissenen Eintrittskarten und die Bonbonpapiere vom Boden zu sammeln oder auch alles, was die Damen und Herren so zwischen die Stuhlreihen hatten rutschen lassen, für Herrn Kammerle, den Pianisten, die Noten zu sortieren, ihm sein Bier und seinen Wurstweck zu bringen, und dies und das.
Kurz vor Weihnachten rief Herr Beck Willi zu sich und hielt ein kleines grünes Blatt in der Hand.
„Weißt du, was das ist, Willi?“
Nein, er wusste es nicht.
„Das ist ein kleines Wunder. Es ist ein Geldschein, ein ganz neuer. Eine Rentenmark. Die kriegst du jetzt von mir für alle deine Arbeit, die du für mich hier geleistet hast. Wer arbeitet, hat verdient, bezahlt zu werden. Schau sie dir an, diese neue Mark. Sie ist klein, aber fein. Auf die werden wir uns wieder verlassen können.“
Willi steckte das Papier ein und zeigte es niemandem. Eine Weile trug er es in der Hosentasche, kruschtelte es immer wieder heraus und betrachtete es. Dann legte er es irgendwann vorsichtig in die Zigarrenkiste, die er von Herrn von Majakovsky geschenkt bekommen hatte und in der er seine Klebebildchen aufbewahrte. Lange überlegte er hin und her, was er dafür kaufen könnte. Auf seinen Streifzügen durch die Stadt betrat er nun das ein oder andere Geschäft und fragte nach den Preisen der Waren, die man dort ausgestellt hatte. Was kostete diese Bonboniere, dieses Stück Seife, diese Zigarre? Für seinen Vater als Geschenk wäre sie gedacht. Aha, nickte der Verkäufer und gab ihm freundlich Auskunft. Die genannten Zahlen hörte er sich an, schrieb sie zu Hause in ein Heft und grübelte darüber nach, wie er so viel Geld zusammensparen könnte.
Jenny schaffte es besser als die Eltern, ihm zuzuhören, auch wenn er einfach so auftauchte mitten am Tag, ohne darauf zu achten, womit sie gerade beschäftigt war. Meist saß sie im Büro und hatte Berge von Papieren vor sich liegen oder sie schrieb viele kleine Zahlen untereinander in ein dickes Buch, mit gestochen schöner Schrift. Die konnten nicht zusammenfallen wie Käthes Soufflé, oder kalt werden wie der Rôti de Jour, den es schnell aufzutischen galt. Und manchmal brauchte nicht er Jenny, sondern sie brauchte ihn. Als Begleitung zum Einkaufen. Sie nahm ihn mit in die schönen Modegeschäfte, er musste sich auf einen Stuhl setzen und warten, bis sie sich in einer kleinen Kabine ein Kleid aus der Auslage angezogen hatte, sich vor ihn stellte und ihn erwartungsvoll ansah.
„Und? Wie steht mir das? Wie sehe ich aus?“
Dann durfte man nicht einfach „schön“ sagen, obwohl sie das war. Sie war immer schön! Man musste sich Mühe geben, das zu umschreiben.
„Diese Farbe passt gut zu deiner Haarfarbe. Man kann deine schönen seidenen Strümpfe sehen, das gefällt mir. Das graue Kleid mit dem Pelzrand sieht eleganter aus als das grüne. Die Perlen am Halsausschnitt glitzern so fröhlich wie deine Augen.“
Bald hatte er eine Anzahl schöner Sätze parat, die Jenny glücklich machten. Wenn sie schon weder mit Albert noch mit einer Freundin einkaufen gehen konnte wie damals zu Hause in München, dann musste Willi ihr doch ein guter Ersatzkamerad sein. Aber meistens sagte Jenny dann eben diesen Satz, dass sie es sich noch einmal überlegen müsste. So war das Einkaufen ein Spiel mit Möglichkeiten und ein herrlicher Zeitvertreib. Besser war es allerdings, sich bei der Rückkehr nicht von der Mutter erwischen zu lassen, weil es sie ein bisschen nervös machte, wenn er seine Zeit mit Jenny verbrachte, und weil sie eigentlich wollte, dass er endlich wieder mit den Buben aus seiner Klasse spielen ging. Ein Kind gehörte unter Kinder.
19
Als es wärmer wurde, ließ er sich also von Amir Komarowski abholen zum Fahrradfahren oder zum Ballspielen auf der Lichtenthaler Allee, dann später zum Tennisbälle Einsammeln an den Plätzen, wo die Herren der großen Villen am Hang sich nach und nach einfanden, da war dann auch der Hermann dabei, der Sohn vom Pfarrer, und der Kurt, der Sohn vom Kurarzt. Am Ende eines langen Nachmittags steckte man jedem der Buben eine Münze zu, einen Zehner, einen Fünfziger oder einmal sogar eine Mark-Münze. Das Geld wanderte in die Zigarrenkiste und sammelte sich dort an. Manchmal legte Willi alles auf seinen Schreibtisch nebeneinander, dann zählte er die Münzen, notierte sie nach Wert, addierte am Schluss und unterstrich diese Summe, indem er sein hölzernes Lineal zu Hilfe nahm, das letzte Weihnachtsgeschenk von Mine und Fried. Diese Summe gab ihm Anlass, beim Einschlafen über Anschaffungen nachzudenken und sich auszumalen, wie der Erwerb dieser Dinge sein Leben verändern könnte.
So und ein bisschen anders ging es weiter. Willi brauchte neue Hosen, weil die anderen zu kurz geworden waren und der Hosenbund spannte, er brauchte neue Stiefel, er schrieb nicht mehr auf die Schiefertafel, sondern in richtige Hefte aus Papier. Die Mutter durfte ihn nicht mehr küssen, wenn der Hermann und der Amir ihn abholten, er brachte Jenny eine Rose mit, als sie Geburtstag hatte – nach langem Hin und Her: sollte er sie einfach abpflücken, dort in der Anlage, wo so unzählig viele nebeneinander standen und eigentlich doch keiner eine besondere Bewunderung zukam, eine der Art, wie Jenny sie zollen würde, davon war er überzeugt, oder war das eventuell Diebstahl und könnte er von einem dicken Polizist am Jackenkragen gepackt und ins Gefängnis gezerrt werden? Also wäre es nicht besser, diese Rose mit eigenem Geld, das er doch hatte, in einem Blumenladen zu kaufen? Dabei fühlte er sich dann wohler, er hätte keine Entschuldigung gehabt für den Diebstahl, das wäre das größte Problem gewesen.
An einem Abend im November, als er nicht allein nach Hause gehen wollte und sich deshalb bis spät in die Nacht noch auf der Lauer befand, wann die Eltern wohl endlich Schluss machen würden und er mit ihnen zusammen zurückgehen könnte in das kalte, leere dunkle Haus am Hang, vertrieb er sich die Zeit damit, so viele halb leere Weingläser an der Theke auszutrinken, dass ihm schwindelig davon wurde und er in die große Bodenvase taumelte, sie umriss, sodass sie zerbrach und das Wasser sich über den spiegelglatten Marmorboden der Eingangshalle ergoss.
Der Vater kam gerannt mit allen anderen, die den Lärm hörten, stemmte die Hände in die Hüften und polterte: „Was ist denn da los“, griff sich seinen Sohn, schnupperte an ihm und dann begann er zu lachen, er lachte noch immer, als Käthe Willi an der Hand nahm und wegzog und dabei ein sehr böses Gesicht machte.
Man konnte eigentlich nie sicher sein, wie etwas ausgehen würde, am besten man war immer auf alles gefasst und überlegte schon mal, was man tun könnte, wenn ...
„Wir leben noch“, sagte Amir immer. Er sagte eigentlich wir „läbben noch“. Und das sei das Wichtigste. Alles andere lasse sich irgendwie richten, solange man noch seine Arme und Beine habe und vor allem seinen Kopf auf dem Hals.
Inzwischen war Willi zehn Jahre alt geworden und würde bald nach Weihnachten schon elf Jahre alt sein.
Am 12. November kam Herr Schupp, der Klassenlehrer, eines Morgens ins Klassenzimmer und teilte ein Blatt aus, ein Formular, das sie den Eltern geben sollten. Es ging um die mögliche Überleitung in eine andere Schule. Nicht alle bekamen dieses Blatt, in Wirklichkeit waren es sogar nur wenige, aber Willi war dabei. Zunächst hatte er keine Ahnung, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war.
Da auch der Kurt und der Hermann solch ein Formular bekommen hatten, wendete er sich an sie und sie erklärten ihm, dass es hier um eine „höhere“ Schule gehe, eine, in der man Mathematik und fremde Sprachen lernen könnte. Nur die guten Schüler, die besten genaugenommen, dürften dorthin gehen. Am Samstag müsste man sich anmelden.