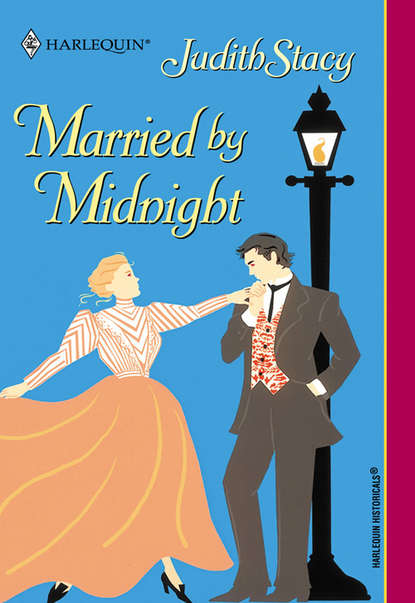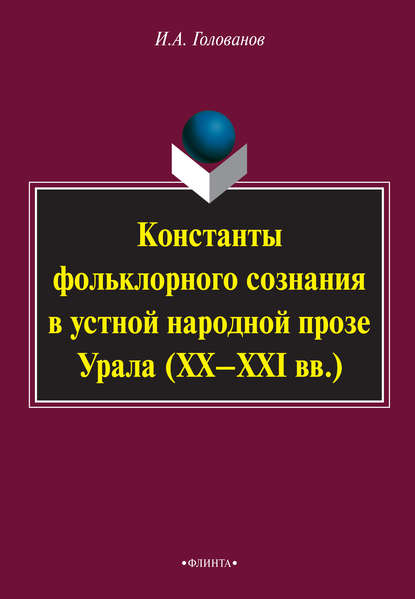- -
- 100%
- +
Wie kann man nun unterscheiden, ob es sich um einen Schub handelt oder um eine Überfunktion?
Ein Schub ist bei vielen gepaart mit einer Art Grippe- oder Krankheitsgefühl, welches häufig mit einem „heißen Kopf oder Gesicht“ einhergeht, aber auch starken Muskelschmerzen, die von einem auf den anderen Tag kommen. Eine leicht erhöhte Temperatur kann ebenfalls Hinweis auf einen Schub geben.
Da der Krankheitsschub bei Hashimoto sich durch starke Entzündungssymptome auszeichnet, kommt es auch zu typischen Entzündungssymptomen wie z. B. einem heißen Gesicht, Schmerzen oder Schluckbeschwerden. Auch Entzündungen der Schleimhäute können ein Signal für einen Schub sein.
Schübe erkennst du am ehesten, wenn du deinen Körper kennen und die Symptome unterscheiden lernst.
Typische Symptome eines Schubs zusammengefasst:
starkes Krankheitsgefühl
Muskel- oder Nervenschmerzen
Erschöpfung
Schluckbeschwerden
Schmerzen an der Schilddrüse
erhöhte Temperatur
Die Ursachen für Schübe sind vielfältig. So kann es sein, dass du im Rahmen deines Zyklus immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, z. B. beim Start der Periode, mit einem Schub reagierst. Genauso gut kann es sein, dass du Gluten gegessen hast oder etwas anderes, worauf du eine Unverträglichkeit hast, und sich das in einem Schub zeigt. Schübe können unterschiedlich lange andauern.
Ist jemandem nicht bewusst, was seinen Schub ausgelöst hat, so kann das schon einmal über mehrere Wochen gehen. In der Regel dauert ein Schub jedoch einige Tage oder Wochen.
Du findest raus, was deine Schübe auslöst, wenn du deine Triggerliste noch einmal genau anschaust.
Jetzt atme erst einmal bewusst durch! Du hast dir in den letzten Kapiteln die Grundlage für deine Gesundheit erarbeitet. Auf dieser Grundlage beruht alles, was wir die nächsten Wochen machen werden! Also klopfe dir auf die Schulter und sei einfach mal stolz auf dich!
Körpertemperatur
Die Wohnung ist geheizt, aber deine Hände und Füße fühlen sich an wie Eisklumpen. Eigentlich hast du sowieso immer das Gefühl, dass die Durchblutung von Händen und Füßen bei dir nicht optimal läuft.
Kennst Du das vielleicht?
Wenn du einmal „kalt“ geworden bist, ist es dir fast unmöglich, dich wieder aufzuwärmen, es sei denn, du steigst in die warme Badewanne.
Du hattest das letzte Mal Fieber als Kind und danach nie wieder wirklich hohe Temperaturen. Du bist, selbst wenn du richtig krank bist, nicht mal im 38er-Temperaturbereich.
All dies sind Warnzeichen, genau wie dauernde Kälte in deinem Körper.
Ein Problem mit der Regulation der Körpertemperatur, egal in welche Richtung, sollte man immer ernst nehmen.
Für ein optimales Funktionieren unserer Stoffwechselvorgänge ist eine „Betriebstemperatur“ von 36,8 – 37 Grad wichtig. Diese Steuerung übernimmt eine Region im Gehirn – der sogenannte Hypothalamus – in enger Zusammenarbeit mit unserer Schilddrüse und den Nebennieren. Der Hypothalamus spielt hierbei eine zentrale Rolle, weil er auch die Ausschüttung der Schilddrüsenhormone steuert.
Arbeiten diese drei Organe richtig zusammen, so wird das als gut eingespielter Stoffwechsel bezeichnet. Dies erkennst du nicht nur an deiner Temperatur – du erkennst es zum Beispiel auch an deinem Gewicht. Unsere ideale Körpertemperatur, die sich in einem sehr engen Schwankungsbereich von ca. 0,5 Grad nach oben und unten bewegt, wird bei Abweichungen hiervon über den Stoffwechsel bei Hitze durch Schwitzen und bei Kälte durch Frieren reguliert.
Frieren ist also definitiv ein Zeichen, dass diese Dreierkombi nicht richtig funktioniert. Dein Körper versucht gegenzusteuern und dies ziemlich oft im Laufe des Tages.
Kennst du dieses innere Frieren ohne jeglichen Grund – quasi ein inneres Zittern?
Erste Hilfe sollte hier immer ein Magnesiumpräparat sein, denn es kann helfen, deine Temperatur zu erhöhen.
Magnesiummangel führt zu Durchblutungsstörungen, die wiederum die Tendenz zum Frieren erhöhen. Also sollte dein erster Schritt eine ausreichende Magnesiumzufuhr sein.
Untertemperatur
Zuerst einmal müssen wir klären, was eine Untertemperatur überhaupt ist und wo sie beginnt. Von einer Untertemperatur können wir ausgehen, wenn die Basaltemperatur am Morgen gemessen länger als 3 Tage unter 36,8 liegt.
Die Ursachen für eine Untertemperatur können sehr unterschiedlich sein. So sind in einigen Fällen Schwermetalle, bestimmte Lebenssituationen (z. B. wenig Schlaf), aber auch organische Ursachen hierfür verantwortlich. Des Weiteren können z. B. einige Medikamente daran beteiligt sein, dass die Körpertemperatur absinkt.
Insbesondere kommen hier infrage:
Cortison (auch Salben oder Asthmaspray)
Diuretika (Entwässerungstabletten)
Antibiotika
Antidepressiva
Schlaftabletten
Hormone (auch Spirale oder Antibabypille)
Weitere Ursachen, die unsere Körpertemperatur sinken lassen, sind Genussmittel wie:
Alkohol
Nikotin (Tabakwaren, Zigaretten und E-Zigaretten)
Es handelt sich dabei um Giftstoffe, die unsere Mitochondrien lahmlegen können.
Mitochondrien sind vereinfacht erklärt die Kraftwerke unseres Körpers. Sie stellen fortlaufend Energie bereit, wenn diese benötigt wird. Diese Zellen im Körper sind zuständig für die ATP-Produktion. ATP ist praktisch unsere Lebensenergie, also ein Energiemolekül. Wenn Energie im Körper produziert wird, steigt unsere Körpertemperatur. Dies kennen wir, wenn wir Sport machen und ins Schwitzen kommen. ATP ist also ein Molekül, welches bei der Temperatur eine Rolle spielt. Ist nicht genug da, ist auch deine Körpertemperatur immer etwas niedriger. Im späteren Kapitel gehe ich näher darauf ein.
Die wichtigsten Organe, die sehr großen Einfluss auf unsere Körpertemperatur haben, sind die Schilddrüse und die Nebennieren. Ohne eine gut funktionierende bzw. eingestellte Schilddrüse können viele wichtige Stoffwechselvorgänge im Körper nicht ausgeführt werden. Da die Schilddrüse aber in engem Austausch mit unseren Nebennieren arbeitet, können wir uns nun auch gut vorstellen, warum auch die Nebennieren erkranken, wenn das gesamte System nicht richtig zusammenspielt. Insbesondere bei Hashimoto ist es sehr oft so, dass die Umwandlung der Schilddrüsenhormone nicht richtig funktioniert und so trotz Hormonen die Temperatur immer im unteren Bereich bleibt.
Ereignisse oder Lebensumstände, welche die Körpertemperatur ebenfalls beeinflussen sind unter anderem:
Impfungen
kalte Nahrungsmittel + Getränke
viel Rohkost
Lebensstress
Bewegungsmangel
Übergewicht
Mineralmangel
Vitamin-D-Mangel
wenig Schlaf (z. B. mit Baby)
Zyklusstörung
Magnesiummangel
Diese können unseren Körper enorm ausbremsen und es so dem Stoffwechsel sehr schwer machen, die Körpertemperatur im idealen Bereich zu halten.
Zu hohe Temperatur
Wie kommt es zu einer hohen Körpertemperatur?
Hohe Körpertemperaturen kennen die meisten Menschen nur im Zusammenhang mit Fieber. Hierbei steigt die Temperatur über 37,5 und es sind meist Infekte, Viren oder Bakterien im Spiel.
Zu beachten ist hier, dass Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto meist kein Fieber bekommen, sondern lediglich maximal eine erhöhte Temperatur. Das Gefühl ist aber dem Fieber gleich – man fühlt sich sehr schlecht und matt. Hier solltest du besonders aufpassen, weil auch schwerwiegende Krankheiten zu spät erkannt werden können.
Hat man aber beständig eine hohe Körpertemperatur ist meist eine Überaktivität der Schilddrüse schuld. Dies ist zum Beispiel bei Morbus Basedow der Fall, wo durch den stark erhöhten Stoffwechsel die Temperaturen gern dauerhaft über 37 Grad hochgehen.
Auch dies ist ein Zeichen eines starken Ungleichgewichtes im Dreiergespann – Hypophyse, Nebennieren und Schilddrüse. Ein weiterer wichtiger Grund für eine erhöhte Körpertemperatur sind sogenannte stumme Viren. Hierbei gehe ich insbesondere auf chronisches EBV (Epstein-Barr-Virus) und Herpes, aber auch auf die Streptokokken-Bakterien ein. Da es hierbei oft zu einer hohen Belastung des Immunsystems kommt, ist der Körper quasi immer in „Aufruhr“ und es kommt zu sehr hohen Temperaturen – entweder dauerhaft oder immer wieder in Schüben. Die Betroffenen fühlen sich dann auch so – sie sind erschöpft, haben wenig Energie, sind müde und haben das Ge-
fühl innerer Unruhe.
Um die Liste komplett zu machen – ein weiterer wichtiger Grund für eine hohe Körpertemperatur ist ein hoher Cortisolspiegel.
Cortisol hebt die Körpertemperatur an und erhöht den Blutzucker. Ist man ständig unter Stress, steigt der Cortisolspiegel an und es kommt zu dauerhaft erhöhten Temperaturen, gepaart mit Unruhe und Rastlosigkeit. Da der Cortisolspiegel durch deine Nebennieren reguliert wird, ergibt sich hier auch die Wichtigkeit der Unterstützung deiner Nebennieren.
Wie ist meine Temperatur?
Soviel zur Theorie – aber dieses Buch soll dir nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern dich auch durch den Prozess durchgeleiten, deine Körpertemperatur selbst in den
„normalen Bereich“ zu bekommen.
Nichts funktioniert ohne eine gute Bestandsaufnahme. Solange du nicht weißt, was aktuell dein Problem ist, kannst du es nicht wirklich gut angehen. Wie bereits erwähnt ist das Gehirn unglaublich intelligent. Die Gewöhnung an die Symptome, aber auch das Nichtwahrnehmen dieser ist häufig ein Grund dafür, dass eben auch die Körpertemperatur nicht im Zusammenhang mit der Schilddrüse gesehen wird. Es gibt zwei Möglichkeiten der Temperaturmessung. Um für dich die beste Methode rauszufinden, erkläre ich hier beide.
Bitte nutze dazu das Arbeitsblatt „Temperatur“, welches du unter dem Link im Kapitel „Fibelmaterial“ am Ende des Buches findest.
Deine Aufgabe!
Bitte nimm dir die Zeit und miss deine Aufwachtemperatur! Dies ist für dich ein wichtiger Indikator, um deinen Körper besser zu verstehen!
1. Variante Basaltemperatur
Das ist die Temperatur direkt nach dem Aufwachen. Gemessen wird sie im Bett, noch vor dem Aufstehen. So erhält man die niedrigste Temperatur des Tages, die mit der Funktion der Schilddrüse im Zusammenhang steht. Die Temperatur sollte für die erste Beurteilung mindestens vier Tage lang gemessen werden.
Diese vier Tage müssen nicht zusammenhängen – es sollte aber immer zur gleichen Zeit am Morgen gemessen werden. (Man kann auch jeden zweiten Tag messen.)
Wichtiger Tipp:
Thermometer direkt am Bett griffbereit hinlegen.
Wenn man gerade erkältet ist, macht der Test keinen Sinn, weil die Temperatur erhöht sein kann. Dann wartet man, bis man wieder gesund ist.
2. Variante Temperatur im Tagesverlauf
Dabei wird die Temperatur dreimal pro Tag gemessen. Das erste Mal drei Stunden nach dem Aufwachen und danach noch zwei weitere Male im Abstand von drei Stunden. Also beispielsweise um 9.00 Uhr, um 12.00 Uhr und um 15.00 Uhr.
Die gemessenen Werte werden addiert und die Summe dann durch 3 geteilt.
Beispiel:
35,8 um 9
36,3 um 12
36,5 um 15 Uhr
Sieht dann so aus:
35,8 + 36,3 + 36,5 = 108,6
108,6 / 3 = 36,2
Das Ergebnis in unserem Fall ist 36,2 °C – Tagestemperatur nach Bruce Rind.
Der optimale Wert der Tagestemperatur liegt nach Bruce Rind bei 37 °C. In unserem Beispiel wäre die Körpertemperatur zu niedrig.
Bitte nutze dazu das Arbeitsblatt „Temperatur“, welches du unter dem Link im Kapitel „Fibelmaterial“ am Ende des Buches findest.
Temperaturschwankungen bei hormoneller Dysbalance
Die Temperatur verläuft bei Frauen in einem bestimmten Rhythmus – dieser ist dem Zyklus der Frau angepasst. Ein normal verlaufender Zyklus mit normaler Temperatur würde folgendermaßen aussehen:
Wir starten mit Beginn der Periode – die Temperatur liegt dann bei ca. 36,5 °C, im Verlauf des Zyklus steigt die Temperatur eigentlich recht kontinuierlich auf 36,8 Grad an – bis ca. einen Tag vor Beginn der Periode. Am Tag der Periode fällt die Temperatur wieder auf 36,5 °C ab.
Verhält sich die Temperatur nun anders – sinkt sie z. B. nicht mit Beginn der Periode – ist dies ein relativ sicheres Zeichen für ein Ungleichgewicht im Östrogen-, Progesteron- und Testosteronspiegel. Steigt die Temperatur nicht im Verlauf des Zyklus, ist ebenfalls eine Störung im hormonellen Gleichgewicht vorhanden.
Sollte dies bei dir der Fall sein, solltest du dein Augenmerk auf die hormonelle Balance ausrichten und deine Sexualhormone untersuchen lassen.
Nach den Wechseljahren beträgt die Temperatur zwischen 36,5 und 36,8 °C und folgt keinem Zyklusverlauf mehr. Beachte bitte, dass es im Wechsel selbst noch Schwankungen geben kann.
Für wen ist die Basaltemperaturmethode ungeeignet?
Die Temperaturmethode eignet sich nicht, wenn dein Schlafrhythmus stark gestört ist, also wenn du beispielsweise starke Schlafstörungen hast, ein Kleinkind zu versorgen hast oder in der Nacht öfter wach liegst. Sollte dies bei dir der Fall sein, empfehle ich dir die dreimalige Messung im Tagesverlauf, da sie in diesem Fall ein klareres Bild für dich zeigt.
Blut-/Laborwerte
In diesem Kapitel zeige ich dir, wie deine Blutwerte zu lesen sind. Ein ganz großes Problem bei Hashimoto ist, dass man nicht informiert wird. Die meisten Menschen können ihre Werte gar nicht lesen und wissen auch nicht, was zu berücksichtigen ist oder was die Werte überhaupt aussagen. Dieses Kapitel gibt dir Klarheit über deine Werte. Dazu besorge dir bitte neue Werte oder verwende deine letzten Werte vom Arzt.
Unter dem Link „Blut/ Laborwerte“ im Kapitel „Fibelmaterial“ findest du eine tolle Alternative, um an deine Blutwerte zu kommen.
Schilddrüsenwerte
Der bekannteste Schilddrüsenwert ist der TSH. Dieser wird von der Schulmedizin gerne zur Bestimmung der Schilddrüsenfunktion herangezogen. Der TSH allein ist aber extrem störanfällig – daher würde ich empfehlen, auf jeden Fall fT3 und fT4 zusätzlich zur Beurteilung zu nutzen. Einmal im Jahr würde ich auch die TPO-AK bestimmen lassen, um abschätzen zu können, wie stark der Autoimmunprozess ist.
Der TSH
Dieser wirkt aufs Schilddrüsengewebe, auf die Ausschüttung der freien Hormone und wirkt auf die Aufnahme des Spurenelements Jod.
Warum ist der TSH störanfällig?
Viele äußere Faktoren haben Einfluss auf die Höhe des TSH, so reicht eine Nacht mit wenig Schlaf aus, um den TSH zu erhöhen. Weitere Faktoren, die den TSH erhöhen, sind Stress, Belastung, Kälte, Medikamente und auch die Ernährung, die eine große Rolle spielt. Ein weiterer Faktor ist die Abnahmezeit, wird das Blut am Morgen abgenommen, ist der TSH wesentlich niedriger als am Nachmittag oder Abend.
Du siehst, wie wichtig es für dich ist, alle 4 Werte parallel zu betrachten.
Was bedeutet das fT4?
Hierbei handelt es sich um ein freies Schilddrüsenhormon. T4 gehört auch zur Standardtherapie – hierbei wird den Betroffenen ein T4-Präparat zur Behandlung von Hashimoto verschrieben (z. B. L-Thyroxin, Euthyrox oder Eferox).
Das T4 ist eines der Schilddrüsenhormone, die für den
Stoffwechsel, das Wohlbefinden und die Energie wichtig sind.
Dieses T4 wird vom Körper umgewandelt in ein verfügbares T3, denn erst dann ist es nutzbar.
Genauer gesagt wird das T4 von der Leber, dem Darm und den Muskeln in ein verfügbares T3 umgewandelt. Das T3 ist unser Energiehormon, und damit quasi die aktive Form, die unser Körper auch nutzen kann.
Der fT3-Wert
Dieser hat also den höheren Stellenwert, wenn es um das Wohlbefinden und die Energie geht, da ja, wie wir eben gelernt haben, das T3 unser Energiehormon ist.
Warum fT3, T3 und fT4, T4?
T3 und T4 liegen im Körper in gebundener und freier Form vor. Nur als freies T4 und T3 (fT4 und fT3) fungieren sie als Botenstoffe und werden für die Diagnose verwendet.
Nutze hier meinen „Werterechner“, unter dem dazugehörigen Link im Kapitel „Fibelmaterial“ am Ende des Buches. Der Werterechner zeigt dir deinen Anteil fT3 und fT4 an und gibt Anhaltspunkte zu deiner Schilddrüseneinstellung.
Wie du jetzt weißt, werden die meisten Menschen mit einem T4-Präparat behandelt. Wenn deine Umwandlung nicht optimal funktioniert, weil du beispielsweise die Antibabypille nimmst, dein Darm geschädigt ist oder du eine Fettleber hast, dann kann dein Körper mit dem T4-Präparat nicht optimal arbeiten und es nicht in fT3 umwandeln.
Das bedeutet, dass die Umwandlung eine Grundvoraussetzung für das Wohlbefinden bei Hashimoto ist. Etwas später erkläre ich dir genau, wie du diese „Baustelle“ optimal für dich angehst.
TPO-AK
(oder auch als MAK bzw. Anti-TPO ausgewiesen)
Dieser Wert ist der spezifische Hashimoto-Antikörperwert. An diesem erkennst du, wie „aktiv“ dein Hashimoto ist.
Ab einem Wert von 34 (IU/ml) gilt Hashimoto als nachgewiesen. Da es aber auch eine Hashimotoform ohne erhöhte Antikörperwerte gibt, macht es immer Sinn, parallel auch einen Schilddrüsenultraschall machen zu lassen.
Wichtig bei Ultraschall/Szintigrafie!!!
Bei Verwendung von Kontrastmittel weise darauf hin, ein jodfreies Kontrastmittel zu verwenden. Es kann sonst sein, dass du danach in einen Schub kommst und es dir dadurch schlecht geht.
Was bedeuten die TPO-AK-Werte?
TPO-AK bis 200: länger bestehendes Hashimoto
TPO-AK 200 – 1300: aktives Hashimoto
TPO-AK über 1300: sehr aktives Hashimoto
Bei allen TPO-AK-Werten über 200 sollte begonnen werden gegenzusteuern, denn erhöhte TPO-AK-Werte sind assoziiert mit Ängsten, Panik und starken Schüben!
!Achtung!
Bei der Einnahme von natürlichen Schilddrüsenhormonen kommt es in einigen Fällen zu stark erhöhten TPO-AK-Werten. Hierbei ist zu prüfen, ob das Medikament überhaupt zu dir passt, um im Zweifelsfall einen Wechsel anzugehen.
Nun hast du einen Überblick über deine Schilddrüsenwerte. Da Hashimoto aber ebenso einen ganz starken Einfluss auf andere Organe hat, wie z. B. Leber, Darm, Nebennieren, müssen wir uns in diesem Zusammenhang auch die Blutfettwerte, die Leberwerte und die Blutzuckerwerte anschauen.
Die Blutfettwerte
LDL, Gesamtcholesterin und Triglyceride sind bei Hashimoto oft deutlich erhöht, HDL ist meist zu niedrig.
Es sollte ganz klar gesagt werden, dass Cholesterin eine wichtige Aufgabe bei mit der Bildung von Hormonen hat. Wenn mit der Nahrung nicht genug Fette zugeführt werden oder es zu Stresssituationen kommt, erhöht der Körper automatisch den Cholesterinwert, um die Bildung von Hormonen sicherzustellen. Von daher macht es keinen Sinn, den Cholesterinwert auf ein Minimum zu senken.
Da ein zu hoher Cholesterinspiegel aber ein Ungleichgewicht der Organe anzeigt, sollten wir ihn uns trotzdem anschauen.
Im oben erklärten Zusammenhang wird klar, warum der Cholesterinwert bei Schilddrüsenerkrankungen erhöht ist. Durch die fehlende Stressanpassung, gepaart mit zu wenig Hormonausschüttung, steigt der Cholesterinspiegel an.
Ziel ist also hierbei, die Schilddrüsenhormone und das Stresslevel ins Gleichgewicht zu bringen, damit auch der Cholesterinwert wieder ins Gleichgewicht kommt.
Leberwerte
Die Leberwerte sind bei Hashimoto wichtig, weil eine gesunde Leber die Hauptumwandlungsquelle der Schilddrüsenhormone ist. Ist die Leber geschwächt, führt das ingesamt zu einer starken Beeinträchtigung bei der Umwandlung des fT4 in fT3. Je schwächer sie wird, desto mehr ergibt sich auch die Unfähigkeit zu entgiften. Auf lange Sicht kommt es dann zu einem Teufelskreis zwischen schlechter Schilddrüseneinstellung und Entgiftungsstörung.
Doch warum wird die Leber überhaupt schwach bei Hashimoto? Wie kommt das zustande?
Der erste Punkt – wie oben schon erwähnt – ist die Giftstoffbelastung z. B. durch Medikamente, Ernährung, Umweltgifte, Amalgam, Impfungen usw. Die Leber muss dieser Flut an Giftstoffen gerecht werden, denn sie filtert quasi unser Blut, um es frei zu machen von Giftstoffen.
Der zweite wichtige Punkt bei Hashimoto ist die Belastung durch Bakterien und „stumme“ Viren. Fast jeder HashimotoBetroffene trägt Viren, wie z. B. Herpes, EBV, Borrelien, Streptokokken und noch einige mehr, aber auch Bakterien, wie Streptokokken in sich. Die Viren bzw. Bakterien bilden körpereigene Toxine. Die Leber muss also zusätzlich zur „normalen“ Giftstoffbelastung diese Toxine ebenfalls filtern. Schafft die Leber das nicht mehr, weil wir zu viele Giftstoffe im System haben, vergiften wir uns. Umso wichtiger ist es, immer einen Blick auf die Leberwerte zu werfen.
Aber auch hier gibt es Mittel und Wege, um die Leber zu stärken.
Zuallererst schauen wir uns nun die Leberwerte an und schlüsseln diese auf.
Die wichtigen Leberwerte sind GGT, GPT, GOT und das AP (Alkalische Phosphatase).
Damit du einen groben Eindruck hast, was die Werte aussagen, erkläre ich sie dir kurz.
GGT
ist ein Enzym in den Leberzellen, welches bestimmte Aminogruppen überträgt. Erhöht ist dieser Wert bei Leberzellzerfall, aber auch bei Hepatitis, EBV-Belastung (erinner dich, das ist der Erreger, der eine große Rolle bei Hashimoto spielt), Entzündungen der Gallenblase, Gallenstau.
GPT
ist ebenfalls ein Enzym und gibt den meisten Aufschluss über die Leberfunktion. Auch hier spricht man bei erhöhten Werten von einem Leberzellzerfall.
GOT
ist ebenfalls ein Enzym, welches jedoch nicht nur in der Leber vorkommt, sondern auch in Muskelzellen wie dem Herzmuskel. Dieser Wert ist z. B. nach einem Herzinfarkt erhöht, aber auch bei einer Fettleber oder Hepatitis.
AP (Alkalische Phosphatase)
kommt auch in anderen Organen vor, ist aber auch ein Leberwert. Erhöhte AP-Werte findet man bei Gallenproblemen und Lebererkrankungen, aber auch bei Erkrankungen der Knochen, wie z. B. Knochenbrüchen.
Wichtig!!!
Deine Leber ist meistens nicht erst dann schwach, wenn du bereits erhöhte Leberwerte hast. Oftmals ist auch davor schon eine Schwäche auszumachen und du solltest nicht warten, bis die Werte erhöht sind, sondern vorher aktiv werden.
Blutzucker
Ein ebenfalls wichtiger Parameter bei Hashimoto sind die Blutzuckerwerte. Die häufigste Zweiterkrankung ist der Diabetes Typ 2.
Deine Blutzuckerwerte solltest du kennen und wissen, wo du dich aktuell befindest.
Ohne einen gesunden stabilen Blutzucker ist es fast unmöglich, dass du dich mit Hashimoto gut fühlst.
Die 3 häufigsten Probleme bei Hashimoto sind die chronische Unterzuckerung, Insulinresistenz und Diabetes. Es ist wichtig, diese drei unterscheiden zu können und zu wissen, wo du dich gerade bewegst. In einem späteren Kapitel thematisiere ich den Blutzucker noch mal im Zusammenhang mit den Nebennieren und dem Schlaf, in diesem sortieren wir erst einmal deine Blutwerte.