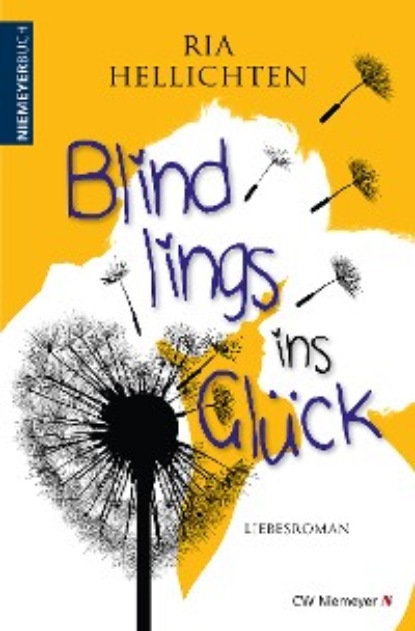- -
- 100%
- +
Nur in den wenigen Stunden, wenn Violetta im Callcenter war, stand er manchmal auf und versuchte, sich allein etwas zu essen zu machen oder ihre Sammlung kleiner Parfumflakons im Setzkasten durcheinanderzubringen, um sie zu ärgern. Mehr als einmal verfluchte er sich dafür, dass er sich hatte überreden lassen, bei ihr zu wohnen, denn jetzt musste er nicht nur mit einer neuen Situation, sondern auch mit einer unbekannten Umgebung zurechtkommen. Er kannte sein eigenes Appartement in- und auswendig, aber die Wohnung seiner Mutter, in der alle Möbelstücke mit einem hartnäckigen Nikotindunst überzogen waren und sentimentale Erinnerungen in jedem Zimmer lauerten, hatte er in den letzten Jahrzehnten gemieden, so gut es ging.
Einmal verließ Johnny die Wohnung sogar. Er arbeitete sich zum Aufzug vor und schaffte es nach einer kleinen Irrfahrt durch die diversen Stockwerke des Gebäudes, im Erdgeschoss durch das Foyer zu gehen. Vor dem Haus war eine Wiese und die Sommerluft umfing ihn warm, duftend und verlockend. Das war sein erster Spaziergang ohne Begleitung seit Wochen. Am liebsten hätte er den Kater mitgenommen, der eigentlich ein Freigänger war und vom Balkon seines Appartements aus die Wiehre erkundete. Aber das wäre zu riskant gewesen.
Mit etwas Mühe fand Johnny auch den Weg zurück ins Gebäude und dann in den achten Stock. Allerdings hatte er aus Gewohnheit die Wohnungstür hinter sich zugezogen und saß an diesem Abend fast zwei Stunden auf dem Flur, bis seine Mutter wieder nach Hause kam und ihm unter Vorwürfen die Tür aufschloss.
Das waren kleine Siege, aber sie bedeuteten ihm alles. Als er es eines Abends geschafft hatte, sich eine Tiefkühllasagne aufzutauen, ohne dass sie im Backofen verkohlt war – am Tag zuvor hatte er bei dem Versuch, ohne seine Mutter zu essen, fast die Wohnung in Brand gesetzt –, überkam ihn ein seltsames Gefühl: Johnny war stolz. Stolz darauf, es allein geschafft zu haben. Er fand sogar den Flaschenöffner und machte sich entgegen allen Warnungen ein Bier auf.
In diesem Moment wusste er, dass er seine Freiheit wiederhaben wollte. Es gab da draußen noch ein Leben, das ohne ihn weiterging, und er wollte es nicht verpassen. Deshalb musste er hier weg und zurück in sein eigenes Reich. Kurzerhand packte Johnny seine Sachen zusammen, zumindest die, die er auf Anhieb finden konnte, schickte seiner Mutter eine knappe Sprachnachricht und bestellte sich und dem Kater ein Taxi.
In seinem Appartement war es angenehm kühl. Ein schwacher, beißender Geruch nach Putzmittel lag noch in der Luft. Jeden Donnerstag kam seine Haushaltshilfe, Milena Kowalski, und auch in den letzten Wochen hatte sie in seiner Wohnung nach dem Rechten gesehen und ab und zu Staub gewischt. Johnny zog die Wohnungstür hinter sich zu, stellte die Transportbox des Katers auf dem Parkett ab und öffnete den Reißverschluss.
Er holte tief Luft und versuchte, unter dem künstlichen Zitronenduft noch etwas anderes, Vertrautes auszumachen, das ihm zeigen würde, dass er zu Hause war. Aber die beruhigende Gewissheit blieb aus. Bis auf das sanfte Tapsen der Katzenpfoten auf dem Holz lag das Appartement vollkommen still da. Johnny streckte die Arme schräg nach vorne aus und tastete sich zum Wohnzimmer vor. Er wollte sich gerade auf sein Sofa fallen lassen, als das schrille Klingeln des Telefons den Raum erfüllte.
Johnny zuckte zusammen und fühlte, wie sein Puls einen unangenehmen Sprung machte. Wahrscheinlich war das seine Mutter, die wissen wollte, ob er tatsächlich heil angekommen war. Er versuchte, das Geräusch zu ignorieren, aber eigentlich hatte er das Bedürfnis, mit einem anderen Menschen zu sprechen – um sich davon zu überzeugen, dass er trotz der Zeit, die er eingepfercht in der Plattenbauwohnung verbracht hatte, immer noch bei Verstand war.
Unentschlossen zog Johnny das iPhone aus der Hosentasche. Er könnte seinen Kumpel Dirk anrufen, aber ihm war nicht danach, zu erklären, was in den letzten Wochen passiert war. Nein, er sehnte sich einfach nach einer belanglosen Unterhaltung. Johnny zögerte kurz, dann sagte er: „Siri, ruf Babsi an.“
Es klingelte ganze zehn Mal, ehe sie ranging. „Babsi! Wieso dauert das denn so lange? Wie läuft es in der Firma und … wie geht es Ihnen sonst so?“
„Sind Sie noch im Krankenhaus? Was sagen die Ärzte?“, fragte sie zurück.
„Nein, ich bin zu Hause. Den Rest erzähle ich Ihnen lieber persönlich. Kommen Sie vorbei? Ich bestelle uns auch eine Pizza.“ Er musste zwar dringend wieder auf seine Ernährung achten, vor allem jetzt, wo er keine Möglichkeit mehr hatte, joggen zu gehen, aber das konnte auch bis morgen warten.
„Ich hatte für heute Abend schon andere Pläne.“
„Sagen Sie bloß, Ihr Verlobter hat was dagegen?“
Babsi schwieg.
Johnny unterdrückte ein verärgertes Schnauben. Die Lust, sich mit seiner Assistentin zu streiten, war ihm plötzlich vergangen. „Okay. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wenn es etwas Neues im Büro gibt, ja? Ich soll noch ein paar Tage zu Hause bleiben, aber vielleicht schaue ich trotzdem mal vorbei.“
Babsi atmete lange aus. „Diavolo oder Speciale?“
„Was?“
„Ihre Pizza. Ich komme sowieso bei Domino’s vorbei, wenn ich zu Ihnen fahre.“
„Oh, ach so. Speciale in dem Fall. Und eine Flasche Wein, wir wollen es uns doch gemütlich machen.“
Babsi legte auf, dabei musste sie doch wissen, dass er sowieso niemals das Gesöff vom Pizzabäcker trinken würde, oder?
Eine Dreiviertelstunde später klingelte es an seiner Tür. Johnny drückte die Taste an der Freisprechanlage und lauschte, bis Schritte auf der Treppe erklangen.
„Hallo“, sagte sie und zwängte sich mit den zwei Pizzakartons an ihm vorbei.
„Sie finden den Weg ja selbst“, erwiderte er halb im Scherz und legte eine Hand auf ihre Schulter, um ihr ins Wohnzimmer zu folgen. Es tat gut, dass sie nicht so an ihm herumzerrte wie seine Mutter, die ihn wie einen leblosen Gegenstand hin- und hergeschoben hatte, wenn er ihr im Weg stand. Johnny konnte hören, wie Babsi sich auf sein Ledersofa plumpsen ließ.
„Trinken wir was zusammen?“
„Wein habe ich nicht mitgebracht, aber ich kann Ihnen ein Glas Wasser holen.“
„Von mir aus“, antwortete Johnny. „Geschirr steht in der Küche, bedienen Sie sich.“
Babsi ging aus dem Zimmer. Er hörte, wie sie mit den Gläsern hantierte und das Wasser in die Spüle plätscherte, dann kam sie wieder herein.
„Und ziehen Sie doch die Schuhe aus.“
„Wie bitte?“
„Die ruinieren das Parkett.“ Er versuchte, ein empörtes Gesicht zu machen, aber weil er ihre Reaktion nicht beobachten konnte, kam er sich dabei vor wie ein Clown.
Babsi stellte die Gläser auf dem Couchtisch ab, schob den Pizzakarton weiter zu ihm herüber und öffnete ihn mit einem leisen Rascheln. „Bitte schön, guten Appetit. Ist schon geschnitten.“
„Danke.“ Johnny tastete nach dem Karton, aus dem ein herrlicher Duft zu ihm herüberwaberte, aber als seine Finger auf die Pappe stießen, hielt er inne. Während der Zeit bei seiner Mutter hatte er meist allein im Kinderzimmer gegessen und sich eingeredet, das läge an ihrer schlecht bekömmlichen Gesellschaft. Aber jetzt wurde Johnny klar, dass es ihm schlicht unangenehm war, vor anderen Leuten zu essen.
„Warum haben Sie es sich anders überlegt, Babsi?“, fragte er, um die Stille zu überbrücken. Noch im selben Moment wurde ihm bewusst, dass er die Antwort eigentlich gar nicht hören wollte. Er tastete suchend mit den Fingern nach seinem Getränk.
Babsi stellte ihr Wasserglas ab. „Weil Ihr Leben plötzlich auf den Kopf gestellt worden ist. Sie haben niemanden, der für Sie da ist, und ich habe kein Herz aus Stein.“
Johnny schluckte mühsam. Ihre Worte trafen ihn, weil sie wahr waren. Trotzdem: Er war schon lange allein gewesen. Und Einsamkeit hatte ihm noch nie etwas ausgemacht. Nur hilflos sein, das wollte er ganz sicher nicht. „Und was sagt Ihr Verlobter dazu?“, hakte er nach und nahm das Wasser entgegen, das sie ihm hingeschoben hatte, sodass das kühle Glas sein Handgelenk streifte.
„Er sieht es nicht gern, aber Job ist Job.“
„Hm.“ Johnny nahm vorsichtig mit beiden Händen ein Pizzastück aus dem Karton. „Er wird sich schon daran gewöhnen, wenn Sie in Zukunft häufiger hier sind. Wie ist Ihre Pizza? Hawaii, würde ich wetten.“ Natürlich wusste er, dass sie Vegetarierin war.
Babsi schwieg und rutschte auf dem Sofa herum. Er konnte hören, wie ihre nackten Beine auf dem Leder quietschten. Im Büro trug sie immer Strümpfe und irgendwie fand er den Gedanken befremdlich, dass sie überhaupt etwas anderes tragen sollte als Rock und Blazer, selbst in ihrer Freizeit.
„Was soll das heißen: Ich werde öfter hier sein?“, fragte Babsi in einem Tonfall, der ihn an ein trotziges Kind erinnerte. Er hatte plötzlich große Lust, sie aufzuziehen wie früher, aber er konnte es sich nicht erlauben, sie gleich wieder zu vergraulen. Denn der Einfall, der ihm gerade eben gekommen war, war brillant. Johnny hob beschwichtigend die Hand. „Nicht das, was Sie wieder denken. Ich werde Ihnen ein vollkommen seriöses Angebot machen. Eines, das Sie nicht –“
„Kommen Sie zur Sache, bitte.“
Er seufzte. „Schon gut. Sie schaffen es auch immer, die Stimmung zu ruinieren.“ Er hätte einige bunte Scheine darauf gewettet, dass sie jetzt die Augen verdrehte. „Also, Sie wissen ja, dass ich Sie schätze. Sie leisten hervorragende Arbeit, sind immer zuverlässig und akkurat.“ Plötzlich war er wieder ganz der Personalchef, selbst in der Jogginghose und dem ausgeleierten T-Shirt. „Aber … solange ich noch zu Hause bin – und das dürften zumindest noch ein, zwei Wochen sein –, gibt es im Büro nicht viel für Sie zu tun. Hier könnte ich Sie besser gebrauchen. Für ein paar alltägliche Dinge, als private Assistentin sozusagen.“ Jetzt schwang in seiner Stimme kein Sarkasmus mehr mit. So könnte er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Babsi würde ihm bei täglichen Erledigungen behilflich sein und ihn gleichzeitig über alles informieren, was in der Firma vor sich ging.
„Sie wollen in ein oder zwei Wochen wieder ins Büro kommen?“, fragte sie. Die Skepsis in ihrer Stimme versetzte ihm einen Stich.
„Ja. Wieso denn nicht?“
„Na ja – ich … es … “ Babsi verstummte.
Bildete er sich das ein oder hatte er es tatsächlich geschafft, sie in Verlegenheit zu bringen?
„In der Firma ist man noch nicht sicher, wie es nach Ihrem … Unfall weitergehen soll.“
Er erwiderte nichts.
Sie schien einen Moment zu überlegen, dann fuhr sie fort. „Herr Döring meint, dass Sie unter diesen Umständen vorerst nicht in die Abteilung zurückkehren können. Es gibt allerdings spezielle Rehabilitationsmaßnahmen für den Wiedereinstieg in den Beruf. Ich könnte Ihnen helfen, die Anträge auszufüllen, und vielleicht ergeben sich in der Zwischenzeit Möglichkeiten, dass Sie anderweitig …“
„Wie bitte?“ Johnny ließ sein angebissenes Pizzastück in den Karton fallen und stand abrupt auf. „Ich brauche keine Rehabilitationsmaßnahmen! Und was soll das überhaupt heißen, ich kann nicht in die Abteilung zurück? Das hätte ich ja nicht mal von Döring erwartet. So ein verdammter Mistkerl! Selbst blind bin ich immer noch zehnmal fähiger als dieser Idiot!“
Und das war eine schamlose Untertreibung. Seit der neue Geschäftsführer vor etwas über einem Jahr die Leitung der Firma übernommen hatte, ging es nach Johnnys Meinung mit Sanacur bergab. Das Unternehmen biederte sich vielversprechenden Kunden gegenüber geradezu an, umgarnte sie mit teuren Geschäftsessen und protzigen Präsentationen, anstatt wie zuvor durch Qualität zu überzeugen. Nicht dass Johnny etwas gegen gutes Essen oder schicke Technik einzuwenden gehabt hätte, aber er konnte es nicht ausstehen, wenn nichts hinter der blendenden Fassade steckte. Wobei er ja gute Arbeit leistete. Menschenkenntnis und Intuition machten einen hervorragenden Personaler aus und er konnte die Stärken und Schwächen der meisten Menschen schon auf den ersten Blick erahnen. Nach einem kurzen Gespräch kannte er ihr Potenzial. Das galt zumindest für die Zeit, als er noch in der Lage gewesen war, seinem Gegenüber in die Augen zu sehen.
Babsi klopfte angespannt mit den Fingernägeln auf den Tisch.
„Sie wissen, dass ich mich aus solchem Gerede he-
raushalte, Herr Baumann. Wie dem auch sei: Ich helfe Ihnen gerne mit dem Papierkram, wenn ich kann, aber ich werde auf keinen Fall Ihre persönliche Krankenschwester sein.“
Bildete er sich das nur ein, oder war ihr Tonfall ihm gegenüber forscher geworden? Er war vielleicht ein wenig paranoid, aber nicht dumm. Sie wusste genau, dass er eine Konfrontation mit Döring nicht überstehen würde – auch wenn er schon seit fast einem Jahrzehnt in der Firma arbeitete. Johnny lächelte verbittert in sich hinein.
„Babsi“, begann er schließlich und versuchte, sich seine Verzweiflung nicht anmerken zu lassen. „Wenn Sie es nicht für Ihren Vorgesetzten tun können, dann tun Sie es doch für einen alten Freund. Wollen Sie mich ausgerechnet jetzt hängen lassen? Herrgott noch mal, meine Mutter will, dass ich wieder bei ihr einziehe! Verlegen Sie doch einfach Ihr Büro in mein Gästezimmer.“
Babsi schnaubte verärgert. „Für solche Fälle gibt es Sozialarbeiter, Johannes. Ich werde dir sicher nicht beim Anziehen und Duschen helfen! Es war ein Fehler, überhaupt hierherzukommen.“
In diesem Moment entglitt Johnny ein spöttisches Lachen, ehe er es verhindern konnte. Selbst in seinen eigenen Ohren klang er verzweifelt, ja, beinahe hysterisch. Hatte sie ihn geduzt? Und beim Vornamen genannt! Johannes nannte ihn ja nicht einmal seine eigene Mutter. Babsi hielt ihn für einen Invaliden. Einen Krüppel, der sich nicht ohne Hilfe waschen und anziehen konnte. Und für größenwahnsinnig noch dazu, aber das war ja nichts Neues.
Obwohl ihm klar war, dass sie ihn missverstanden hatte, lagen ihm ihre Worte im Magen wie ein Stein. Das Lachen verklang und er starrte in die Leere. Die Vorstellung, wie Babsi ihn duschte, nahm vor seinem inneren Auge Form an, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Er kannte Dutzende Frauen wie sie und er hatte immer geglaubt, dass ihm diese Geschichten nichts bedeuteten. Aber jetzt? Würde er jemals wieder mit einer Frau zusammen unter der Dusche stehen?
Er wollte zu Babsi herübergehen und wenigstens ihre Hand berühren. Dem Spott und vor allem dem Mitleid die Stirn bieten, aber die Übelkeit, die in ihm aufstieg, überwältigte ihn. Er war doch immer noch ein richtiger Mann … War er das? Die Frage hallte in seinen Gedanken wider, ließ alte Erinnerungen und neue Ängste aufsteigen, die sich miteinander verwoben und sich wie ein Seil um seinen Hals legten, immer fester, bis er flach um Luft rang und keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Er war nur noch ein kranker Körper, eine papierdünne Hülle und darunter ein gebrochener Mann. Es kostete ihn all seine Selbstbeherrschung, sich nicht vor seiner ehemaligen Assistentin auf den Teppich zu übergeben.
Babsi stand auf, brachte ihr Glas und den Pizzakarton in die Küche und verabschiedete sich wortkarg. Johnny konnte sich gerade noch so lange zurückhalten, bis die Wohnungstür ins Schloss fiel. Dann stürmte er ins Badezimmer, stieß sich auf dem Weg den Ellenbogen und den Knöchel und brach über der Kloschüssel zusammen.
Er wusste nicht, wie viel Zeit verging, bis er endlich in der Lage war, aufzustehen, sich das Gesicht zu waschen und den Mund auszuspülen. Als das Rauschen des fließenden Wassers verklungen war, miaute es neben ihm. Sein Kater. Ein schlechtes Gewissen überkam ihn plötzlich und schmerzte fast mehr als das wunde Gefühl in seiner Kehle. Er nahm das Tier hoch und trug es in die Küche. Dort suchte er den Wassernapf und füllte ihn auf. Er fand auch eine Dose Katzenfutter im Schrank. Als er sie öffnete, wurde ihm wieder ein wenig übel. Trotzdem kratzte er das Futter in den Napf und stellte es auf den Boden. Sein Kater machte sich schmatzend über die Mahlzeit her und schmiegte dann dankbar den Kopf in seine Hand, die noch immer ein wenig zitterte. Der Flaum im Katzennacken war weich und Johnny schloss die Augen, obwohl es nicht nötig war.
Er wählte Babsis Nummer an diesem Abend nicht noch einmal, weil ihm die Kraft fehlte. Stattdessen schickte er ihr eine kurze Sprachnachricht: „Barbara, bitte leiten Sie das mit dem Sozialarbeiter in die Wege, es wäre mir eine große Hilfe.“
BEA
Als Tabea an der Haltestelle Lorettostraße aus der Straßenbahn stieg, schlug ihr die Mittagshitze ins Gesicht. In den letzten zwei Wochen hatte der pausenlose Sonnenschein – dem Klimawandel sei Dank – dafür gesorgt, dass es in Freiburg, auch bekannt als „Toskana Deutschlands“, so warm war wie am Gardasee oder auf Mallorca. Aber natürlich war es hier viel schöner. Das Blätterdach der stämmigen Rosskastanien, die sich nach dem wolkenlosen Himmel ausstreckten, spendete Tabea Schatten. Die Bäume waren so dicht belaubt, dass nur ab und zu die romantische Turmspitze einer der alten Fabrikantenvillen durch das Grün blitzte oder ein vereinzelter Sonnenstrahl auf das Kopfsteinpflaster fiel. Tabeas Pluderhose flatterte im lauen Wind, darüber fiel ihre bunte Tunika. Beide Kleidungsstücke mochte sie besonders: Weil sie bequem waren und weil es sie jedes Mal mit Schadenfreude erfüllte, sich so anzuziehen, dass ihrer Mutter die Haare zu Berge stehen würden, könnte sie sie sehen. Du hast immer etwas von einer Vogelscheuche, hatte sie einmal gesagt. Aber das machte nichts, fand Tabea, denn als Spatzenschreck konnte man sich wenigstens den ganzen Tag auf den Getreidefeldern die Sommerluft um die Nase wehen lassen und müsste bestimmt nicht irgendeinem Personalchef hinterherjagen, der sich in letzter Zeit nicht sonderlich oft in seinem Büro sehen ließ. Dass der aufgeplusterte Vogel ernsthaft krank sein sollte, konnte sie sich nur schwerlich vorstellen.
Tabea bog ein letztes Mal in eine Seitenstraße ein, um der Beschreibung auf Google Maps zu folgen. Geschmack hatte Herr Baumann ja, zumindest was seine Behausung anging. Die neobarocke Villa an der Straßenecke war ein eindrucksvolles Relikt aus den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Ehrfürchtig bestaunte Tabea das dreigeschossige Gebäude mit den gesprossten Rundbogenfenstern und den ausladenden Erkern. Sie dachte daran, dass es bald immer weniger dieser gemütlichen Straßen und grünen Plätze in Freiburg geben würde, wenn der Bauwahn weiter voranschritt. Und das nicht zuletzt wegen Menschen wie Johannes Eduard Baumann – ja, sie hatte sogar seinen Zweitnamen recherchiert, um die Kohlmeise zufriedenzustellen –, denn die Betonklötze, in denen sie arbeiteten, brauchten Platz und ebenso die Golfplätze und Parkhäuser voller Sportwagen.
Aber als Tabea vor dem großen Eisentor stand, das von einer Buchenhecke umrahmt wurde, stiegen Zweifel in ihr auf. War es die richtige Entscheidung gewesen, unangemeldet hier aufzutauchen? Die freundliche Stimme von Baumanns Assistentin klang ihr noch in den Ohren: Sanacur, Büro Baumann, Barbara Münzer am Apparat … Ach, schön, dich zu hören, Tabea – es tut mir leid, aber Herr Baumann ist krankgeschrieben … Nein, ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis er wieder ins Büro kommen kann. Viel Erfolg für deine Arbeit.
Von welcher ominösen Krankheit der Personaler befallen worden war, hatte Barbara ihr nicht verraten und jetzt stand sie vor seinem Wohnhaus und fühlte sich unwohl dabei, so ungeniert in die Privatsphäre dieses überaus unangenehmen Menschen einzudringen. Andererseits hatte sie keine Wahl. In etwas mehr als vier Wochen musste ihre Arbeit fertig sein und dazu brauchte sie die Hilfe von Johannes Baumann.
Zögerlich trat sie durch das angelehnte Tor und ging die Treppenstufen hinauf, die zur Haustür führten. Sein Name war fein säuberlich auf das Klingelschild gedruckt, daneben prangten noch drei andere Namensschilder, versehen mit Zusätzen wie LL. M. oder Dr. rer. nat.
Tabea atmete tief durch und läutete. Nichts geschah. Typisch. Wahrscheinlich war Herr Baumann schon längst zum Champagnerfrühstück ausgeflogen. Aber sobald ihr dieser absurde Gedanke gekommen war, befiel sie ein schlechtes Gewissen. Vielleicht war er gar nicht zu Hause, weil er beim Arzt oder sogar im Krankenhaus war? Obwohl, sein Rückgrat konnte er sich nicht gebrochen haben … Sie schüttelte den Kopf, um sich zur Besinnung zu rufen, und schluckte den Frust herunter, der in ihr aufstieg, als sie plötzlich wieder an Kohlmeises kritische Worte denken musste. Sie haben den armen Mann ja geradezu als Ungeheuer dargestellt. Wahrscheinlich hatte ihr Professor recht: Der Personalchef würde höflich ihre Fragen beantworten, sie könnte schon bald wieder gehen und müsste ihn nach dem Interview nie wiedersehen.
Entschlossen drückte Tabea erneut auf den Klingelknopf, diesmal etwas länger. Ein paar Sekunden verstrichen und nichts geschah, dafür zwitscherten die Vögel in den Kastanien und der Sommerwind rauschte leise durch ihr kurzes Haar. Tabea wollte sich gerade wieder umdrehen, als eine unfreundliche, verschlafene Stimme aus dem Lautsprecher dröhnte und die idyllische Geräuschkulisse ruinierte. „Wer ist da?“
Ihre Gedanken überschlugen sich hektisch. Na toll. Jetzt stand sie hier und wusste nicht einmal, was sie sagen sollte. Auf keinen Fall durfte sie sich ihre Unsicherheit anmerken lassen, sonst hielt er sie noch für eine lästige Zeitschriftenvertreterin und sie würde nie eine Gelegenheit bekommen, in Ruhe zu erklären, was sie wollte. „Hallo, Bach ist mein Name“, begann sie. „Ähm, Ihre Assistentin schickt mich.“ Das war nur halb gelogen. „Es geht um …“ Aber bevor sie sich erklären konnte, ertönte bereits der Summer. „Ganz oben“, sagte die Stimme knapp.
Mit klopfendem Herzen drückte Tabea die Haustür auf und betrat die Villa, die zu einem schicken Mehrfamilienhaus ausgebaut worden war. Eine gewendelte Treppe mit prunkvollem Geländer führte in die oberen Etagen und daneben gab es sogar einen Aufzug. Sie stieg die Treppenstufen aus lackiertem Edelholz hinauf, bis sie im obersten Stock angekommen war, und bewunderte dabei die hübsch restaurierten Buntglasfenster.
Als sie sich der Wohnungstür näherte, wurde die Klinke heruntergedrückt, aber ehe sie dem großen Mann, der ihr geöffnet hatte, ins Gesicht sehen konnte, hatte er sich schon umgedreht und eilte davon, wobei er sich mit einer Hand an der Wand abstützte.
Tabea blieb nichts anderes übrig, als seine Rückseite zu betrachten. Sie war überzeugt gewesen, dass jemand wie Johannes Baumann auch zu Hause nur Anzüge trug. Dass er vielleicht sogar im Anzug schlief, wie Barney Stinson. Aber sie hatte sich geirrt: Dieser Mann trug nichts weiter als ein weißes T-Shirt und Boxershorts – zugegeben, er hatte wohl auch die Figur dafür. Allem Anschein nach hatte sie ihn geweckt. Tabea spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. Natürlich! Er war schließlich krank und verbrachte wahrscheinlich den ganzen Tag im Bett. Vielleicht hätte sie sich doch anmelden sollen.
Vorsichtig schloss sie die Tür hinter sich und trat ein. Gleich darauf schmiegte sich etwas Weiches und Warmes um ihre nackten Knöchel. Eine Katze! Sie beugte sich herunter und streichelte den gescheckten Stubentiger. Sollte Baumann etwa ein Tierfreund sein? Ausgeschlossen. Wer fütterte denn die arme Katze bei einem 12-Stunden-Tag im Büro? Obwohl, wahrscheinlich übernahm das auch Barbara. Das und noch andere Dinge …
„Jetzt kommen Sie schon rein“, rief Herr Baumann vom Wohnzimmer aus. Tabea spähte durch den Flur und sah, dass er es sich dort auf einem dunklen Ledersofa bequem gemacht hatte und mit gelangweiltem Blick auf die gegenüberliegende Wand starrte.
„Es wird auch höchste Zeit, dass Sie kommen“, rief er. „Meine Haushaltshilfe hat erst nächste Woche wieder Zeit, aber das Katzenklo muss dringend gereinigt werden und mir geht langsam das Futter aus.“
Für Sie oder für die Katze?, schoss es Tabea durch den Kopf, aber sie biss sich rechtzeitig auf die Zunge und schluckte die unangebrachte Frage herunter. Das war eindeutig ein Missverständnis, wie sonst sollte er darauf kommen, dass sie zum Putzen hier war? Und auch wenn sie während ihres Praktikums nie mehr als ein paar Worte gewechselt hatten, müsste Baumann sie doch erkennen, oder nicht?
„Sie wissen, wer ich bin?“, fragte sie und setzte sich in einiger Entfernung zu dem Sofa, auf dem sich Herr Baumann ausgestreckt hatte, auf einen Klubsessel. Der Kater lief an ihr vorbei, sprang ihrem Gegenüber auf den Bauch und ließ sich kraulen.
Er sah sie nicht einmal an. „Ja, natürlich. Babsi hat mir gesagt, dass ich wohl nicht drum herumkommen werde, also können wir uns den Small Talk auch sparen. Und machen Sie Ihren Job gut, sonst suche ich mir eine andere Assistentin … oder Sozialarbeiterin oder wie auch immer Sie sich nennen.“