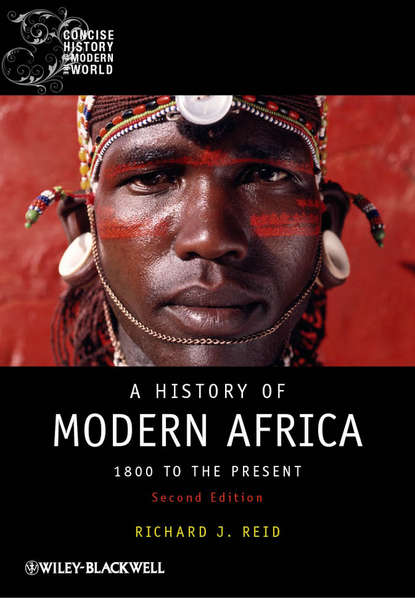- -
- 100%
- +
Die mündlichen Quellen wurden mittels themen-, beziehungsweise problemzentrierten semi-strukturierten Interviews erschlossen.5 Für mein Forschungsvorhaben wählte ich also eine eher «weiche» Methode und errichtete nicht ein starres Theoriegerüst als Grundlage für einen detaillierten Fragebogen, den ich dann Punkt für Punkt abhakte, um die Resultate womöglich quantitativ auszuwerten. Stattdessen begnügte ich mich mit einem Leitfaden, bestehend aus etwa 20 offenen Fragenkomplexen, die ich einigermassen der Reihe nach, im Einzelnen aber flexibel (bisweilen auch in einer anderen Reihenfolge) durchging. Erwies sich eine Fragestellung als unergiebig, so schritt ich gleich zur nächsten; intensives «Nachbohren» erwies sich, wie ich bald erkannte, als sinnlos. Die im konkreten Gespräch gesetzten Schwerpunkte und die Spannbreite der Aussagen waren also sehr verschieden und hingen stark von der befragten Person ab. Nach den ersten paar Interviews habe ich den Leitfaden leicht modifiziert. Gleich zu Beginn machte ich die Geprächspartner darauf aufmerksam, dass es mir nicht in erster Linie um persönliche Erfahrungen ginge, sondern um allgemeine Feststellungen: Nicht was das Individuum, sondern was «man» dachte, sagte und machte, wollte ich wissen. Am Schluss meiner Arbeit sollten ja einigermassen generalisierbare Feststellungen und zwar zu von mir gesetzten Problemkreisen stehen. Rein narrative Interviews hätten mir für mein Projekt wenig gebracht; wenn das Gespräch in diese Richtung abzugleiten drohte, erlaubte ich mir, den Redefluss zu unterbrechen. Dies geschah auch, wenn die Interviewpartner, sicher ohne Absicht, mehrfach die gesetzte chronologische Grenze überschritten. Brachten die Sprecher ein Thema aufs Tapet, das ich interessant fand, wiewohl es nicht in meinem Leitfaden figurierte, so liess ich sie zunächst einmal reden, um dann bei passender Gelegenheit wieder zu meinen Vorgaben zurückzukehren. Dasselbe machte ich bei Themenkomplexen, die mich zwar interessiert hätten, die ich aber den älteren Leuten nicht direkt zumuten wollte, also insbesondere Probleme der Sexualität oder, in der damaligen kirchlichen Umschreibung, die Vorschriften des sechsten Gebots. Mit dem gewählten Verfahren vermied ich die meisten der mit narrativen Interviews verbundenen Schwierigkeiten, vor allem den in der Forschung wohlbekannten Sachverhalt, dass Erinnerungen immer konstruiert sind und die Vergangenheit stets eine subjektiv interpretierte ist. Die Festlegung auf bestimmte Fragenkomplexe lässt dazu weniger Raum. In der Auswertung der Interviews kamen auch wieder «weiche» quantitative Elemente zum Zug: Eine Feststellung, welche die allermeisten Befragten spontan machen, zeichnet die Realität wohl ziemlich genau nach. Davon abweichende und widersprüchliche Aussagen müssen soweit wie möglich geklärt werden und in der Darstellung aufscheinen und diskutiert werden. Ort, Zeit und Umstände der Interviews hielt ich schriftlich in einem Begleitprotokoll fest. Fast immer fielen einige Themenkomplexe des Leitfadens aus Zeitgründen unter den Tisch: Nach zwei Stunden Reden zeigten sich sowohl bei den Befragten wie bei mir selber manchmal leichte Ermüdungserscheinungen. Ein zweites Interview schien mir gleichwohl nicht notwendig. In ganz wenigen Fällen habe ich bei bestimmten Fragen später nochmals Kontakt aufgenommen. Eine Anzahl offener Fragen konnte ich am Schluss in Gesprächen mit Roland Inauen und Karl Imfeld klären. Eine Transkription der Interviews habe ich nicht vorgenommen, diese wäre zu aufwendig gewesen und hätte auch zu viel «Abfall» (ich verwende diesen Begriff zwar ungern, aber bezogen auf meine ziemlich spezifische Fragestellung ist er doch nicht ganz unangemessen) mit sich gebracht. Die Aussagen wurden in relativ traditioneller Manier auf Karteikarten thematisch verzettelt, allerdings mit einem ziemlich feinen Raster von etwa 135 einzelnen Punkten. Dieses strukturiert auch den inhaltlichen Aufbau der Arbeit.
Schriftliche Quellen habe ich nur ergänzend benutzt. In erster Linie waren dies einige gedruckte autobiografische Berichte und Erinnerungen, sowie zumeist auf Interviews beruhende entsprechende Darstellungen von Dritten.6 Hinzu kamen periodische offizielle und quasi-offizielle Publikationsorgane.7 Unter den archivalischen Quellen waren die Pfarrberichte aus dem Dekanat Appenzell besonders wichtig, denn sie verringerten die erwähnte Lücke bei den geistlichen Interviewpartnern. Diese schriftlichen Berichte über den Stand der Pfarreien waren gemäss den Synodalstatuten von 1932 alle vier Jahre von sämtlichen Ortsgeistlichen aufgrund eines vorgegebenen Schemas von 36 Punkten abzufassen und dem bischöflichen Ordinariat einzusenden.8 Sie umfassten jeweils etwa 5–10 Seiten und dienten als Grundlage der eigentlichen kanonischen Visitation, die aber nicht vom Bischof selber, sondern von einem seiner Beamten vorgenommen wurde (Generalvikar, Offizial, Seminarregens usw.).9 Im Gespräch mit den Ortsgeistlichen ging es dann eigentlich nur noch um einige offene Fragen der bereits eingesandten Berichte. Darüber wurde ein Visitationsprotokoll erstellt, wobei der Visitator auch andere ihm zugekommene Informationen verwertete. In Obwalden wurde die Visitation noch nach dem klassischen tridentinischen Muster, zusammen mit der Firmung, vom Bischof selbst durchgeführt. Hier habe ich ein Protokoll und dazugehörige Akten aus dem Jahre 1956 benutzen können. Die Quellen aus dem Provinzarchiv der Kapuziner dienten vor allem der Klärung spezifischer mit dem Orden zusammenhängender Fragestellungen (Beichten, Segnungen, Volksmission usw.).
Eine auch zu einigen meiner Fragestellungen aufschlussreiche, in der Forschung bisher allerdings kaum benutzte Quelle sind die Antworten auf die von der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 1931 gestellten 1585 Fragen zu allen wichtigen Bereichen der Volkskultur, die gesamtschweizerisch erhoben werden sollten, die sogenannte Enquete I.10 Die Antworten sind für Appenzell in einer Kopie mit ergänzenden Anmerkungen und Quellenhinweisen des redigierenden Verfassers Albert Koller erhalten. Sie betreffen zwar einen etwas früheren Zeitraum als den von mir gewählten. Gleichwohl half dieses Material, einige Fragen befriedigender zu klären und die Kontinuität rückwärts zu verlängern.
Literaturhinweise habe ich sparsam angebracht, sie beschränken sich zumeist auf spezielle Werke zum Untersuchungsraum. Die bis etwa 2004 erschienene, eher allgemeine Literatur zu vielen hier behandelten Themen wird ausführlich in den kommentierten Bibliografien meiner früheren Untersuchung «Musse und Verschwendung» erwähnt. Deshalb sind nur noch nach diesem Zeitpunkt erschienene wichtige Werke aufgeführt.
Der geografische Raum der Untersuchung wurde bereits mehrmals kurz umschrieben. Leitende Überlegung bei der Wahl der beiden Regionen Appenzell Innerrhoden und Obwalden war neben den praktischen Erwägungen zunächst die, dass in der Schweiz die Moderne in allen ihren Ausprägungen das Voralpengebiet (neben Teilen der Alpen) zweifellos am spätesten erreichte, dass dort politische, wirtschaftliche und kulturell-religiöse Traditionen noch am ehesten bewahrt blieben und die Resistenz gegenüber neuen Entwicklungen am ausgeprägtesten war. Der Entscheid für Appenzell war, wie bereits erwähnt, persönlich begründet; sachlich kam hinzu, dass – wie bereits die Reiseschriftsteller des 18. Jahrhunderts erkannten11 – hier geradezu das Muster einer konfessionell bestimmten verschiedenartigen Entwicklung in Wirtschaft und Kultur vorlag, eine Fragestellung, die mich schon länger interessierte.12 Deswegen habe ich hie und da einen Seitenblick auch auf Ausserrhoden geworfen.13 Dass daneben die Innerschweiz zu berücksichtigen war, schien mir selbstverständlich. Der Entscheid für Obwalden hat drei Gründe. Aus jeweils verschiedenen Ursachen gab es in den anderen Innerschweizer Kantonen zum Teil schon früh gewisse dynamische «fortschrittliche» Elemente (in Uri etwa die Gotthardbahn,14 in anderen die Nähe zum Grossraum Zürich), Obwalden erschien mir demgegenüber eher als ein in sich ruhender Pol. Entscheidend war allerdings, dass ich mich hier, wie bereits erwähnt, auf kundige Vertrauensleute stützen konnte.15 Schliesslich lag mir aber dieser Kanton auch persönlich nicht ganz fern, konnte ich doch in meiner Kindheit zweimal im Bruderklausendorf Flüeli-Ranft Ferien verbringen. Wenn im Text die Ausführungen zu Innerrhoden vergleichsweise etwas mehr Platz einnehmen, so liegt das nicht in erster Linie an der Herkunft des Autors, sondern einerseits an der besseren schriftlichen Quellenlage, andererseits daran, dass Obwalden durch die profunden Werke von Karl Imfeld für verschiedene Fragestellungen bereits gut erschlossen ist.
Die Absicht, auch das katholische Schweizer Mittelland zu berücksichtigen, gab ich bald auf. Nicht nur die politische (katholischer Liberalismus), sondern auch die wirtschaftliche Situation (vorwiegend Ackerbau, neben der ausgedehnten Industrie) war ganz anders als in den Voralpen, der Druck zur Modernisierung stärker und die mächtigen protestantischen Städte näher gelegen. Auch war es schwierig, Vermittler zu möglichen Interviewpartnern zu finden. Ergänzend habe ich jedoch anhand der reichhaltigen Materialsammlungen von Josef Zihlmann das luzernische Hinterland, geografisch zwischen dem Mittelland und den Voralpen liegend, mitberücksichtigt.16 Das Alpengebiet könnte man bei oberflächlicher Betrachtung zwar als ausgesprochenes Refugium der Tradition sehen. Das ist es sicherlich auch auf einigen Gebieten, aber gleichzeitig ist es durch Passverkehr und Tourismus äusseren Einflüssen stärker ausgesetzt als das mehr im Windschatten des Verkehrs liegende Voralpengebiet.17 Das schweizerische Alpengebiet ist etwa zur Hälfte protestantisch und fällt damit zu einem grossen Teil zum vorneherein aus. In Graubünden sind nur wenige Talschaften katholisch.18 Als grösstes zusammenhängendes katholisches Gebiet zeichnet sich das Wallis aus. Es ist eine Lieblingslandschaft der Volkskundler, und das Lötschental etwa geniesst eine gewisse Berühmtheit als Forschungsfeld für traditionelle Kulturen. Gerade auch deswegen habe ich das Wallis als mögliches Untersuchungsgebiet weggelassen, allerdings die verhältnismässig reiche volkskundlich-historische Literatur, soweit sie etwas zu meinen Fragestellungen beitragen konnte, berücksichtigt.19 Im Übrigen sei daran erinnert, dass gerade im Oberwallis der Passverkehr (Grimsel, Simplon, Gries) eine grosse Rolle spielt und schon früh auch eine spezifisch auf die Elektrizität aus Wasserkraft basierende Industrie entstand (Lonza, Aluminiumwerke Chippis). Die Landwirtschaft hat ebenfalls einen ganz anderen Charakter als am Nordabhang der Alpen. Schliesslich kommt man im Wallis auch an die Sprachgrenze, die eine direkte Vergleichbarkeit weiter reduziert. Dies war übrigens der Hauptgrund, den ganz klar dem italienischen (genauer lombardischen) Kulturkreis zugehörigen Tessin wegzulassen. Der am Rande erfolgte Einbezug des protestantischen Berner Oberlandes hat mehr persönliche als sachliche Gründe. Es diente mir, wie Ausserrhoden, als Folie, um zusätzlich einen Blick von «auswärts» zu bekommen.20
Der zeitliche Rahmen der Untersuchung ergab sich eigentlich von selbst. Das Problem war eher, die Interviewpartner darauf festzulegen und ausserdem da und dort eine offensichtlich falsche Chronologie zu korrigieren. Etwas ungenaue Datierungen blieben fast unvermeidlich, wie man auch aus eigener Erfahrung weiss. Das Jahr 1945 als Ausgangspunkt zu nehmen war selbstverständlich, weil der vorangehende Zweite Weltkrieg auch für die Schweiz eine Ausnahmesituation darstellte, die mich bei meinem Interesse für den «gewöhnlichen» Alltag nur gestört hätte. Auch war so die Gefahr gebannt, dass die älteren Männer ihnen liebgewordene Erinnerungen aus ihrem Aktivdienst auftischten. Nur ganz selten liess ich zeitlich vorangehende Entwicklungen, welche langzeitige Folgen hatten, in die Gespräche miteinfliessen. Den Zeitraum von 1955–1960 als Schlusspunkt zu wählen, fiel ebenfalls leicht. Nicht nur meine eigenen Erinnerungen (Jahrgang 1941), deren erste noch in die Kriegszeit hineinreichen, lassen mir die Dekade nach dem Waffenstillstand als eine verhältnismässig ruhige Zeit erscheinen, in der man zunächst noch mit den Folgen der vorangegangenen Auseinandersetzung fertig werden musste, ohne an viel Neues zu denken, das Leben somit ohne grössere Veränderungen wie bis anhin weiterging. Dieselbe Schlussfolgerung kann man chronikalischen Darstellungen, wie sie es für beide Untersuchungsgebiete gibt, entnehmen.21 Erst seit der Mitte der 1950er- Jahre zeigen sich dann die typischen Erscheinungen der Moderne gehäufter auch in den bis dahin relativ zurückgebliebenen Voralpenkantonen. Hier habe ich selber noch lebhafte Erinnerungen etwa an den ersten Einsatz eines Baggers für Aushubarbeiten (bezeichnenderweise für eine Fabrik), an die ersten Waschmaschinen (Marke Hoover) vor einem Elektroladen, an neue Produkte der aufkommenden Lebensmittelindustrie, an den zunehmenden Autoverkehr mit allen seinen Folgen, schliesslich an die ersten, in zwei Wirtshäusern als Sensation und Publikumsmagnet aufgestellten Fernsehgeräte. Speziell für die Religiosität bedeuten der Beginn des Pontifikats von Johannes XXIII. (1958) und das bald von ihm einberufene Zweite Vatikanische Konzil einen Einschnitt, auch wenn sich die Folgen erst in den 1960er-Jahren massiv bemerkbar machten. Allerdings gab es, wenn man genauer hinschaut, bereits zur Zeit Pius XII. unterschwellig einige kirchliche Neuerungen.22 Diese vorläufigen Feststellungen zum zeitlichen Rahmen werden im Folgenden noch an einigen Beispielen zu präzisieren sein.
Anmerkungen
1 Z. B. Fuchs; Vogler.
2 Dies ist die spezifisch volkskundliche Perspektive. Für meine Fragestellung sei in dieser Hinsicht exemplarisch auf das Werk von Hartinger verwiesen, das die Verschränkung von Religion und Brauch thematisiert.
3 Zu diesem Problem noch Bärsch; Forstner.
4 Teilweise sind die entsprechenden Erfahrungen der Geistlichen wohl in ihre Predigten, Schriften und Rechenschaftsberichte eingeflossen.
5 Zur Theorie und Methode der qualitativen Sozialforschung und der «oral history»: Forstner (für Geistliche); Girtler, Methoden; Göttsch; Lamnek; traverse; Vorländer; Wierling.
6 Für Appenzell: Bräuninger; Dörig; Inauen R., Charesalb; Lüthold; Neff A.; Weigum; Wyss, Potztusig; Zilligen. Für Obwalden nur Furrer und Ming H.; allerdings basieren die Werke von Imfeld auch auf einem reichen persönlichen Erinnerungsschatz. Für andere Gebiete (in Auswahl): Britsch (Wallis); Galli (Tessin); Jaggi (Berner Oberland); Witzig (Deutschfreiburg, Wallis, Tessin).
7 Appenzeller Volksfreund (zugleich amtliches Publikationsorgan). Systematisch durchgesehen wurden die beiden Eckjahrgänge 1946 und 1960. Die pfarrlichen Ankündigungen umfassen für das erste Jahr nur das Dorf Appenzell und Haslen, sowie teilweise Gonten. Die übrigen Pfarreien informierten damals noch durch Anschlag oder mündliche Mitteilung. Die Obwaldner Presse wurde ausgiebig von Imfeld benutzt, sodass ich hier auf weitere Recherchen verzichten konnte. Die in Frage kommenden diözesanen Amtsblätter sind: Diözesanblatt für das Bistum St. Gallen; Folia officiosa ab ordinariatu episcopali diocesis curiensis edita.
8 Vgl. Diözesanblatt 2. Folge, 151–153 (7. 4. 1941), dort auch die Liste der Fragepunkte. Ferner Bischof, 123.
9 In den appenzellischen Landpfarreien war dies häufig ein Einheimischer, nämlich Dr. Edmund Locher, bis 1943 Pfarrer in Appenzell, dann Domkustos und Professor in St. Gallen. Vgl. zur Person Stark, 113f.; IGfr 30 (1986/87), 177.
10 Die Frageliste publiziert in: SAVk 31 (1931) 101–142. Vgl. dazu auch Inauen R., Hitz, 48. Der Rücklauf der Fragebogen war offenbar enttäuschend gering und generell blieb wenig davon erhalten (so fehlt etwa OW). Zur Erarbeitung des Grundlagenmaterials für den in Aussicht genommenen Atlas der schweizerischen Volkskunde wurde deshalb ein stark reduzierter zweiter Fragebogen (Enquete II) erstellt. Einschränkend ist zu bemerken, dass der Fragenkatalog selbstverständlich die damaligen Forschungsinteressen der Volkskunde widerspiegelt und damit der christlichen Religiosität wenig Platz einräumt. Die spezifisch «Religiöse Volkskunde» steckte damals noch in ihren Anfängen.
11 Vgl. etwa Ebel; Deutsch (Zinzendorf); Hartmann.
12 Hersche, bes. 446ff., 474ff., 722f., 893f.
13 Allg. zu Ausserrhoden Schläpfer, für die Gemeinde Urnäsch Hürlemann.
14 Vgl. für das «traditionelle» Uri aber noch das 1946 erschienene Werk von L. von Matt.
15 Eine Hilfe war auch das von Imfeld verfasste Mundartwörterbuch. Für Appenzell gibt es das entsprechende Werk von Joe Manser. Dialektbegriffe habe ich in diesem Buch jedoch nur ausnahmsweise verwendet, nämlich dort, wo sie besonders aussagekräftig oder kaum mit einem einzigen anderen Wort übersetzbar waren.
16 Vgl. die in der Bibliografie aufgeführten Werke. Für das Entlebuch bietet das Werk von Kaufmann über die Mischehen auch viele allgemeine Informationen zu dieser Landschaft.
17 Dazu grundlegend Mathieu.
18 Vgl. etwa Schmid zum Lugnez. Naheliegend wäre es (gerade von Graubünden und dem am Ostrand der Schweiz gelegenen Untersuchungsgebiet Appenzell aus) einen Blick über die Grenze, ins Vorarlberg und Tirol, zu werfen. Das musste hier unterbleiben, abgesehen von der summarischen Benutzung eines «Klassikers», an dem niemand vorbeikommt, der sich mit den hier behandelten Fragestellungen abgibt: Das dreibändige «Bergbauernbuch» von H. Wopfner zum Tirol. Ergänzend zu dieser Region noch Hubatschek; Jäger. Vergleichend kann ferner die einzige grössere Untersuchung aus Deutschland zur Lebenswelt ländlicher Katholiken um 1950 herangezogen werden, nämlich diejenige von Fellner zu Bayern. Vgl. darin besonders die Abschnitte zu Ebersberg, 101ff., und Berchtesgaden, 176ff. Ebersberg ist von der Zahl der landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung mit AI und OW vergleichbar, ebenso Berchtesgaden, wo allerdings der Tourismus eine ganz grosse Rolle spielt. Der Autor konstatiert einleitend zu recht ein enormes Forschungsdefizit zum gewählten Thema. Ein nahe der Schweiz gelegenes Gebiet (Oberschwaben) behandelt Kuhn.
19 Antonietti; Antonietti/Kalbermatten; Bellwald; Bellwald/Guzzi; Imhasly; Kuonen; Niederer; Pfaffen; Siegen Joh.; Siegen Jos.
20 Zum schweizerischen und bernischen Protestantismus allg. Guggisberg; Vischer; Weiss. Der «Atlas der schweizerischen Volkskunde» (ASV) behandelt die hier im Vordergrund stehenden, mit der Konfession zusammenhängenden Probleme eher am Rande. Auch das von P. Hugger hg. dreibändige «Handbuch der schweizerischen Volkskultur», gewissermassen das Nachfolgewerk der Synthese von Weiss, gibt zwar insgesamt einen umfassenden Überblick zum Thema, ist aber stärker gegenwartsbezogen und widmet der religiösen Kultur bloss verhältnismässig wenig Platz (explizit nur in den beiden Beiträgen von Heim, 1487–1500, und Campiche, 1443–1470). Eine nützliche neuere Datensammlung zum Vergleich katholischer und protestantischer Mentalität, aber auch zu anderen hier behandelten Fragekreisen, ist hingegen der von B. Fritzsche hg. «Historische Strukturatlas der Schweiz».
21 Für AI Steuble (die in der folgenden Darstellung gegebenen Daten sind in der Regel hier entnommen); für OW gibt Dillier nach Themenkreisen geordnet viele chronikalische Hinweise. Vgl. im Übrigen 10.5 und 10.6.
22 Zu diesen Entwicklungen und der schweizerischen Kirchengeschichte im 20. Jahrhundert vgl. in erster Linie die im Literaturverzeichnis angeführten Arbeiten vom Altermatt. Ferner Conzemius; Vischer.

1.1

Grundsätzlich sind die naturräumlichen, wirtschaftlichen, politischen und anderen Rahmenbedingungen beider Untersuchungsgebiete einander weitgehend ähnlich, bloss im Detail zeigen sich einige Unterschiede.1 Geografisch sind sie beide im schweizerischen Voralpengebiet gelegen, im Übergang vom hügeligen zum eigentlichen Berggebiet. Das wirkt sich besonders in Appenzell, an der Nordabdachung der Alpen gelegen, in häufigen Niederschlägen aus, wohingegen das fast rundum von Gebirgen umgebene Obwalden trockener ist. Das Appenzellerland liegt etwas erhöht südlich des Bodensees, am Fuss des Alpsteins, einer weit nach Norden vorgeschobenen Gruppe des Alpengebirges. Es ist rundum vom Kanton St. Gallen umgeben und von einem einzigen grösseren Fluss, der Sitter, durchflossen. Obwalden ist als einer der drei Urkantone Teil der Zentralschweiz. Es hat Anteil am Vierwaldstättersee, in den die Sarner Aa mündet, die das auf rund 435 bis 470 Meter über Meer gelegene Haupttal mit dem gleichnamigen See und dem Hauptort Sarnen durchfliesst. Wesentlich höher gelegen sind nur die Gemeinde Lungern sowie das abgeschiedene, seitlich gelegene Melchtal. Noch höher, auf rund 1000 Meter über Meer liegt die Exklave Engelberg. Dieser ehemalige Klosterstaat gehört geografisch eigentlich zu Nidwalden,2 schloss sich aber nach dem Ende der weltlichen Herrschaft der Äbte 1815 aus politischen Gründen Obwalden an. Appenzell Innerrhoden ist durchschnittlich höher gelegen, von 740 Meter über Meer an aufwärts. Eine Ausnahme bildet einzig der «Äussere Landesteil», die Exklave Oberegg, der im Ausserrhoder Vorderland gelegene, katholisch gebliebene Teil des alten ungeteilten Landes. Dieser ist stärker nach St. Gallen und dem Rheintal hin orientiert und auch wirtschaftlich etwas anders strukturiert; er wird daher in dieser Untersuchung im Allgemeinen nicht berücksichtigt. Der Hauptort Appenzell liegt auf 785 Meter über Meer, die kleinen übrigen Ortschaften meist auf etwa 900 Meter über Meer.
1.2

Nur die beiden traditionellerweise «Flecken»3 genannten Hauptorte Sarnen und Appenzell weisen eine einigermassen entwickelte Infrastruktur mit vielen Läden und Handwerkern auf und erfüllen in beiden Kantonen die zentralörtlichen Funktionen. Im Umland, in Appenzell noch stärker als in Obwalden und geradezu exemplarisch, herrscht bäuerliche Streusiedlung mit arrondiertem Landbesitz («Heimat») vor.4 In beiden Kantonen wurden die Höfe im geschlossenen Erbrecht an einen Sohn weitergegeben.5 In Appenzell bilden Wohnund Ökonomiegebäude eine Einheit (Kreuzfirstbau). In Obwalden sind sie, mit im Einzelnen deutlich anderer Bauweise, getrennt. Während beide Hauptorte eine minimale Grösse von einigen tausend Einwohnern haben, sind die übrigen paar Dörfer in Obwalden kleiner, weisen dennoch alle wichtigen Geschäfte auf (Läden, Handwerker, sogar mehrfach). Die Appenzeller Ortschaften ausserhalb des Hauptorts hingegen würde man besser Weiler nennen: Sie bestanden noch um 1960, bis der Bauboom auch dort einsetzte, nur aus Kirche, Pfarrhaus, Schule, eventuell einer Post, einer oder zwei Wirtschaften, sowie einer Bäckerei und allenfalls einem Gemischtwarenladen. Die Bevölkerung Obwaldens betrug 1950 22 125, diejenige Innerrhodens (ohne Oberegg) 11 230 Einwohner. Diese Zahlenverhältnisse gelten mit geringen Schwankungen auch für die Jahrzehnte unmittelbar vorund nachher. Auswanderung fand immer statt, denn in beiden Kantonen existierten in unserem Untersuchungszeitraum bei beschränkten Ressourcen noch sehr kinderreiche Familien.6 Einwanderer aus anderen Kantonen gab es vor 1960 verhältnismässig wenige, am ehesten bei ganz spezialisierten Berufen ohne lokale Tradition. Die Anbindung an den Verkehr war sowohl in Obwalden wie in Innerrhoden relativ schlecht, was sich unter anderem darin zeigt, dass sie nur mit Schmalspurbahnen erschlossen wurden, wobei allerdings der Brünigbahn in Obwalden überregionale Bedeutung zukam. Der Strassenverkehr war nach dem Krieg noch ziemlich unbedeutend, und bei den Einheimischen konnten sich damals nur die dörfliche Oberschicht oder bestimmte darauf angewiesene Berufstätige ein Auto leisten.7 Allerdings reisten die Touristen vermehrt damit an, was die beiden Kantone veranlasste, in den späten 1950er–Jahren eine vorher nicht existierende Verkehrspolizei ins Leben zu rufen.8 Gleichzeitig wurden umfangreiche Strassenausbauprogramme (Asphaltierungen, Verbreiterungen usw.) in Angriff genommen und wenig später wurde auch begonnen, die landwirtschaftlichen Siedlungen mit Flurstrassen für den motorisierten Verkehr zu erschliessen.