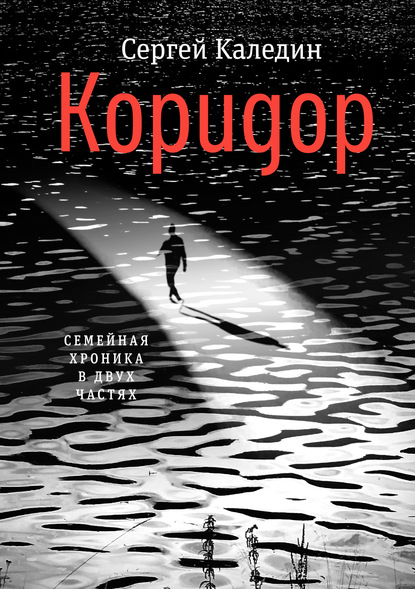- -
- 100%
- +
1.3

Die naturräumlichen Gegebenheiten bestimmten massgeblich die wirtschaftliche Tätigkeit, insbesondere im ersten Sektor, der zwischen 1945 und 1955 noch eindeutig dominierte.9 In Innerrhoden waren gemäss der Volkszählung von 1950 noch 51 Prozent der männlichen Erwerbstätigen in der Landwirtschaft tätig,10 in Obwalden waren es 42 Prozent,11 also mehr als das Doppelte, beziehungsweise Dreifache des gesamtschweizerischen Durchschnitts.12 Diese Zahlen sind jedoch aus methodischen Gründen als blosse Richtwerte zu betrachten.13 Für den Getreidebau sind beide Gegenden nicht geeignet, nur in Obwalden gab es in der Ebene der Sarner Aa ein wenig Ackerbau. Auf staatlichen Befehl wurde zwar beiderorts im Rahmen des «Plans Wahlen» in der Notzeit des Zweiten Weltkriegs auf mehreren hundert Hektaren Getreidebau betrieben, aber gleich danach wieder aufgegeben. Einzig der im Krieg ebenfalls forcierte Anbau von Kartoffeln wurde vor allem in Obwalden für den Eigenbedarf noch eine Zeit lang weiter gepflegt. Grasbau und Milchwirtschaft herrschen bis heute vor und bilden neben der Kälbermast und der Aufzucht von Jungvieh das Haupteinkommen der Bauern in beiden Gegenden. Die Alpwirtschaft war beiderorts eine notwendige und wichtige, mit Liebe besorgte Ergänzung der Talbetriebe. Die Milch wurde zum kleineren Teil als Konsummilch weiterverkauft, vor allem aber wurden Käse und Butter daraus hergestellt. Das zweitwichtigste Nutztier, welches fast alle Bauern hielten, war das Schwein. Demgegenüber war die früher wichtige Ziegenhaltung schon damals stark zurückgegangen und reduzierte sich weiterhin. Auch die Schafhaltung war in unseren zwei Untersuchungsgebieten nie stark verbreitet. Pferde wurden beidenorts in der bäuerlichen Wirtschaft kaum eingesetzt, allenfalls dienten Kühe als Zugtiere. Hühner hingegen gehörten fast überall zu einem Hof. In Obwalden spielte in der Sarner Ebene der vor allem im Zusammenhang mit der früheren Umstellung auf die Graswirtschaft entstandene Feldobstbau noch eine grosse Rolle. «Wie ein Wald» sollen damals die Obstbäume gestanden haben.14 Die Ernte war nicht so sehr Tafelobst für den Markt, sondern wurde selber frisch verzehrt oder eingekellert, ausserdem zu einem grossen Teil zu Most verarbeitet, gedörrt, zu Birnenhonig eingekocht und die Abfälle schliesslich zu Schnaps veredelt. Ferner gehörte in Obwalden, ausgenommen in den höheren Lagen, ein Gemüsegarten fast obligatorisch zu einem Bauernhof und spielte wie das Obst eine grosse Rolle für die Selbstversorgung. Auch hier hatte der Zweite Weltkrieg impulsgebend gewirkt; auch Nichtbauern pflanzten damals Gemüse, um den mageren Speisezettel zu bereichern. In Appenzell hingegen gab es, abgesehen von dem tief gelegenen Gebiet um Haslen und vereinzelten sonstigen Apfelbäumen, keinen Obstbau, obschon er von Behörden und bäuerlichen Organisationen immer wieder propagiert wurde. Auch grössere Gemüsegärten fand man dort nach den Nöten der Kriegsjahre kaum mehr.15 Die Appenzeller bezogen Obst, Gemüse und Kartoffeln schon immer vorzugsweise aus dem St. Galler Rheintal;16 deren Konsum beschränkte sich bei den Bauernfamilien aber ohnehin auf ein Minimum. In Obwalden ging der Obstbau in den 1960er-Jahren massiv zurück. Gründe dafür waren die Mechanisierung (Mähmaschinen), der Arbeitskräftemangel, die Verwertungsprobleme und schliesslich die staatlich geförderten Rodungsaktionen.
Auf den zweiten Sektor wird später im Zusammenhang mit der Arbeitsethik und dem Nebenerwerb vor allem der Frauen noch einzugehen sein.17 Hier sei vorerst erwähnt, dass er, verglichen mit der übrigen Schweiz, in unseren beiden Untersuchungsgebieten eine geringe Rolle spielte. Selbstverständlich war das für den Bedarf der Bauern und der übrigen Bevölkerung notwendige Handwerk vorhanden, es konzentrierte sich aber vor allem in Appenzell auf den Hauptort. Insgesamt waren in der Nachkriegszeit die beiden Kantone vielmehr noch Musterbeispiele von weitgehend agrarisch strukturierten Regionen, besonders Innerrhoden. In Obwalden gab es immerhin schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert einige bedeutendere Betriebe des metallund holzverarbeitenden Gewerbes (Parkettfabriken und Möbelschreinereien), dazu eine grosse Hutfabrik, die zusammen einige hundert Arbeiter und Arbeiterinnen (die Heimarbeit nicht mitgerechnet) beschäftigten. Ab 1957 kam noch die Kunststoffindustrie dazu, schon durch die von ihr hergestellten Produkte ein Symbol des Umbruchs. Bereits 1952 wollte ausserdem die Regierung Obwaldens den nichtlandwirtschaftlichen Sektor durch einen besonderen Delegierten für Wirtschaftsförderung stärker entwickeln. In Appenzell wurde 1955 eine entsprechende Kommission ins Leben gerufen. Dort gab es bis dahin nur einige wenige kleine Textilverarbeitungsbetriebe, vor allem zur Herstellung von Taschentüchern, die Männer und Frauen beschäftigten. Die Heimarbeit der Handstickerei, die zwar schon in der Zwischenkriegszeit stark zurückgegangen war, dominierte vorderhand noch. Ferner existierte im Dorf Appenzell ein stark bäuerlich inspiriertes Kunsthandwerk (Weissküferei, Haarflechterei, Drechslerei, Bauernmalerei, Herstellung von Antikmöbeln und Schellenriemen).18
Im Dienstleistungssektor spielte der Tourismus in beiden Regionen schon länger eine gewisse Rolle. Dies obschon er von der herrschenden bäuerlichen Schicht nicht immer gern gesehen wurde, etwa wenn Touristen gedankenlos durch hohes Gras wanderten oder ihre Hunde frei laufen liessen.19 Auch die Geistlichkeit äusserte vielfach Vorbehalte, weil sie in der lockeren Kleidung der Fremden und ihren Wünschen nach Schwimmbädern und Tanzunterhaltungen ernste Gefahren für die Sittlichkeit sahen.20 Die Obwaldner Franz Josef Bucher und sein Schwager Josef Durrer waren industrielle Unternehmer, Bahnbauer, Hoteliers und Tourismuspioniere, wie sie sonst nur in den Städten und bei den Protestanten auftraten. Doch handelte es sich bei ihnen um Ausnahmeerscheinungen, wenn auch der Obwaldner im Allgemeinen immer als etwas regsamer als der benachbarte Nidwaldner geschildert wurde. Regsam war indes auch der Appenzeller, aber er betätigte sich doch in einem viel engeren Kreis, etwa durch den Verkauf von Stickerei in den berühmten Badeorten des In- und Auslandes. In Obwalden gab es in den höher gelegenen Ortschaften einige alte Kur- und Erholungshäuser. Erwähnt werden muss hier auch der religiöse Tourismus, der nach der Heiligsprechung von Bruder Klaus (1947) mit seiner Geburtsstätte und seiner Klause in Flüeli- Ranft und seinem Grab in Sachseln grössere Ausmasse annahm. Am wichtigsten war aber doch Engelberg, wo schon 1883 ein Kur- und Verkehrsverein gegründet wurde, und nach dem Bahnbau von 1898 das Dorf bereits um die Jahrhundertwende ein beliebter und mondäner Kurort und insbesondere einer der frühesten Plätze des sich danach stark entwickelnden Wintersports war.21 Diese massive Veränderung stand in einem gewissen Gegensatz zur Tradition des Klosterstaats und führte auch zu Konflikten, insbesondere weil die Touristen den strengen kirchlichen Moralvorstellungen nicht entsprachen. Andererseits profitierte das immer noch einflussreiche Kloster materiell vom Tourismus.22 In Appenzell hingegen waren die früher beliebten Molkenkuren schon vor dem Ende des 19. Jahrhunderts aus der Mode gekommen. Dasselbe Schicksal ereilte etwas später einige kleinere Bäder (Weissbad, Gontenbad, Jakobsbad). Nach 1945 herrschte vor allem Tagestourismus vor, war die Bergwelt des Alpsteins doch von den grösseren städtischen Siedlungen der Ostschweiz bis zum Bodensee aus relativ rasch erreichbar. Der im Laufe der 1950er-Jahre beginnende Bau von touristischen Infrastrukturanlagen (Skilift Sollegg, Ebenalpbahn, Campingplätze, Ferienhaussiedlungen usw.) markierte einen deutlichen Umbruch.
Die übrigen Dienstleistungsberufe fielen in beiden Kantonen zahlenmässig kaum ins Gewicht: Akademiker, Lehrer, Beamte, kaufmännische Angestellte, Post- und Bahnpersonal und so weiter beschränkten sich auf das notwendige Minimum. Die Lehrerschaft bestand zu einem grossen Teil aus geistlichen Personen beiderlei Geschlechter, worauf noch zurückzukommen sein wird.23 Besonders in Innerrhoden wurde ausserdem der Beamtenapparat der Verwaltung noch ausgesprochen schmal gehalten.24
1.4

Damit sind die politischen Verhältnisse angesprochen, wobei der geschichtliche Hintergrund bis zum 20. Jahrhundert hier weitgehend vernachlässigt werden muss.25 Dass es sich bei beiden Untersuchungsgebieten rechtlich um Halbkantone handelt, ist zufällig und hat für das Folgende kaum Bedeutung. Unterwalden war schon im Mittelalter in Ob- und Nidwalden getrennt, wobei wichtig ist, dass diese Teilung hinsichtlich der Ämterbesetzung und der Finanzen effektiv eine Drittelung war, indem dem volkreicheren Obwalden zwei Drittel zukamen. Das heisst es trug zu den Staatsausgaben doppelt so viel bei, partizipierte aber auch entsprechend an den Erträgen. Diese waren früher hoch, weil sie vor allem aus den Gemeinen Herrschaften der Alten Eidgenossenschaft kamen, in die die Obwaldner doppelt so viele Landvögte wie die Nidwaldner bestellen konnten. In Appenzell ging die Teilung auf die konfessionellen Kämpfe zurück. 1597 einigten sich die Konfliktparteien auf eine friedliche Lösung: Die im Kern des Landes vorherrschenden Katholiken bildeten zusammen mit der Exklave Oberegg den Halbkanton Innerrhoden, der grössere, protestantische Teil im Westen, Norden und Nordosten nannte sich fortan Ausserrhoden. Wie wir noch sehen werden, hatte dies auch auf dem nichtreligiösen Feld einschneidende Folgen, insbesondere die, dass sich Ausserrhoden schon früh industrialisierte, während Innerrhoden fast rein agrarisch blieb.26 Auf der politischen Ebene änderte sich aber wenig. Appenzell und Obwalden waren nach dem Zweiten Weltkrieg noch sogenannte Landsgemeindekantone. Das bedeutete, dass die höchste Gewalt im Staat bei der jeweils im Frühjahr im Freien stattfindenden altertümlichen Versammlung der stimmfähigen Männer lag. Dort wurden mit offenem Handmehr die Behörden gewählt und über Sachfragen, ebenso wie über die Aufnahme ins Landrecht (Einbürgerungen) entschieden. Die laufenden und weniger wichtigen Geschäfte wurden im nur verhältnismässig selten zusammentretenden Grossen Rat, dem Parlament, debattiert und, soweit sie nicht in die Kompetenz der Landsgemeinde fielen, dort entschieden. Die Regierungen waren reine Vollzugsorgane.
Obwalden war allerdings verfassungsrechtlich etwas «moderner», auch verliefen hier die politischen Kämpfe lebhafter als in Appenzell. Die Landsgemeinde hatte schon seit 1922 nur noch eingeschränkte Kompetenzen, insbesondere bei Gesetzesvorlagen nur noch beratende Funktion, die Abstimmung erfolgte geheim an der Urne. Immer wieder wurde die Abschaffung der Landsgemeinde vorgeschlagen, sie erfolgte dann endgültig 1998. Eine vorerst 1947 noch gescheiterte Totalrevision der Verfassung kam 1968 zustande; sie zeigte das Bemühen, mit der allgemeinen politischen Entwicklung Schritt zu halten. Neben der in allen mehrheitlich katholischen Kantonen führenden konservativen Partei gab es in Obwalden auch eine oppositionelle liberale, die Partei der «Fortschrittler», die im Schnitt immer etwa ein Viertel der Sitze im Grossen Rat innehatte und auch über ein eigenes Presseorgan verfügte.27 Die Gemeindeautonomie war sehr ausgeprägt. Viele wichtige, andernorts meist dem Staat und der Einwohnergemeinde übertragene Aufgaben wurden indes von den Bürgergemeinden28 und verschiedenen Korporationen übernommen. Diese waren ähnlich demokratisch strukturiert wie der Kanton und die Einwohnergemeinden und auf vielen Gebieten tätig, umso mehr als sie – anders als die Einwohnergemeinden – meist auch finanziell gut situiert waren. Mehr als nur ein geografischer Sonderfall war die Gemeinde Engelberg in Obwalden. Zwar war die weltliche Macht des als geistliche Institution weiter bestehenden Benediktinerstifts schon lange dahin, aber auf anderen Gebieten bestimmte das Kloster die Geschicke der Talschaft nach wie vor stark mit. So etwa in wirtschaftlicher Hinsicht durch den enormen, ihm verbliebenen Grundbesitz, der zum grössten Teil verpachtet wurde, ebenso wie die vielen zum Kloster gehörigen Wälder und die Alprechte, von denen es ebenfalls die weitaus grösste Besitzerin war. Das Stift hatte auch eine lokale Bank initiiert (der Schalter war zuerst im Kloster selbst) und betrieb zuerst ein eigenes Elektrizitätswerk. Es übte nach wie vor die Pfarrrechte aus und stellte die einzige höhere Bildungsanstalt im Ort. Eine gewisse Untertanenmentalität hielt sich infolgedessen bis in die Nachkriegszeit; für ältere Leute war der Abt auch damals noch der «Gnädige Herr».29
Innerrhoden hingegen wies verfassungsrechtlich in der Nachkriegszeit zum Teil noch im Mittelalter verwurzelte archaische Züge auf. Die immer noch geltende, sehr kurz gehaltene Verfassung von 1872 hatte nur die allernotwendigsten Anpassungen ans Bundesrecht vollzogen. Die Existenz und die Stellung der Landsgemeinde als souveräne «höchste Gewalt» war zu keiner Zeit bestritten (während sie in Ausserrhoden schliesslich 1997 abgeschafft wurde). Eine europaweit beachtete Diskussion gab es bloss mit der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Die Innerrhoder lehnten es mehrmals ab, bis das Schweizer Bundesgericht 1990 die zwangsweise Einführung befahl. In der Folge gab es für die nun an der Landsgemeinde zugelassenen Frauen papierene Stimmrechtsausweise. Vorher war für die Männer der einzige Ausweis der Teilnahmeberechtigung das «Seitengewehr» gewesen: der umgehängte Degen, Säbel oder das Bajonett als Zeichen des volljährigen wehrfähigen Bürgers. Bemerkenswert war ferner, dass Montesquieu damals Innerrhoden noch nicht erreicht hatte: Die Gewaltenteilung existierte nur hinsichtlich der Justiz, war aber sonst unvollständig, weil die Regierung mit vollem Stimmrecht auch im gesetzgebenden Grossen Rat sass. Dieser bestand im Übrigen nicht wie überall sonst aus gewählten Einzelpersonen, sondern aus der Gesamtheit der Räte der unteren Verwaltungseinheiten, der Bezirke als Nachfolger der alten Rhoden. Diese wurden allerdings ganz demokratisch an den Bezirksgemeinden, den kleineren Schwestern der Landsgemeinde, bestimmt. Der Landammann präsidierte sowohl die Landsgemeinde, wie den Grossen Rat und die Regierung, hatte also beinahe die Machtfülle eines früheren absoluten Fürsten. Allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass ihn die Landsgemeinde jederzeit absetzen konnte, was auch gelegentlich vorkam. Die neunköpfige Regierung wurde nebenamtlich geführt, ihre offizielle Bezeichnung als «Standeskommission» zeigt schon ihren geringen Stellenwert an. Die Mitglieder selber trugen allerdings noch die schönen altertümlichen Titel: Der Leiter des Polizeidepartements war der «Landesfähnrich», derjenige des Fürsorgedepartements hiess noch lange nach dem hier betrachteten Zeitraum «Armleutsäckelmeister». Wegen der kleinen Beamtenschaft waren die Staatsausgaben und entsprechend auch die Steuern gering. Neue staatliche Aufgaben kamen meist von «Bern», vom Bund, und wurden nicht immer wohlwollend aufgenommen.30 Einige unvermeidliche Anpassungen an die Moderne wurden mit Teilrevisionen der Verfassung vorgenommen. Gemeinden gab es dem Wortsinn nach keine.31 Das «Innere Land» fasste sich als Einheit auf; die staatliche Struktur war infolgedessen etwas zentralistischer als in Obwalden.32 Hingegen wurden auch in Appenzell wie in Obwalden einige Staatsaufgaben von Korporationen übernommen. Die wichtigste war die «Feuerschau» des Hauptortes, die alle möglichen Aufgaben der modernen Versorgung übernahm und immer noch ausführt.33 Auch in Appenzell hatte es neben den führenden Konservativen einmal eine aktive liberale Partei mit einer eigenen Zeitung gegeben. Doch befand sie sich schon in der Zwischenkriegszeit im Krebsgang und stellte 1946 ihr Wirken ganz ein.34 Wichtiger waren die Berufsgruppen, zuvorderst die Bauern. Zu meiner Jugendzeit hiess es jedenfalls, dass gegen diese an der Landsgemeinde kein neues Gesetz durchzubringen sei.
1.5

Soziale Ungleichheit war und ist in der Schweiz weniger als in anderen Ländern ausgeprägt und in den hier betrachteten beiden Kantonen im Schnitt wohl noch etwas weniger. Abgesehen davon, dass es immer irgendwie in Armut geratene Leute gab und diese zu einer Zeit, in der der Sozialstaat noch wenig ausgebaut war, häufiger als heute vorkamen, betonten alle Interviewpartner die grundsätzliche Gleichheit. Eine schmale Oberschicht von einigen Prozent der Bevölkerung existierte sicherlich in den Hauptorten: Regierende, Akademiker, Lehrer, einige Geschäftsleute und bessere Handwerker, sowie reich gewordene Rentiers. Darunter aber lebte eine breite Mittelschicht, und insbesondere unter den Bauern waren, wie noch zu zeigen sein wird,35 die Unterschiede nicht sehr ausgeprägt, wurden jedenfalls nicht ausgesprochen als solche empfunden.36 In Appenzell war das soziale Schichtenmodell ganz einfach: Es gab die «Hofer», die Mehrheit der Bewohner des Hauptortes, die breite Masse der Bauern auf dem Lande und schliesslich am unteren Ende der Leiter die «Rietler»,37 die ärmeren Leute, die konzentriert am Rande des Dorfes, südlich der Bahnlinie, in kleinen Häuschen lebten, die sie auf dem eher schattig gelegenen Land einer schon im 15. Jahrhundert errichteten sozialen Stiftung erbaut hatten. In Sarnen und in den übrigen Dörfern Obwaldens waren, neben den immer noch zahlreichen Bauern, das kleinbürgerliche Element und die Arbeiterschaft etwas stärker vertreten. Umgekehrt war dort die Oberschicht der politisch seit Jahrhunderten führenden alten Geschlechter wohl noch etwas abgehobener als in Appenzell, obschon es auch hier etwa ein halbes Dutzend Familien gab, die häufiger als andere in der Regierung sassen.38 Die genannten alten, in der Politik gut vertretenen Obwaldner, aber auch sonstige angesehene bürgerliche und bäuerliche Familien verfügten nämlich bis in die 1960er-Jahre auch in den Kirchen über reservierte Sitzplätze («Chremmli») oder als Amtsinhaber über besondere Ratsherrenstühle.39 Sie wurden als Landammänner oder Gemeindepräsidenten an hohen Festtagen von Weibeln zum Kirchgang abgeholt und durften sich in Sarnen in hervorgehobenen Grablegen nahe der Kirche ihrer letzten Ruhe erfreuen. In Obwalden konnte sich eben im Laufe von Jahrhunderten eine Schicht herausbilden, die als Landvögte der Gemeinen Herrschaften und als Soldunternehmer einigen Reichtum ansammelte, zu Hause die politischen Ämter monopolisierte, sich repräsentative Wohnsitze erbaute und von ihren Renten lebte, ganz analog zu den städtischen Patriziern der eidgenössischen Stände. Die Appenzeller Oberschicht musste diese Möglichkeiten zur Distinktion weitgehend entbehren, die Innerrhoder waren insgesamt immer ärmer, weil ihnen die finanziellen Ressourcen ungleich den übrigen Alten Eidgenossen weitgehend verschlossen waren.40 Auch der Solddienst im Ausland war hier viel weniger verbreitet.
1.6

In beiden Kantonen waren 1950 noch 96 Prozent der Bevölkerung katholisch. Mit der noch kleinen reformierten Minderheit, die in den Hauptorten jeweils eine eigene Kirche besass, lebte man indessen im Allgemeinen friedlich zusammen.41 Obwalden gehörte zum Bistum Chur, Appenzell Innerrhoden zu St. Gallen.42 Beide waren allerdings aufgrund historischer Verwicklungen im 19. Jahrhundert formell nicht ihrer Diözese angeschlossen, sondern nur indirekt oder provisorisch unterstellt, ein Status, von dem vor allem die Appenzeller finanziell profitierten.43 Obwalden zählte 1946 insgesamt 13 Pfarreien, beziehungsweise Kuratien.44 In den 1950er-Jahren kamen Wilen zu Sarnen, Kleinteil zu Giswil, sodass noch 11 übrig blieben. In Engelberg stellte das Kloster auch den Pfarrer. Innerrhoden zählte (mit Oberegg) sechs Pfarreien und zwei Kuratien. Die beiden Kantone bildeten je ein Dekanat, demjenigen in Appenzell waren auch die im 19. Jahrhundert neu entstandenen katholischen Pfarreien in Ausserrhoden angeschlossen. Dekane waren meistens die Pfarrer der Hauptorte, die auch sonst eine besonders angesehene Stellung genossen. In beiden Kantonen herrschte ein stark historisch bestimmtes und bei Gelegenheit auch sehr direkt ausgeübtes Staatskirchentum.45 Pfarrwahlen durch die Kirchgemeinden oder die politischen Behörden waren eine Selbstverständlichkeit. In Obwalden waren die Kirch- und die politische Gemeinde identisch. An einigen primär religiösen Feierlichkeiten nahmen die Regierungen offiziell teil (in Appenzell in Amtstracht, ein schwarzer Mantel mit Umschlag).46 Umgekehrt ging der Landsgemeinde in Appenzell ein spezieller Gottesdienst mit Ehrenpredigt voraus;47 in Sarnen wurde anschliessend an die Landsgemeinde eine Vesper abgehalten. Neben den Behörden marschierte dort auch die Geistlichkeit im Landsgemeindezug mit, sass oben auf der Tribüne und nahm am Landsgemeindeessen teil. In Innerrhoden amtierten die Landammänner auch als Klostervögte der Frauenkonvente.48 Der Staat übte dort auch die Oberaufsicht über sämtliche Kapellen aus, obschon sich diese fast ausschliesslich im Besitze von Privaten oder Korporationen befanden. Das Ineinander von Kirche und Staat zeigte sich in der Appenzeller Pfarrkirche sinnfällig: An der Chorwand waren die in den Befreiungskriegen eroberten Fahnen dargestellt (früher hingen dort noch die Originale), und bei feierlichen Gottesdiensten wurden die grossen von den Rhoden gestifteten Kerzen am Eingang zum Chor entzündet.49 Gegenüber den Bischöfen zeigte man sich äusserlich zwar devot, vertrat aber bei Streitigkeiten vielfach dezidiert den eigenen Standpunkt. Bei der Durchsetzung der moralischen Normen der Kirche wirkte die Staatsgewalt mit, wenn sie auch den Interessen der Regierenden entsprachen. Umgekehrt wurden einige kirchliche Verfügungen, besonders solche reformerischer Natur, von den Repräsentanten des Staats nicht immer mit dem erwarteten Eifer unterstützt, sondern nur eingeschränkt umgesetzt, ja bisweilen ignoriert. Die alten Gewohnheiten, auf die sich Regierungen und gewöhnliches Kirchenvolk beriefen, blieben noch lange bestimmend. In Obwalden waren auf der Ebene der Gemeinden noch nach 1945 das staatliche und kirchliche Rechnungswesen vielfach miteinander verquickt; die Kirchgemeinden waren dort ja die Vorläufer der späteren politischen Gemeinden gewesen. Die Kirche war in beiden Kantonen finanziell gut ausgestattet, insbesondere durch die reichlich fliessenden Stiftmessengelder, das heisst die Summen, die für die sehr verbreiteten Seelenmessen einbezahlt wurden. In Appenzell sprach man in pekuniären Angelegenheiten der Pfarrkirche gerne nur vom «reichen Moritz».50
An Klöstern gab es in Obwalden das alte Benediktinerstift Engelberg mit einer Stiftsschule; auch die staatliche Mittelschule in Sarnen wurde bis 1984 von Benediktinern des ehemaligen Klosters Muri-Gries geleitet.51 Dort bestand auch, ebenso wie in Appenzell, ein Kapuzinerkloster. Letzteres führte hier die einzige höhere Bildungsanstalt, eine Real- und Mittelschule mit Internat. Hinsichtlich der Bildungsausgaben standen beide Kantone im gesamtschweizerischen Vergleich in den untersten Rängen.52 In Obwalden gab es ein altes Frauenkloster in Sarnen, eines in Melchtal, mit einem angeschlossenen Töchterinstitut, sowie eine moderne Gründung von Dominikanerinnen (Bethanien in St. Niklausen).53 Innerrhoden zählte insgesamt sogar vier Frauenklöster, wobei allerdings zwei (Wonnenstein und Grimmenstein) als Exklaven in Ausserrhoden lagen. Die Primarschule war staatlich organisiert, doch wirkte die Kirche, wie noch zu zeigen sein wird, auf verschiedenen Ebenen sehr bestimmend auch auf das niedere Bildungswesen ein.54
1.7

Zu den übrigen, in der Einleitung aufgeführten, aber nur am Rande einbezogenen Gebieten können und sollen hier nur die wichtigsten strukturellen Elemente genannt werden. Auf die abgesehen vom Konfessionellen weitgehende Ähnlichkeit von Ausser- und Innerrhoden in dieser Hinsicht wurde bereits hingewiesen. Dies gilt besonders für das vom Bauerntum und seiner Folklore geprägte Ausserrhoder Hinterland, während die übrigen Teile stärker industriell ausgerichtet sind.55 Das von Zihlmann beschriebene Luzerner Hinterland und das Entlebuch ähneln geografisch und wirtschaftlich ebenfalls weitgehend Appenzell und Obwalden.56 Dasselbe gilt für das Berner Oberland, wobei hier noch ausgedehnte Alpen hinzukommen, reicht doch das Gebiet bis zur Viertausendergrenze. Im Gegensatz zu fast allen übrigen hier betrachteten Gegenden spielte dort aber auch der Tourismus eine gewaltige und wirtschaftlich wichtige Rolle und dies schon seit langem – das Berner Oberland war neben Chamonix die am frühesten, nämlich schon im späten 18. Jahrhundert von Fremden aufgesuchte Region des Alpenraums. Der Freiburger Sensebezirk betreibt Gras- mit etwas Ackerbau.57 Hingegen unterscheiden sich die inner- beziehungsweise südalpinen Regionen (Wallis, Graubünden, Tessin) nicht nur naturräumlich, sondern auch wirtschaftlich ziemlich stark vom nördlichen Voralpengebiet. In diesen verhältnismässig trockenen und daher zum Teil (besonders im Wallis) einer künstlichen Bewässerung bedürftigen Tälern wurde neben der Viehhaltung, bei der neben dem Rindvieh auch Ziegen und Schafe eine grössere Rolle spielten, in der Nachkriegszeit noch ziemlich viel Ackerbau betrieben, vor allem Roggen und Kartoffeln für den Eigenbedarf.58 Im Wallis kam ausserdem der Weinbau in der Rhoneebene hinzu, wo auch viele Bergdörfer Reben besassen. Es herrschte eine ausgesprochene Stufenlandwirtschaft mit bis zu vier Stafeln vor. Diese bäuerlichen Wirtschaften waren fast autark, auch weil dieses Gebiet in der Regel verkehrsmässig noch schlechter als das Voralpengebiet erschlossen war, im Extremfall nur durch Saumtiere erreichbar.59 Das bäuerliche Element dominierte, noch stärker als in Innerrhoden oder Obwalden, auch in den Dörfern.60 Der zweite Sektor existierte dort nur marginal; im Wallis allerdings arbeiteten in einigen nahegelegenen Orten nicht wenige Männer als Pendler in den grossen elektrochemischen und metallurgischen Betrieben in der Talebene.61 Sie überliessen dann die bäuerliche Arbeit weitgehend ihren Frauen. Die Besitzungen im alpinen Raum waren infolge der dort üblichen Realteilung fast immer extrem parzelliert, zwanzig Parzellen pro Betrieb waren keine Ausnahme. Die Bevölkerung war jedoch wie in den anderen hier untersuchten Regionen ziemlich homogen, abgesehen von städtischen Siedlungen wie Leuk, wo die Standesunterschiede ähnlich wie in Appenzell oder Sarnen speziell im kirchlichen Bereich deutlich zu Tage traten.62 Der Tourismus spielte in der Regel erst ab den 1960er-Jahren eine spürbare Rolle.63 Die dauerhafte Auswanderung war stärker ausgeprägt als in den Gebieten der Nordalpen. Politisch waren in allen diesen Regionen ebenfalls die demokratischen und korporativen Elemente, in Graubünden und im Wallis auch die Gemeindeautonomie, stark entwickelt. Allerdings war die ganze Politik mehr als in den Landsgemeindekantonen der Reglementierung durch die Kantonsregierungen ausgesetzt. Parteipolitisch war wie in den anderen katholischen Stammlanden die Katholisch-Konservative Partei führend, auch wenn in den meisten Gebieten noch andere, von jener meist erbittert bekämpfte liberale Gruppierungen existierten.