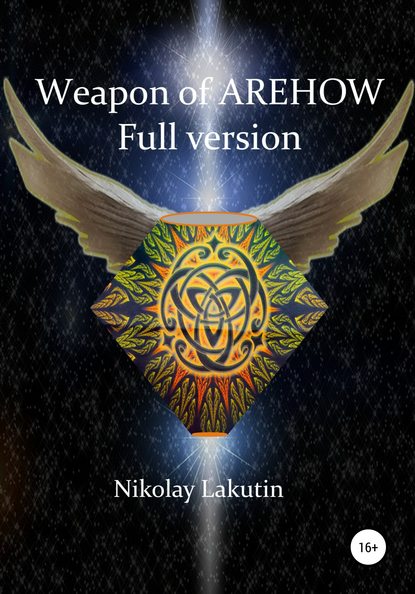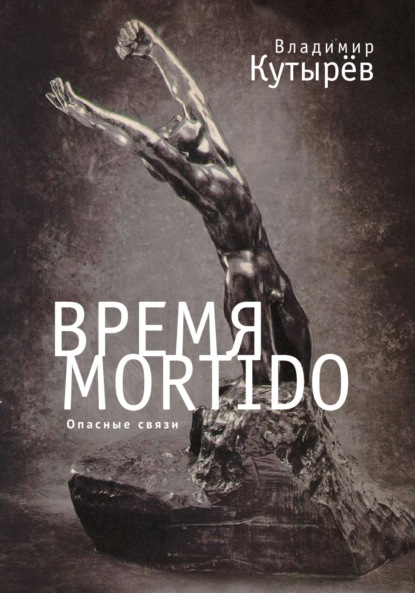- -
- 100%
- +
Konfessionell waren das Luzerner Hinterland, das Oberwallis und Lugnez und die nicht vom Tourismus berührten Teile des Tessins noch etwas geschlossener katholisch als Appenzell oder Obwalden.64 In den Bergdörfern waren Zugezogene, erst recht Protestanten, damals ein Exotikum. Das Netz an Pfarreien war dicht, weil vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert ständig Abspaltungen von Pfarreien und Kuratien von den Mutterkirchen stattgefunden hatten. Trotz der relativen materiellen Armut existierte eine reiche Sakrallandschaft und alte kirchliche Bräuche wurden hochgehalten, wie besonders am Beispiel des Lötschentals gezeigt wurde.65 Schon Richard Weiss hat darauf hingewiesen, dass der katholische Glaube der alpinen Lebensform besonders angemessen sei.66 In der Tat dominiert im Alpenraum der Katholizismus bei weitem. Protestantisch sind nur der grössere Teil Graubündens, was unter anderem mit dem Widerstand gegen den Bischof von Chur als ehemaligen Landesherrn zusammenhängt, sowie das Berner Oberland samt dem ehemals bernischen Pays d’Enhaut im Waadtland. Hier muss man sich allerdings vor Augen halten, dass die Reformation dem Oberland von der Stadt Bern regelrecht aufgezwungen wurde und gegen den entstehenden Volkswiderstand teils mit Gewalt durchgesetzt werden musste.67 Noch über Jahrzehnte hielten sich katholische Bräuche, etwa die Wallfahrt zu St. Beatus am Thunersee, und Wallfahrer aus dem Wallis und aus Freiburg nach Einsiedeln konnten ungehindert durch das Oberland zum Brünigpass gelangen. Sogar noch am Ende des 17. Jahrhunderts sollen Berner Oberländer Schenkungen für den Neubau der Kirche Giswil gemacht haben.68 Könnten Folgen dieser «Zwangsbekehrung» noch bis ins 20. Jahrhundert gereicht haben und wenn ja, können sie noch aufgespürt werden? Der im Saanenland im Zeitalter der Aufklärung wirkende Landvogt Karl Viktor von Bonstetten jedenfalls war davon überzeugt; für ihn hatte die Reformation auch negative Folgen gezeitigt.69
Anmerkungen
1 Dieses Kapitel richtet sich besonders auch an nichtschweizerische Leser, die mit den Verhältnissen nicht oder kaum vertraut sind. Einführende Literatur zu AI Grosser; Klauser (für die Situation um 1945); Inauen J., Heimweiden (enthält mehr als der Titel vermuten lässt). Zu einigen Aspekten der Bevölkerungs- und Sozialgeschichte Schürmann. Die Geschichte eines ländlichen appenzellischen Bezirks (Gonten) behandelte Weishaupt ausführlich. Für OW Garovi; Dillier; Imf Kerns; Imf VV; Obwaldner Heimatbuch. Für Engelberg Heer (jedoch stark auf die Kloster- und Äbtegeschichte bezogen); Zumbühl. Zum «Volkscharakter» der Kantone Allemann. Allg., wenn auch spezifisch auf Deutschland bezogen, zu Struktur und Problemen des ländlichen Raums das Standardwerk von Henkel.
2 Die Trennung macht der zwischen den beiden Teilen gelegene Kernwald aus, deshalb auch die Bezeichnung Unterwalden «ob» und «nid dem Kernwald».
3 «Flecken» sind in der Schweiz grössere Orte mit ähnlichen historischen Rechten wie Städte (am wichtigsten das Marktrecht), aber im Gegensatz zu diesen eher locker bebaut und ohne Ummauerung.
4 Allg. zu den bäuerlichen Siedlungsformen Weiss, 76ff.
5 In der Regel, aber nicht zwingend, an den ältesten.
6 Vgl. 2.2 und 2.7.
7 In OW kam noch 1950, also nach dem Wegfall der kriegsbedingten Einschränkungen, ein Privatauto auf 65 Einwohner. Garovi, 246. In AI war die Zahl noch viel geringer, nämlich ein Auto auf 123 Einwohner. Geschäftsbericht, 93. Etwas verbreiteter waren damals Motorräder.
8 Dillier, 624; AI H. S. In AI wurde der Polizei 1957 ein erstes eigenes Auto zur Verfügung gestellt.
9 Für die schweizerische Landwirtschaft vor dem grossen Wandel nach dem Krieg allg. das immer noch wertvolle und mit vielen Zahlen unterlegte Werk von Laur. Die neuere Synthese von Moser ist stark auf das ackerbauliche Mittelland konzentriert und behandelt in erster Linie Fragen der bäuerlichen Identität, die Beziehungen zu Staat, Politik und Parteien, sowie die bäuerlichen Verbände, allgemeine Fragen der Agrarstruktur und der Preispolitik. Zu den verschiedenen Agrarzonen und Bodennutzungssystemen neben Laur noch Mathieu; zur grundsätzlichen Differenzierung von Hirten und Ackerbauern Weiss, 104ff.
10 Der Frauenanteil war mit 3 % unbedeutend. Zu dieser Eigentümlichkeit vgl. 2.2 und 2.7.
11 Mit den Frauen 48 %.
12 Nämlich 15 %. 1941 waren es noch 19 % gewesen.
13 Es ist nämlich die Nebenerwerbstätigkeit nach beiden Seiten hin nicht erfasst. Vermutlich ist das Gewicht des agrarischen Sektors deshalb noch etwas grösser. Verglichen mit industrialisierten Regionen (etwa Ausserrhoden) war die Nebenerwerbslandwirtschaft allerdings unbedeutend. Die Prozentwerte werden umgekehrt natürlich geringer, wenn man die Berufsgliederung auf die Gesamtzahl der Bevölkerung bezieht (für AI ergibt sich dann 41 %, für OW 34 % landwirtschaftliche Bevölkerung). Zahlen (auch im folgenden) aus der in Anm. 1 genannten allgemeinen Literatur und den Ergebnissen der Volkszählung 1950, für AI ausführlichere Angaben bei Fuchs und Schmidli. Zu OW noch Furrer, 84ff.
14 OW P. R.; O. B.
15 Enq 30/31; 284, Schmidli, 89f.
16 Eigene Erinnerung (als Enkel eines Gemüsehändlers). Ein Hinweis auch bei Inauen R., Charesalb, 49.
17 Vgl. 2.7.
18 Zu dem Innerrhoden verschiedentlich attestierten «Hang zum Schönen» Dörig, 38.
19 Zumbühl, 51.
20 Vgl. dazu noch 9.5 und 9.6.
21 Ebd.
22 OW R. D.
23 Vgl. 9.2.
24 In OW hingegen gab es 1945 schon 40 Beamte. Dillier, 602f.
25 Vgl. dazu ausführlich Grosser; Garovi.
26 Schläpfer, 205ff.; Tanner.
27 Unter den Mitgliedern befanden sich, wie auch in AI, im Luzernischen oder im Oberwallis, besonders die wenigen Unternehmer, Hoteliers, Akademiker, Zugewanderte und Männer, die dem Katholizismus und dem Klerus gegenüber eine gewisse Distanz einnahmen. Die Liberalen fühlten sich aber ebenso als Katholiken wie ihre politischen Gegner, beschränkten allerdings bisweilen ihre Teilnahme an den religiösen Veranstaltungen auf das kirchlich vorgeschriebene Minimum und besuchten den Gottesdienst nicht zuletzt ihres sozialen Rufs wegen. Auf beiden Seiten soll es keine «Ultras» gegeben haben. Familientraditionen konnten bei der Parteiorientierung eine Rolle spielen, doch gab es auch viele Gegenbeispiele, und Heiraten zwischen konservativen und liberalen Partnern waren keineswegs ungewöhnlich.
28 In der Schweiz die jeweilige Gesamtheit der alteingesessenen Geschlechter einer Gemeinde, ohne die nach 1848 Zugezogenen. Vgl. zur Gemeindeautonomie und den verschiedenen Körperschaften in OW noch den Beitrag von Imfeld in Hugger, Handbuch, 531–541.
29 OW R. D.
30 Die von Weiss, 332, diagnostizierte Ablehnung des Staates in der ländlichen Bevölkerung, vor allem in der Innerschweiz, müsste man wohl etwas genauer auf den Bund beziehen, weniger auf den Kanton.
31 Ihre Funktionen wurden teilweise von den Bezirken übernommen, andere verblieben beim Kanton.
32 Deswegen gibt es auch nur das Bürgerrecht von Appenzell und Oberegg.
33 Zur Feuerschau vgl. Grosser, 402ff., 513f. Zu den Holzkorporationen Inauen J., Holzkorporationen; zu den Allmendkorporationen Fässler. Vgl. auch den Beitrag von Hürlemann in Hugger, Handbuch, 565–572.
34 Damals trat der jahrzehntelang die Partei führende und bestimmende Industrielle Beat Kölbener (1889–1948) zurück. Ihr Presseorgan, der «Anzeiger vom Alpstein», erschien dank dem Engagement ihres Druckers Jakober, eines Zugewanderten, in immer grösseren Abständen noch bis 1972.
35 Vgl. 2.3.
36 Schürmann nimmt in seiner bis ins 19. Jahrhundert reichenden Arbeit über AI eine im 18. Jahrhundert einsetzende starke Polarisierung der Bevölkerung an und bringt viele Indizien dazu bei. Ob diese Ungleichheit in späteren Zeiten wieder gemildert wurde, lässt sich mangels Datengrundlagen nicht entscheiden, ist aber wahrscheinlich. Vgl. zum ganzen Fragenkomplex noch Fässler.
37 Mit einem noch stärker diskriminierenden Begriff «Riedzattler» genannt (nach Manser Joe, 22: Zattli = unordentlicher Mensch). Vgl. zum Ried und den übrigen Korporationen für die Armen noch Fässler.
38 Die Geiger, Sutter, Fässler, Bischofberger, Rusch und Dähler.
39 Imf VV, 297; Imf Kerns, 39f. und 156. Das System existierte nicht nur in der Hauptkirche in Sarnen, sondern auch anderswo (Alpnach, Kerns). Für die «Chremmli» und sogar für die Ratsherrenstühle (die auch der Ehefrau einen besonderen Platz einräumten) musste eine Taxe bezahlt werden. In AI kannte man diese Einrichtung schon lange nicht mehr, bloss am Landgemeindegottesdienst waren für die Behörden mit rotem Tuch überzogene vordere Bankplätze reserviert. Einen speziellen Sitz besass dort nur der Kirchenpfleger. AI H. S.
40 OW hatte teil an sämtlichen Gemeinen Herrschaften, AI nur an einer, dem Rheintal, wo es wegen der Teilung des Landes nur alle 26 Jahre einen Landvogt stellen konnte.
41 Vgl. 10.1. In OW gab es mehrere protestantische Kirchen..
42 Zu den historisch gewachsenen kirchlichen Verhältnissen im Bistum St. Gallen und Kanton AI: Bischof; Huber; Stark; ders., Heimat; Wild. Für OW sei neben Garovi, 207ff., und Dillier, 634ff., vor allem auf die beiden grossen Werke von Imfeld verwiesen.
43 Vgl. dazu Grosser, Geschichte, 109ff. und 413ff.; Stark, 78ff.; Garovi, 208f. Dieser Zustand dauert bis heute an, obschon in der Vergangenheit vor allem in OW verschiedentlich Versuche zu einer Neuregelung unternommen wurden (vgl. etwa Dillier, 639f.; Imf Kerns, 227ff.). Vgl. zu den Rechtsverhältnissen in AI, anlässlich der Bischofswahl, noch HK 26. 1. und 23. 2. 1957. Der Kanton zahlte erst seit 1962 einen freiwilligen Beitrag von jährlich 6000 Franken an die bischöfliche Mensa.
44 Zahlen nach Status cleri. Die Obwaldner Geistlichen hat Omlin mit kurzen biografischen Angaben zusammengestellt; zu Kerns vgl. zusätzlich Imf Kerns.
45 Dies war übrigens auch im protestantischen Ausserrhoden der Fall. Schläpfer, 464ff.
46 In AI die Stosswallfahrt und die Fronleichnamsprozession, in OW das Bruder-Klaus-Fest, in beiden die Landeswallfahrt nach Einsiedeln.
47 In feierlicher Form jedoch erst seit 1954 auf Initiative des Pfarrers Wild.
48 Für das Sarner Frauenkloster, das von Engelberg hieher transferiert worden war, amtete der Abt von Engelberg als Schirmherr.
49 Stark, 169f; Enq Nachtrag 238a.
50 Nach dem Kirchenpatron, dem Heiligen Mauritius. Zu den Stiftmessen vgl. ausführlich 8.7.
51 Flüe. Zur Mädchenbildung in OW Furrer, 62ff.
52 Fritzsche, 167ff.
53 Zu den beiden letzteren noch Imf Kerns, 86ff.
54 Vgl. 9.2.
55 Mit der auf das 18. Jahrhundert zurückgehenden Heimindustrie identifizierten sich die meisten Ausserrhoder eher als mit den bäuerlichen Bräuchen, die zum Teil erst in neuerer Zeit und durch Anstösse von aussen bewusst gepflegt und als Attraktion herausgestellt wurden, mithin eher Folklorismus sind. Tanner; AR A. T.
56 Für das Entlebuch z. B. gibt Kaufmann, 46, noch für 1970 40 % landwirtschaftlich Tätige an.
57 Witzig, 92ff.
58 Zur inneralpinen Wirtschaft ausführlich Mathieu, vgl. ferner noch Witzig, 77ff.
59 Im Wallis gab es noch nach 1945 einige Dörfer ohne Zufahrtsstrassen für Motorfahrzeuge.
60 Zahlen bei Siegen Jos., 54.
61 Bellwald/Guzzi.
62 Kuonen.
63 In Graubünden war er nur im protestantischen Teil alt, im Deutschwallis etwa in Zermatt und im Saaser Tal.
64 Zur kirchlichen Lage im Tessin Macconi.
65 Antonietti; Siegen Joh.
66 Weiss, 107.
67 Kurz/Lerch; Bierbrauer.
68 Ming H., 246.
69 Bonstetten, bes. 61ff.

2.1

Zu den früher getroffenen allgemeinen Feststellungen zur spezifisch voralpinen Landwirtschaft1 sollen hier einige Ergänzungen gemacht werden, die dem Verständnis des Folgenden dienlich sind. Die Betriebsgrösse war in Innerrhoden wie in Obwalden ungefähr gleich klein, nämlich meistens um die 5 bis 10 Hektar (ohne Alpweiden).2 Eine bestimmte Obergrenze war gegeben, weil um 1945 praktisch sämtliche Arbeit noch ausschliesslich durch Familienmitglieder und von Hand erfolgte. Die Betriebe waren im Gegensatz zu denjenigen im inneralpinen Raum arrondiert und von zwei- oder dreilattigen Holzzäunen umgeben.3 Diese waren relativ arbeitsaufwendig und mussten immer wieder erneuert werden. Den einfacher zu verlegenden und haltbareren Stacheldraht verwendete man aber nicht so gern, weil sich die Tiere daran verletzen konnten und dann die Häute zur Lederherstellung nicht mehr viel galten. Der bereits seit 1943 von einer Ausserrhoder Firma (Lanker in Speicher) fabrizierte elektrische Viehhüter setzte sich dann später mit der allgemeinen Mechanisierung durch. Zum Land unmittelbar um Wohn- und Ökonomiegebäude gehörten nicht selten Heimweiden, etwas weiter entfernte Landstücke auf mittlerer Höhe.4 Die Alpen waren in Appenzell zur Hälfte privat, ein Viertel gehörte Korporationen, der Rest grösstenteils dem Staat.5 In Obwalden gehörten die Alpen zu 75 Prozent Korporationen, Genossenschaften und Teilsamen, nur ein kleiner Teil war privat.6 In Engelberg besass das Kloster etwa die Hälfte der Kuhrechte.7 Ansehnlicher Alpbesitz war ein grosser Vorteil, denn er ermöglichte es durch die breitere Futterbasis, im Tal mehr Kühe zu halten.
Der Betriebsgrösse entsprach der Bestand an Kühen, zwischen sechs bis zehn im Schnitt. Bauern mit 20 oder mehr Kühen galten als reiche Grossbauern. Wie wichtig die Rinderhaltung insgesamt war, belegen zwei Verhältniszahlen: In Obwalden kamen 1951 auf 1000 Einwohner 800 Stück Rindvieh, in Innerrhoden 836. Die Bedeutung der Rindviehhaltung zeigte sich ferner in folkloristischer Form an den festlich gestalteten Alpaufzügen und -abfahrten, im Kunsthandwerk (Bauernmalerei, Weissküferei, Accessoires der Sennentracht, Schellenriemen), sowie in den herbstlichen Viehschauen, die zu den Höhepunkten der bäuerlichen Festkultur gehörten.8 Die Verarbeitung der Milch unterlag schon vor dem Krieg grösseren Veränderungen.9 Die Eigenherstellung von Käse und Butter gab es in ausschliesslicher Form nur noch auf den Alpen. Der aus der Milch der Talbetriebe gewonnene Rahm wurde in Appenzell grösstenteils an die Butterzentrale Gossau geliefert, die übrig bleibende Magermilch verfüttert. Ebenso wurde der berühmte Appenzeller Käse zum grössten Teil nicht mehr in Innerrhoden selbst, sondern in den Nachbarkantonen hergestellt; die den Verkauf organisierende, 1942 gegründete Geschäftsstelle befand sich in St. Gallen. Aus Obwalden ging ein grosser Teil der Milch nach Luzern. Kälbermast und Aufzucht von Jungtieren, die dann exportiert wurden, waren angesichts der schon in der Zwischenkriegszeit ständig sinkenden Milchpreise für viele Bauern in beiden Kantonen eine ertragreiche Alternative. In Obwalden hatte der Viehhandel besonders in dem hoch gelegenen und daher von der Natur benachteiligten, aber verkehrsgünstigen Lungern grosse Bedeutung und war in diesem Ort eine wichtige Einnahmequelle. Einige dieser Händler aus Lungern wurden angesehene und reiche Mitglieder der bäuerlichen Gesellschaft.
Zu den Kühen kam vor allem in Appenzell eine zahlenmässig recht bedeutende Schweinehaltung, nicht nur für den Eigenverbrauch, sondern auch für den Markt.10 Das Schwein war der ideale Abfallverwerter, man konnte es mit der bei der Butterherstellung anfallenden Magermilch oder der beim Käsen übrig bleibenden Schotte (Molke), aber auch mit pflanzlichen Resten füttern. Geräuchertes Schweinefleisch bereicherte vielfach als einziges Fleisch die Sonntagsmahlzeiten der Bauern, und Schlachtschweine brachten wegen der hohen Preise gerade für diese Sorte Fleisch vielen Bauern willkommene Bargeldeinnahmen. Darauf und auf die weibliche Handstickerei bezog sich das etwas derbe, aber geflügelte Wort in Innerrhoden «D’ Fraue ond d’Saue ehaltids (erhalten) d’s Land».11 Demgegenüber wurde in Obwalden, wie bereits erwähnt, der Obstbau stärker gepflegt.
2.2

Die im Katholizismus gerade angesichts vieler Auflösungserscheinungen im 20. Jahrhundert bis heute hochgehaltenen Werte der Familie fanden im bäuerlichen Familienbetrieb des Voralpengebiets eine sozusagen ideale praktische Ausformung, und wäre der Pflegevater Jesu nicht ein Zimmermann, sondern ein Bauer gewesen, so hätte man jenen – abgesehen von der grösseren Kinderzahl – geradezu als Nachfolger der Heiligen Familie sehen können. Die bäuerliche Familie und ihre Arbeit wurde denn auch von den kirchlichen Repräsentanten immer wieder als vorbildhaft gepredigt.
Sowohl die durchschnittliche Grösse und der Viehbestand der bäuerlichen Betriebe wie der daraus resultierende Arbeitsanfall waren auf eine Familie mit mehreren Kindern zugeschnitten. Wie überall in der bäuerlichen Welt gab es eine geschlechtliche Arbeitsteilung. Dabei lastete besonders in Appenzell, etwas weniger ausgeprägt in Obwalden, infolge der verbreiteten weiblichen Heimarbeit die Landwirtschaft zum grösseren Teil auf den Männern. Die Stallarbeit mit den Kühen, die allein die meiste Zeit des Tagespensums beanspruchte, war klar Sache des Mannes.12 Die Ehefrau wurde nur ausnahmsweise zu Hilfsarbeiten im Stall beigezogen, etwa beim Kälbertränken oder überhaupt beim Viehtränken (besonders im Winter), zum Reinigen der Milchgeschirre, beim Kalben oder Putzen. Sie hatte für die gesamte Stallarbeit einzuspringen, wenn der Mann krank, verunglückt oder unvermeidlich abwesend war. Aber viele Frauen beherrschten die entsprechenden Arbeitsgänge gar nicht oder nicht ausreichend und mussten sie daher etwa durch einen älteren Sohn, Nachbarn, Verwandten oder Bekannten erledigen lassen. In Appenzell hielten sich die Frauen generell gerne von gröberen Arbeiten fern, denn sie fürchteten, ihre Hände würden dadurch die feine Stickarbeit nicht mehr bewältigen können.13 Zwei eher kritisch eingestellte Interviewpartnerinnen dort meinten sogar, die Frauen sollten diese Arbeiten, insbesondere das Melken, gar nicht erlernen, denn sonst würden nur ihre Ehemänner häufiger wegbleiben und dabei denken, die Frau könne ja diese Arbeit auch noch besorgen.14 Erledigte die Frau allzu viele männlich konnotierte Arbeiten, so konnte dies in der Tat eher sozial stigmatisierend wirken: Der Mann galt dann als Faulenzer. Häufig aber versorgten die Frauen die Schweine und ausschliesslich die Hühner. In Obwalden kam die Gartenarbeit samt der Konservierung der anfallenden Produkte hinzu. Dass den Frauen praktisch alle Hausarbeit übertragen wurde, war auch in nichtbäuerlichen Kreisen eine Selbstverständlichkeit. Ausserhalb des Hauses hingegen war die Arbeit auf den Wiesen und Weiden wiederum primär Sache des Mannes. Düngen, Bodenpflege, Mähen und Einnehmen des Grases, Zäunen und Weidgang waren die wichtigsten Obliegenheiten. Nur bei den zum schnellen Trocknen des Heus notwendigen Arbeiten wurden weitere Familienangehörige und eventuell fremde Helfer beschäftigt. Gemischtgeschlechtlich organisiert war, bei Einrechnung der vielen nachgelagerten Verarbeitungsschritte, auch die Obsternte. Auf den Alpen arbeiteten, anders als im inneralpinen Raum oder auch in Tirol und Bayern, nur Männer. Ihnen oblagen ferner die «Aussenbeziehungen», insbesondere der Gang auf den Markt.
Bereits Richard Weiss hat am Beispiel zweier Berggebiete auf einen ganz markanten Unterschied zwischen den beiden Hauptkonfessionen hingewiesen, nämlich auf die Kinderzahl. Während im protestantischen Safiental schon um 1910 die Zweikinderfamilie die Regel bildete, waren im benachbarten katholischen Lugnez Familien mit zwölf und mehr Kindern keine Seltenheit.15 Noch 1960 waren dort über 40 Prozent der Talbewohner weniger als 19 Jahre alt, gegenüber gut 30 Prozent in ganz Graubünden, beziehungsweise in der Schweiz.16 Der Strukturatlas der Schweiz zeigt allgemein auf, dass bis gegen 1960 die höchsten Geburtenzahlen in den katholischen Landgebieten lagen.17 Sehr viele Interviewpartner sowohl in Appenzell wie in Obwalden, insbesondere in Engelberg, wussten, wenn sie nicht selber aus kinderreichen Familien stammten, wenigstens in der Elterngeneration von solchen mit acht und mehr Kindern zu erzählen.18 Die Höchstzahl lag bei 17–18 Kindern. Dieses demografische Modell war schon im 17. und 18. Jahrhundert wirksam. Die Protestanten begannen damals mit der Geburtenkontrolle, während für die Katholiken ein hoher Bevölkerungsumsatz typisch war.19
Der Grund für diese Ziffern liegt natürlich in der fehlenden, den Eheleuten unbekannten und kirchlich verbotenen Geburtenkontrolle, worauf an anderer Stelle noch einzugehen sein wird.20 Gemäss der damals geltenden katholischen Lehre sollte Sexualität nicht nur ausschliesslich eine Sache zwischen Eheleuten sein, sondern in erster Linie der Zeugung von Nachkommen dienen. Eine hohe Zahl von Kindern sollten die Gläubigen nicht als Last, sondern als Gottesgeschenk betrachten. Die Kirche wertete dieses Verhalten – aus durchsichtigen Gründen, weil sich so die Zahl ihrer Mitglieder von selbst vermehrte – positiv; in Appenzell drückte einmal Bischof Meile bei der Firmung dem Vater einer 13-köpfigen Kinderschar persönlich die Hand, nachdem ihn der Pfarrer darauf aufmerksam gemacht hatte.21 Zur Arbeit in der Landwirtschaft war eine hohe Kinderzahl allerdings bis zu gewissen Grenzen hilfreich, denn Kinderarbeit im bäuerlichen Betrieb wurde als selbstverständlich betrachtet und bloss zwei Kinder wären dazu etwas wenig gewesen. Für die Knaben diente die Arbeit im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb der Einübung aller notwendigen Fertigkeiten, diesen oder einen anderen Hof später übernehmen und selbständig führen zu können, denn landwirtschaftliche Schulen wurden noch kaum besucht.22 Für die Töchter galt dasselbe in Bezug auf die Hausarbeiten; dazu konnten sie gewisse Vorarbeiten für das Sticken durchführen. Beim Heuen mussten die Kinder beider Geschlechter mithelfen. Auch das Hüten und Treiben des Viehs konnte ihnen anvertraut werden, wenn auch diese Tätigkeit in unserem Untersuchungsgebiet weniger wichtig war als im inner- und südalpinen Raum.23 Waren die Knaben etwas älter, so konnten sie den Vater teilweise oder ganz bei der Stallarbeit vertreten. Auch in Alpbetrieben wurden Knaben in den langen Schulferien als sogenannte Handbuben für Hilfsarbeiten eingesetzt; für viele war das trotz den Anstrengungen die schönste Zeit des Jahres. Litt ein Verwandter oder ein Nachbar Mangel an Arbeitskräften, so wurden bei zahlreich vorhandenen eigenen Kindern einige davon gerne tageweise oder auch länger als Arbeitskräfte «ausgeliehen». Auch hier wurde von diesen die Abwechslung meist geschätzt, und die Eltern hatten einen Esser weniger am Tisch. Die Aussagen mehrerer älterer Leute zeigen, dass man die landwirtschaftliche Kinderarbeit generell nicht negativ bewerten sollte: Die Freude an den Tieren und das Leben im Freien, der Stolz auf ein gelungenes Werk und das Bewusstsein, Verantwortung übernehmen zu können, kompensierten die dazu notwendigen Anstrengungen. Für viele Kinder war es sicherlich attraktiver, in der freien Natur zu arbeiten als in der Schulbank still sitzen und ein von der Lebensrealität manchmal etwas entferntes Lernprogramm absolvieren zu müssen. Sehr viel hing allerdings davon ab, ob die Eltern bei der bäuerlichen Arbeit geschickt und liebevoll mit den Kindern umzugehen verstanden.
Das Urteil, der Appenzeller Bauer liebe seine Kühe mehr als seine Kinder, findet sich zum erstenmal gegen Ende des 18. Jahrhunderts beim Reiseschriftsteller Johann Gottfried Ebel und wurde dann zu einem bis ins 20. Jahrhundert weitergeschleppten Topos.24 An seinem Ausspruch ist wahr, dass dem Viehbauern, wie überall auf der Welt, seine Herde zweifelsohne viel galt. Sie war ihm nicht nur Lebensund Nahrungsgrundlage, sondern stellte seinen eigentlichen Reichtum dar, sie war Anlass zu Besitzerstolz und verschaffte ihm bei sorgfältiger Pflege soziale Reputation. Auch überliessen wie allüberall die Männer die allgemeine Erziehung ihrer Kinder zur Hauptsache ihren Ehefrauen. Den aufgeklärten Ebel aber dürfte wie die zum selben Urteil gekommenen Pfarrherren des 20. Jahrhunderts der Umstand etwas irritiert haben, dass die Eltern die Erziehung ihrer Kinder eher lässig nahmen, die Schulpflicht nicht selten als bloss notwendiges Übel betrachteten und demgegenüber den Wert der bäuerlichen Arbeit betonten, aber auch den Heranwachsenden, zum Ausgleich von der teilweise strengen Arbeit, die nötigen Freiräume zur Erholung einräumten. Darauf wird im Zusammenhang mit der Geltung der moralischen Normen noch einzugehen sein.25