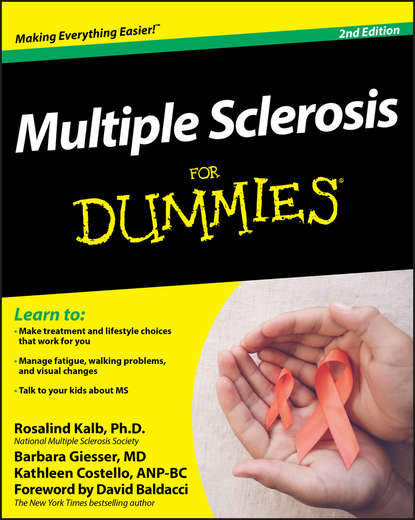- -
- 100%
- +
Aus dem Gesagten wird klar, dass Dienstboten in der voralpinen Landwirtschaft im Gegensatz zu den typischen Ackerbaugebieten des schweizerischen Mittellandes eine Randerscheinung blieben. Der Prozentsatz der in den Betrieben arbeitenden Familienangehörigen betrug 1929 in Obwalden 85 bis 90 Prozent, in Appenzell 90 bis 95 Prozent.26 Weibliche ländliche Dienstboten waren eine Seltenheit, Knechte gab es in begrenztem Ausmass (meist 1–2) in den grösseren Betrieben. Solche Hilfskräfte mussten vorübergehend auch eingestellt werden, wenn etwa der Familienvater plötzlich verstarb oder arbeitsunfähig wurde und noch kein Nachfolger bereit war. Auch während der Alpzeit mussten einige Bauern mit Privatalpen, aber ohne geeignete Familienangehörige, Angestellte beschäftigen, da sie ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein konnten. In Engelberg allerdings nahmen einige Älpler tägliche Wanderungen bergauf und bergab auf sich; auch Kinder wurden für den Milchtransport ins Tal eingesetzt. Erst mit der besseren Erschliessung und dem Auto war es unter günstigen Umständen möglich, dass eine Person die zwei räumlich getrennten Güter betreute.
2.3

Schon aus den bisherigen Ausführungen dürfte hervorgegangen sein, dass die Bauernschaft in Innerrhoden und Obwalden eine relativ homogene war und es keine grossen sozialen Unterschiede gab, jedenfalls geringere als in den Ackerbaugebieten des Mittellandes. Dieser Meinung waren auch praktisch alle Interviewpartner, wobei viele nicht von einer bäuerlichen Mittelschicht sprachen, sondern meinten, es seien eigentlich fast alle gleich arm gewesen. Einige machten ferner darauf aufmerksam, dass der Schein auch trügen konnte: Von nach aussen hin reich scheinenden, gut gekleideten und spendablen Bauern mit grossen Gütern wusste man nicht, ob sie nicht daneben vielleicht auch grosse Schulden hatten.
Grossbauern mit wesentlich mehr Land, dazu schönen Alpen und merklich mehr (oder auch bloss schöneren) Kühen als im Durchschnitt gab es zweifellos, aber sie waren Ausnahmen. In Appenzell gab es 1969, also zu einer Zeit, wo sich der Trend zur Flächenvergrösserung bereits bemerkbar machte, nur 42 Betriebe mit über 20 Hektaren Land; das waren 3,6 Prozent aller Betriebe.27 In Engelberg wurden von den Interviewten einige wenige Grossbauern in der Talebene genannt; dasselbe galt offenbar auch für die Sarner Ebene. Solche Güter waren gelegentlich durch eiserne Sparsamkeit oder glückliche Erbschaften zustandegekommen; bei mehreren Söhnen wurde dann aber der eventuell mehrere Liegenschaften umfassende Betrieb meist wieder aufgeteilt und somit auf das Normalmass zurückgeführt. Oder die Grossgüter gehörten reichen Viehhändlern,28 welche mit ihrer Tätigkeit ansehnliche Gewinne gemacht hatten und damit andere Liegenschaften von tief verschuldeten Bauern aufkaufen konnten. Diese reichen Bauern waren schon von der Grösse ihrer Betriebe her auf Dienstboten angewiesen.29 Sie verfügten häufig über Pferde, hatten eventuell sogar eine auswärtige landwirtschaftliche Schule besucht und waren daher innovativer, insbesondere schon in den 1940er-Jahren als Vorreiter der Mechanisierung.30 Sie trugen gute Kleider und ihre Frauen hatten eine teure Tracht. In Obwalden verfügten sie wohl auch über ein «Chremmli», einen eigenen Sitz in der Kirche, und konnten sich vor dem Kirchgang beim Coiffeur rasieren lassen. Im Gasthaus konnten sie sich Fleisch und Wein leisten, und gelegentlich lag auch eine Reise drin. Sie trugen aber auch finanziell zum Kirchenprunk bei, und ebenso erwartete man von ihnen eine freiwillige Mitbeteiligung an den sozialen Lasten, denn sonst hätten sie sich des Geizes, bekanntlich eine Todsünde, schuldig gemacht. Vor allem aber repräsentierte diese Schicht auf der politischen Ebene die Bauernschaft, als Gemeinde- oder Bezirksräte oder sogar als Präsidenten, als Vorsteher anderer Körperschaften (Kirchgemeinde, Kommissionen, Korporationen, landwirtschaftliche Vereine usw.), bis hin zur kantonalen Ebene, zuletzt in der Regierung, namentlich im Landwirtschaftsdepartement.31 Daneben aber gelang in den Landsgemeindekantonen nicht selten auch einem «Kleinen» der Aufstieg in offizielle Ämter.
Unbestritten bleibt jedoch, dass es am anderen Ende des sozialen Spektrums arme Leute gab. Ihr Prozentsatz ist schwierig abzuschätzen, war aber sicher grösser als derjenige der Reichen. Doch waren diese Leute nicht in erster Linie unter den Bauern zu finden und wenn schon, dann eher bei den Nebenerwerbslandwirten, vor allem aber bei der dörflichen Unterschicht der einfachen Arbeiter oder Ungelernten. Der Grossteil der Bauern führte eine Existenz im mittleren Einkommenssegment: «Es reichte gerade: genug zum Leben, aber keinen Luxus», so oder ähnlich lautete die Antwort der meisten Interviewten zur Frage der Auskömmlichkeit. Die Aussage entsprach ziemlich genau den damals auf dem Lande noch einigermassen verbindlichen Idealen der christlichen Lehre, die Genügsamkeit predigte und das Ansammeln von Reichtümern verurteilte. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Definition der Armut in den letzten 50 Jahren massiv verschoben hat, darf man im Rückblick die zitierte Feststellung so interpretieren, dass damit die Lebensverhältnisse einer breiten Schicht umschrieben wurden, die sich selber vermutlich nicht als arm fühlte, aber heute, gemessen an unserem gewohnten Lebensstandard und aufgrund der amtlichen Kriterien für Armut, sicher zu dieser Kategorie gezählt würde. Soziale Gleichheit gehörte nicht zu den unbedingt erstrebenswerten Gütern dieser ländlichen Gesellschaft, jene predigten nur die Sozialisten in den Städten und praktizierten die Kommunisten im Osten, mit furchtbaren Folgen. Die «Roten» waren ja in der Nachkriegszeit der ideologische Gegner Nummer eins, wie Geistlichkeit und konservative Politiker bei jeder Gelegenheit hervorhoben.
Die Landwirtschaft bot ihren Beschäftigten in jedem Fall eine minimale Subsistenzbasis, die, wenn nicht gerade zehn und mehr Kinder am Tisch sassen, wenigstens knapp zum Leben ausreichte. Vor allem von den Obwaldnern wurde betont, dass zwar viele bäuerliche Haushalte (relativ) arm gewesen seien, aber trotzdem nie Hunger gelitten hätten. Die dort übliche Selbstversorgung mit Kartoffeln, Gemüse und Obst trug wesentlich zu dieser vergleichsweise günstigen Situation bei. Die ärmeren Appenzeller Familien waren hier schlechter dran, denn sie mussten praktisch alle Lebensmittel, ausser den tierischen Produkten, zukaufen. Gerade Bargeld war aber in solchen Haushalten rar, kam allenfalls von Nebenverdiensten. Deswegen hatte hier auch die Stickerei der Frauen eine viel grössere existenzielle Bedeutung als die Heimarbeit in Obwalden. Sie war notwendiger Teil des Familieneinkommens, nicht bloss Zustupf. Dass diese ländliche Mittelschicht auf vieles verzichten musste, war selbstverständlich – dieser Verzicht wurde aber nicht als Armutsmerkmal betrachtet. Man hatte in vielen Fällen wenigstens die Wahl, wo man sparen und was man sich als «Luxus» trotzdem leisten wollte: beim Essen und Trinken, beim Heizen oder der Wohnungseinrichtung, bei der Bekleidung oder beim Reisen.32 Gelegentlich wurden spezielle Begrenzungsstrategien angewandt: Das Milchgeld, das Einkommen aus dem Verkauf von bestimmten Produkten (Obst, Eier) oder der Lohn der Frau und so weiter mussten bestimmte Ausgabeposten ohne andere geldliche Zuflüsse abdecken. In sehr vielen Fällen waren notwendige Einschränkungen auch nur vorübergehend: Der Bauer hatte kein fixes Einkommen, für ihn war selbstverständlich, dass es gute und schlechte Jahre gab, die Ernten und Viehpreise schwankten und dass dementsprechend die Einkünfte unterschiedlich waren.
Die tatsächliche Armut, also ein Zustand, wo eine Familie wirklich zeitweise Hunger litt und die Frauen kaum wussten, womit sie am nächsten Tag Brot kaufen oder den Kochtopf füllen sollten, wo die Kleidungsstücke vor allem Löcher hatten und die Kinder einen grossen Teil des Jahres barfuss gingen, die Wohnräume erbärmlich ausgestattet und im Winter eher kalt waren, wurde verschieden bewertet. Die Kinderzahl spielte bei solchen Zuständen zweifellos eine entscheidende Rolle. Aber dieses Thema war tabuisiert und wurde von den meisten als unabänderliches Schicksal hingenommen. Es gab Arme, deren Notlage man als selbstverschuldet betrachtete – etwa bei Trinkervätern und anderen unordentlichen Verhältnissen – und die deshalb wenig Erbarmen, sondern im Gegenteil Verachtung hervorriefen. Umgekehrt stiess unverschuldete Armut auf Mitleid und Hilfsbereitschaft in verschiedenen Formen. Solche Fälle waren infolge mangelnden Versicherungsschutzes vor allem für Personen damals nicht selten.33 Längere oder komplizierte Krankheiten sowie Unfälle mit nachfolgender teilweiser oder gänzlicher Arbeitsunfähigkeit konnten eine Familie an den Rand der Existenz bringen. Besonders schlimm war der Verlust eines Elternteils durch unerwarteten Tod. Wenn, aus welchen Gründen auch immer, keine Wiederverheiratung des überlebenden Ehepartners erfolgte, so wurden die Kinder, wenn nicht Verwandte oder die Paten sich ihrer annahmen, ins Waisenhaus gegeben. In Obwalden gab es mehrere davon. Im zentralen appenzellischen Waisenhaus «auf der Steig» waren 1948 noch rund 100 Kinder untergebracht.34 In diesen Häusern erhielten sie von Ordensschwestern eine strenge und oft lieblose Erziehung, besuchten aber im Übrigen die reguläre Dorfschule. Das im Mittelland früher übliche Verdingkindersystem kannte man dagegen in unserem Untersuchungsgebiet kaum. Männliche Waisen wurden allerdings häufig Bauernknechte.
Nachdem die wesentliche Ursache struktureller Armut, nämlich die hohe Kinderzahl, nicht hinterfragt werden konnte und durfte, waren die Kirche und ihre Repräsentanten ebenso wie die einfachen Gläubigen gefordert, die in der Bibel vorgezeichnete Karitas zu üben. Diese war im katholischen Raum sehr ausgebaut. Es gab neben der staatlichen und gemeindlichen Armenpflege und neutralen Organisationen (Winterhilfe usw.) auch kirchliche Institutionen, welche sich der Fürsorge der Armen widmeten. In Appenzell etwa half ihnen der Vincentiusverein mit Sach- und Geldspenden. So konnten sie zum Beispiel bei einem Bäcker einen Monat lag unentgeltlich Brot beziehen oder bekamen einen Sack Kartoffeln.35 Andere Vereine machten dort alljährlich Weihnachtsbescherungen für die Kinder armer Familien. In Obwalden existierten alte Spendstiftungen und das «Elisabethengeld» für Arme.36 Wie auch anderswo, gab es beiderorts in jeder katholischen Kirche einen speziellen, dem Antonius von Padua gewidmeten Opferstock. In diesen warf man vor allem Geld, wenn man einen Gegenstand verloren hatte und den mit Hilfe des Heiligen wieder zu finden hoffte. Die Erträgnisse gingen an die Armen. Ferner gab es sonntägliche Kirchenopfer zu deren Gunsten. Eine in der ganzen katholischen Welt bekannte und bis in die 1960er-Jahre noch viel benutzte Einrichtung war ferner die Klostersuppe. Es gab sie in den beiden Kapuzinerklöstern von Appenzell und Sarnen, ebenso in den beiden dort ansässigen Frauenklöstern sowie im Stift Engelberg. Die nicht allzu weit entfernt wohnenden Dorfarmen konnten sie dort mittags in einem besonderen Stübchen einnehmen oder sogar in einem Kesselchen nach Hause tragen37 und hatten damit wenigstens eine warme Mahlzeit im Tag. Es war ferner üblich, dass die Armen an die Türen der Pfarrhäuser klopften, um eine Gabe zu erbitten. Das Verhalten der geistlichen Herren dabei wird von den befragten Leuten unterschiedlich geschildert: Es gab neben zugeknöpften, ja geizigen, auch solche, die trotz ihrer damals nicht seltenen geringen Entlohnung sehr mildtätig waren, ja in Ausnahmefällen die Bettelleute sogar zu Tisch luden.38 Ein solches Verhalten konnte selbstverständlich von «Berufsbettlern» auch missbraucht werden und dann auf die Dauer lästig, ja fast erpresserisch werden. Dreiste Bettler wie in früheren Jahrhunderten gab es allerdings nur mehr selten; die meisten schämten sich ihres Zustands. Bei grossen und katastrophalen Unglücken, die sogar mehrere Familien betrafen, wurden, wie anderswo auch, spezielle Aktionen in Gang gesetzt, um den Betroffenen zu helfen.
2.4

Die oft beschriebene typische Streusiedlung im Appenzellischen – etwas weniger ausgeprägt in Obwalden und den übrigen nordalpinen Landschaften – mit ihren arrondierten und eingezäunten «Heimaten» hat einige auswärtige Beobachter zur Vermutung veranlasst, wir hätten es hier mit einer Gesellschaft von ausgeprägten Individualisten zu tun. «Hochburg des Eigenwillens» titelte Fritz René Allemann seinen Beitrag über den Kanton.39 Wollte man aber andererseits in den 1940er- und 50er-Jahren am späten Mittwochmorgen die Hauptgasse des Dorfes Appenzell queren, so kam man kaum über die Strasse und hätte, wie der Volksmund sagte, «auf den Köpfen gehen müssen». So dicht standen die Bauern jeweils dort zusammen. Individualismus und Gemeinsinn schlossen einander also nicht aus.
Die Frage nach der Solidarität wurde von den Interviewpartnern nicht selten etwas ausweichend beantwortet: Wer schon hätte unsolidarisches Verhalten und Konkurrenzdenken, erst recht dauernden Zank und Hader zugeben wollen, sei es auch nur bei anderen Mitmenschen?40 Ein derartiges Verhalten wäre Sünde und direkt gegen das christliche Liebesgebot gewesen. Auf den bestehenden, aber nicht in jedem Fall konfliktträchtigen Gegensatz zwischen der Mittelschicht und den wenigen Grossbauern wurde schon hingewiesen. Zu Konkurrenzdenken konnte vieles Anlass geben: Wer hatte die ansehnlichsten Häuser und Ställe, den grössten Landbesitz, die fettesten Alpen, die schönsten Kühe, die am reichsten geschmückte Sennentracht (im Appenzellischen)? Doch derlei dürfte allgemein verbreitet sein, fand nur in der Bauernschaft des Voralpengebiets seine spezifische Ausprägung. Gelegentlich wurde darauf hingewiesen, die Solidarität sei früher grösser gewesen als heute – eine Feststellung, die für den Kenner der gegenwärtigen agrarischen Welt wohl keines Kommentars bedarf. In der Tat war wie in anderen Gesellschaften die bäuerliche Nachbarschaftshilfe in Problemsituationen (Zeitbedrängnis beim Heuen, Unwetterschäden, Unglücksfälle usw.) früher selbstverständlich – sich abseits haltende Aussenseiter wären da noch mehr an den Pranger gestellt worden. Andererseits gab es natürlich immer wieder Schwierigkeiten beim alltäglichen Zusammenleben. Anlass zu letztlich nicht selten beim Richter endenden Auseinandersetzungen gaben etwa umstrittene Quellen- und Wegrechte.41 Jahrzehntelange Familienfehden wurden in den Gesprächen nicht erwähnt. Sie sind nicht auszuschliessen, waren aber in den Bergen aus nachvollziehbaren Gründen mutmasslich seltener als im Tiefland.
Während der Arbeit gab es im Allgemeinen wenig zwischenmenschliche Begegnungen bei den Bauern, abgesehen etwa von den unmittelbaren Nachbarn und dem Zusammentreffen bei der täglichen Milchablieferung.42 Die wichtigste Kommunikationsmöglichkeit waren der sonntägliche Kirchgang und andere kirchliche Veranstaltungen, worauf noch einzugehen sein wird.43 In Appenzell gab es ausserdem allwöchentlich den eingangs erwähnten Mittwochsmarkt, der wegen seiner Singularität44 etwas näher betrachtet werden soll, vor allem auch, weil hier neben der geschäftlichen und kommunikativen Funktion auch die barocke Komponente der Musse zum Zuge kommt: Der Mittwoch wurde nämlich auch «Bauernsonntag» genannt. Nach Erledigung der morgendlichen Stallarbeit machten sich an diesem Tag die meisten Innerrhoder Bauern zu Fuss, allenfalls mit dem Fahrrad, auf den Weg ins Dorf.45 Sie trugen ein Stoffsäcklein («Reissäckli») mit sich, in welchem sie für den Rückweg ihre Einkäufe verstauten.46 Der Markt war zunächst Viehmarkt – wer also ein Tier zu verkaufen hatte, nahm die vierbeinige Ware mit sich. Man besorgte Einkäufe, in erster Linie Lebensmittel (die ja im Appenzellischen abgesehen von den tierischen kaum selber erzeugt wurden), aber auch etwa Tabak, Eisen- und Lederwaren und dergleichen. Mit den Erlösen aus Verkäufen zahlte man fällige Rechnungen und Bankzinsen bar. Man besorgte amtliche Geschäfte und holte notwendige Informationen (insbesondere die aktuellen Marktpreise) ein. Vor allem aber wurde die Gelegenheit wahrgenommen, Alles und Jedes, mit wem auch immer, zu besprechen. Diese Kommunikation fand im Freien statt – eben in der Hauptgasse (was bedeutete, dass dort mindestens für Autos kaum mehr ein Durchkommen war), auf den Marktplätzen oder aber in den bei dieser Gelegenheit ebenso randvollen Wirtschaften.47 Diese wurden zwingend bei einem grösseren Handel aufgesucht,48 sonst je nach Einkommenslage oder aber auch nach Entfernung von zu Hause. Vermögendere assen dort eine der bekannten Appenzeller Würste und tranken Wein oder Bier, andere begnügten sich mit Suppe oder einem Kaffee mit Gebäck, viele kehrten gar nicht ein. Im Laufe des Nachmittags, nachdem vielleicht noch ein Jass49 geklopft worden war, traten dann die meisten wieder den Heimweg an, um rechtzeitig für die abendliche Stallarbeit bereit zu sein. Vereinzelte, die erst spät, nach ausgiebigem Jassen und durch allzu reichlichen Alkoholgenuss bisweilen eher schwankend ihr Heim erreichten, trafen auf allgemeine Verachtung und auf ein empörtes Eheweib.
Der «Bauernsonntag» hatte kompensatorische Funktion. Der eigentliche Sonntag war ja nie ganz frei, sondern die Besorgung des Stalls beanspruchte genau gleich viel Zeit wie an einem Werktag. Deswegen liess man am Mittwoch die Arbeit draussen etwas ruhen und nahm sich einige Stunden frei, teils für notwendige geschäftliche Dinge, aber auch einfach zum Vergnügen. Weniger wichtige Arbeiten zu Hause konnte man eventuell den Söhnen überlassen. Am Mittwoch wurde nicht geheiratet, und es fand auch kein Alpaufzug oder -abzug statt.50 Eine Ausnahme war die Zeit des Heuens und Emdens; diese Arbeit hatte selbstverständlich Priorität vor dem Markt. Der Mittwochsmarkt in seiner traditionellen Form fand in den 1960er-Jahren sein Ende. Die Forderungen des zunehmenden Autoverkehrs liessen die stundenlange Blockierung der Hauptgasse nicht mehr zu. Die Bauern konnten ihre Einkäufe und Geschäfte anderweitig besorgen, zuletzt zunehmend auch mit dem Auto. Viehhändler und Futterverkäufer kamen auf den Hof, Rechnungs- und Zinszahlungen wurden per Post erledigt und die Marktpreise jeweils im «Volksfreund» publiziert. Dazu hatte auch jeder Bauernhof jetzt ein Telefon.
Eine vergleichbare Einrichtung gab es in Obwalden nicht. Hauptgrund war vermutlich die weniger zentralisierte politische und geschäftliche Struktur. In Appenzell konzentrierte sich alles auf den Hauptort, während man in Obwalden vieles in der Gemeinde erledigen konnte und nur ausnahmsweise nach Sarnen musste. Selbstverständlich gab es hier wie auch in Appenzell und überhaupt in der ganzen ländlichen Schweiz die grösseren saisonalen Jahrmärkte, besonders im Herbst.51 Sie dienten nicht nur dem Viehhandel, sondern boten durch die vielen Stände der wandernden Krämer auch ein grosses Warenangebot, für die Leute selbst wie für ihre bäuerliche Tätigkeit. In der Zwischenzeit kamen Viehhändler und Metzger in Obwalden selbst auf die Höfe, Einkäufe von Lebensmitteln, besonders Brot, konnten Frauen oder Kinder in der Nähe besorgen. Die sozialen Kontakte fanden hier mehr am Sonntag oder unter der Woche bei der Milcheinlieferung, beziehungsweise in den Wirtschaften statt, die besonders bei Schlechtwetter auch an Werktagen besucht wurden.
2.5

Die bäuerliche Arbeit im Gebiet der reinen Milchwirtschaft und Viehzucht ist von Ferdinand Fuchs am Beispiel Innerrhodens im Tages- und Jahresablauf in allen Aspekten ausführlich beschrieben worden.52 Seine Feststellungen dürften im Wesentlichen für das ganze schweizerische Voralpengebiet verallgemeinerbar sein, abgesehen von wenig wichtigen Einzelheiten. Die Techniken der Viehbesorgung und Milchgewinnung unterschieden sich ja nicht grundsätzlich. Aus diesem Grund können wir uns hier auf eine summarische Darstellung jener Sachverhalte beschränken, die für die nachfolgenden Fragestellungen wichtig sind. In erster Linie interessiert das Verhältnis zur Zeit.
Eine grundlegende Bemerkung dazu wurde von mehreren Befragten gemacht: Obwohl die Tätigkeit streng und der Arbeitstag lang gewesen sei – eben wegen der praktisch ausschliesslichen Handarbeit –, hätten bei den Landwirten weniger Hetze und Druck als heutzutage geherrscht. Man habe es gemächlicher genommen und auch immer wieder für Pausen gesorgt. Letzteres ist ohne weiteres nachvollziehbar, denn anstrengende körperliche Arbeit rief von Zeit zu Zeit nach einem erholenden Ausgleich. In grösserem Masse ermöglichten diesen die früher noch zahlreicheren Feiertage und die Wallfahrten, auch wenn sie zumeist nicht in die arbeitsreichen Zeiten, sondern gemäss dem agro-liturgischen Kalender gerade umgekehrt in eher flaue fielen.53 Zwar nicht in unseren Untersuchungsgebieten, aber zum Beispiel im Luzernischen oder im Tirol, beendete man an Samstagen die Arbeit, abgesehen von der Tätigkeit im Stall, etwas früher.54 Waren viele Leute auf dem Hof, so liessen sich die verschiedenen Tätigkeiten auch besser verteilen und man konnte sie mit Ausnahme des Heuens geruhsamer angehen. Aber nicht nur sich selber, sondern auch den Tieren liess man mehr Zeit. So waren viele Appenzeller Bauern überzeugt, dass es der Gesundheit der Kühe zuträglich sei, wenn man beim Füttern langsam vorgehe. Sie verabreichten daher das Futter nicht auf einmal, sondern in kleinen Portionen, wodurch auch sie selber immer wieder Pausen hatten. Das ermöglichte ihnen zusätzlich, die Tiere genau zu beobachten und ihre Eigenheiten kennen zu lernen. Die Kuh war für sie noch ein Individuum und nicht einfach eine serienmässige Milchproduktionsmaschine.
Die Stallarbeit musste ausnahmslos jeden Tag erfolgen, auch an Sonn- und Feiertagen, wodurch sich verschiedentlich Kollisionen mit dem Gottesdienstbesuch und der Ausübung der Religion überhaupt ergeben konnten, auf die noch einzugehen sein wird.55 Im Winter beanspruchten die notwendigen Arbeitsgänge wie das Füttern, Tränken, Melken, Putzen der Tiere und des Stalles den allergrössten Teil des Arbeitstages. Er begann in Appenzell meist zwischen 5 und 6 Uhr und dauerte in der Regel bis etwa 10 Uhr morgens. Bauern, die später begannen, sehr langsam vorgingen oder allein eine grössere Zahl Tiere zu versorgen hatten, brauchten selbstverständlich länger, manchmal fast bis zum Mittag. In Obwalden begann man offenbar noch früher, war dann aber oft schon zwischen 8 und 9 Uhr fertig.56 Am Nachmittag fing man mit denselben Tätigkeiten überall zwischen 15.30 und 16 Uhr an, sie dauerten bis maximal 19 oder 20 Uhr. Zusammengenommen kam man damit im Schnitt bereits auf einen Acht- oder Neunstundentag. Im Sommer war die Arbeit um einiges kürzer. Die Kühe suchten ja ihr Futter jetzt selbst frisch auf der Weide, bloss das Rauslassen und Einholen der Tiere brauchte ein wenig Zeit. Im Winter war auch das Tränken umständlicher und bedurfte gelegentlich der Hilfe der Frau oder der Knaben: Es fand beim Brunnen vor dem Hause statt, die Tiere mussten folglich in die Kälte und den Schnee hinaus getrieben werden.57 Auf die speziellen Probleme, insbesondere den zusätzlichen Zeitaufwand, die sich ergaben, wenn die Kühe auf einem Vorsäss oder der Alp waren, ist hier nicht weiter einzugehen. Interessant ist aber ein Detail, das mehrere Befragte in Innerrhoden erwähnten. Am Abend schob man früher vor allem in jenen stark traditionellen Betrieben, welche die Milch noch ganz oder teilweise selber verarbeiteten, zwischen Füttern und Melken oft eine Pause von etwa ein bis anderthalb Stunden ein und melkte manchmal erst gegen 20 Uhr. Wenn man sich in der Zwischenzeit nicht anderen Arbeiten widmete, etwa der Butterherstellung, oder schon das Abendessen einnahm, so vertrieb man sich die Zeit, wenigstens im Winter, zusammen mit Nachbarn mit Jassen.58 Hier wurde also wiederum noch eine gewisse bäuerliche Musse gepflegt. Diese Gemütlichkeit hörte aber auf, als die Milchzentralen, welche nur eine begrenzte Zeit für die Einlieferung vorsahen, sich allgemein durchsetzten.59
2.6