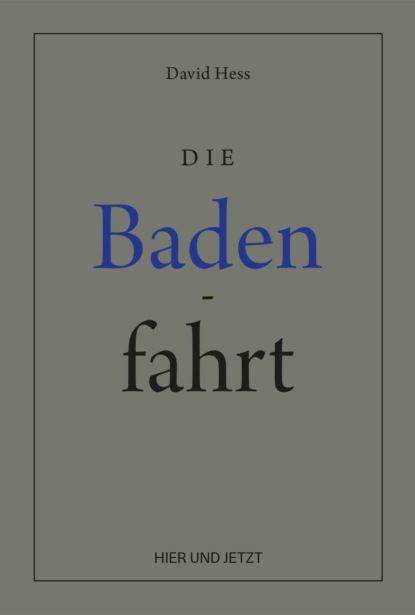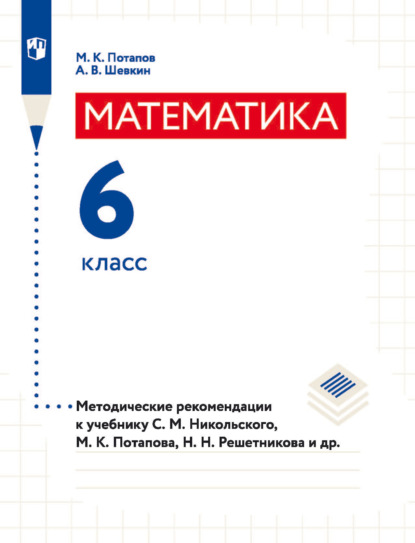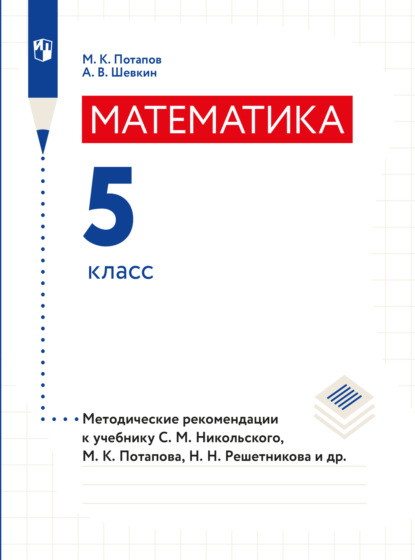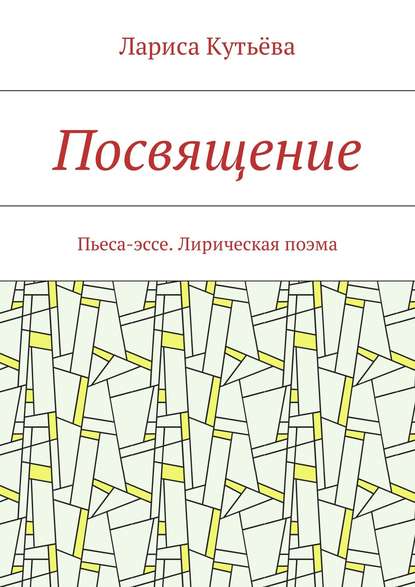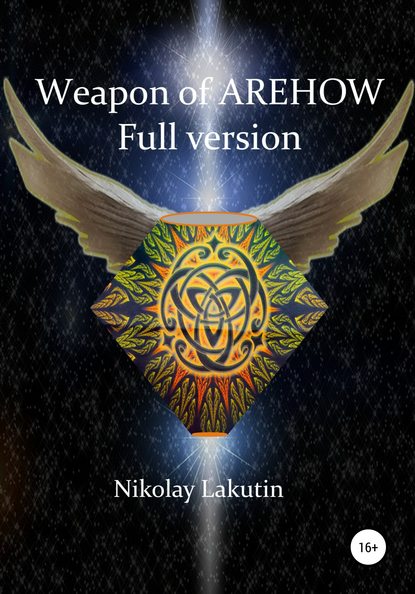- -
- 100%
- +
Eigentlich möchte ich keinen Gasthof auf Unkosten oder zum Nutzen eines anderen rühmen oder tadeln. Strenge Unparteilichkeit ist Pflicht des Schriftstellers; er soll reine Wahrheit suchen und diese nach seiner Überzeugung aussprechen. Dagegen sollten aber auch die verschiedenen Wirte nie aufeinander eifersüchtig sein, weil jeder nach Massgabe seiner Aufmerksamkeit für die Gäste gut bestehen wird.
Alle Samstage wird im Staadhof getanzt. Vor 20 und 30 Jahren belustigten sich hier nur Bürgersleute und ich selbst habe noch an diesen Sonnabendbällen wackere Fleischer und Müller ohne Ärmel hinter dem Tische sitzen, trinken und ihre Pfeife rauchen sehen. Der Hauptball der vornehmeren schönen Welt fand erst am Sonntagabend in dem sogenannten grünen Saal im Hinterhofe statt. Allein dieser darf jetzt wegen seiner Baufälligkeit nicht mehr dazu benutzt werden, und in der Regel tanzt man nur noch im Staadhof. Die Gesellschaft sämtlicher Höfe und Badanstalten, jeder gesittete, anständig gekleidete Gast kann an diesem Ball teilnehmen. Der Staadhofwirt verrechnet eine Kleinigkeit für die aufgetragenen Erfrischungen und die Tänzer bezahlen die Musik.
Die ganze Woche hindurch freuen sich die jüngeren Frauenzimmer, welche nur für ihr Vergnügen hier sind, auf diese Gelegenheit, ihren mitgebrachten Putz anzuwenden und sich recht satt zu walzern. Zu Pferd, in Wagen und Schiffen strömen an diesen dem Tanz gewidmeten Sonnabenden die jungen Herren herbei, und der gemischte Ball, wo neue Bekanntschaften gemacht, alte erneuert und kleine Liebesromane gespielt werden, dauert meistens länger als die Regeln der Kur es eigentlich gestatten.
Da wir jetzt sämtliche Grossen Bäder auf dem linken Limmatufer kennen, wollen wir uns auf das rechte hinübersetzen lassen, wozu immer eine Fähre bereit ist, und noch einen flüchtigen Blick auf die dortigen Kleinen Bäder in Ennetbaden werfen, welcher Ort zwar sein abgesondertes Gemeindegut besitzt und von jeher eigene Vorsteher zur Besorgung seiner Privatrechte, daneben aber teil am Kirchen- und Armengut der Stadtgemeinde hatte und dieser politisch und polizeilich einverleibt war. Seit Kurzem sitzt ein angesehener Bürger von Ennetbaden im Stadtrat. Allein man geht damit um, diesen Nebenort vermittelst Abreichung einer Kapitalsumme von der Stadt zu trennen und in eine für sich ganz allein bestehende Gemeinde zu verwandeln.
Die Kleinen Bäder, wo gewöhnlich nur Bauern, Handwerker und weniger bemittelte Leute einkehren, bilden eine eigene Kolonie und haben mit den Grossen jenseits keinerlei Gemeinschaft. Die hier dicht am Fluss entspringenden Quellen, eine grosse und vier kleinere, gehören den vier Badwirten Zum Stern, Zum Engel, Zum Rebstock und Zum Hirschen. Ein fünftes Wirtshaus, Zum Löwen, besass ehemals einen fünften Teil an diesen Quellen, und die Gemeinde Ennetbaden hatte einen sechsten Teil angesprochen, woraus ein Prozess entstand, welcher durch ein von den acht alten Orten am St. Ulrichstag 1512 gefälltes Urteil dahin entschieden ward, dass zwar die Bürger von Ennetbaden sich des dortigen Freibades sollten unentgeltlich bedienen dürfen, aber nur wenn sie neben den Gästen der fünf Wirtshäuser Platz fänden, und dann müssten sie noch, eh sie sich ins Bad setzen dürften, ihre Füsse rein waschen. Für diesen Zutritt ins Bad muss die Gemeinde noch heutzutage den sechsten Teil an die Kosten zur Unterhaltung des Freibades und an die Besoldung des Badwäschers zahlen. Im Jahr 1536 brannte das Haus zum Löwen ab, und da dasselbe nicht wieder aufgebaut wurde, fiel sein Fünftel an den Quellenrechten auf die vier übrigen Badhäuser zurück und der Platz ward zum Stern gekauft.
So wie wir aus dem Schiffe steigen, sehen wir zur Linken das grosse gemeinschaftliche Schröpfbad, in welchem selbst eine der vier kleineren Quellen aus der Erde hervorströmt. Es kann gegen 60 Personen fassen und hat zur Seite noch eine besondere Abteilung. Einige Schritte höher zur Rechten des kleinen Platzes steht ein anderes öffentliches Bad, welches sein Wasser zunächst aus der Hauptquelle bezieht. Diese sind aber nicht unbedingte Freibäder, indem jeder, welcher, ohne Bürger von Ennetbaden zu sein, sich derselben bedienen will, für den Tag im Schröpfbad einen, im anderen öffentlichen Bad aber zwei Schillinge bezahlen muss. Hier wird auch kein Almosen ausgeteilt; dagegen sind diese Bäder gehörig eingefasst, bedeckt und gegen Wind und Wetter geschützt. Die Badschillinge fallen in eine gemeinschaftliche Büchse, aus welcher die vier Wirte ihren Kostenanteil an den Unterhalt dieser öffentlichen Bäder und die Besoldung des bei denselben angestellten Badwäschers bestreiten. Das Schröpfrecht, das sie jüngst durch Kauf an sich gebracht, haben sie bereits für 380 Gulden jährlichen Zins verpachtet.
Zum Stern, wo kürzlich nur viere waren, gehören nun durch Anbau von vier neuen acht; Zum Engel nur vier, Zum Rebstock durch vier neu hinzugekommene acht und Zum Hirschen, ebenfalls durch vier neue, acht Privatbäder, welche alle sehr reinlich sind, wovon indes der grössere und ältere Teil für nicht viel mehr als öffentliche Bäder gelten kann, indem wenigstens über den stärksten Andrang die Hausgäste darin so nahe als möglich zusammengesetzt werden. Die auffallend zunehmende Betriebsamkeit der Badwirte wird aber diese Anstalten bald zu gemächlicherem Gebrauch vermehren und erhöhen.
Kraft alter Freiheiten hatten diese Wirte eine Polizeiordnung entworfen, welche ihnen am St. Luzientag 1506 vom Schultheiss und Rat bestätigt ward. Darin heisst es unter anderem: «Fragt ein Gast, wo gut Zehrung wäre, soll und mag ein Knecht und sein Weib wohl reden an allen Orten und Enden» (das heisst in allen Wirtshäusern gleich gut), «fragt aber ein Gast mit Namen in ein Haus, das soll man ihm weisen und sagen.»
Vor Zeiten war den Juden in Ennetbaden ein eigenes, abgesondertes Bad eingeräumt, das aber für sie eingegangen ist. Die Wirtshäuser Zum Kreuz, Zum Rössli, Zum Ochsen, welches letztere sehr fröhlich gelegen und empfehlenswert ist, haben keinen Teil an den Quellen, folglich auch keine eigenen Bäder. Ihre Gäste dürfen sich bloss der öffentlichen bedienen.
Die hier befindliche St. Michaelskapelle wird von den Kapellanen der Stadtkirche versehen.
Früher soll es in Ennetbaden etwas liederlich zugegangen sein und angesehene Leute, die sich schämten, ihre Bacchanalien mit feilen Dirnen in den Grossen Bädern unter den Augen vieler Zuschauer zu begehn, fanden hier Gelegenheit dazu. Dergleichen ist jetzt nicht mehr zu bemerken, und mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, wo benachbarte Landleute sich hier zum Trunk, zu Spiel und Tanz versammeln, herrscht Ordnung und Stille in den Kleinen Bädern. Wir finden weiter nichts zu beobachten, setzen uns wieder in den Nachen und lassen uns auf das linke Ufer zurückführen.
Dort bilden die sämtlichen Grossen Bäder, welche als integrierender Teil zur Stadtgemeinde gehören, einen eigenen Eingang, welcher an der Halde durch das Haupttor beim Landungsplatz am Wasser und bei der Mattenkirche durch Nebentore alle Nacht abgeschlossen wird. Der Hinter- und Staadhof haben noch ihre besonderen Tore. Um nicht eine weitläufige und verwirrende Beschreibung aller auf beiden Flussufern befindlichen Quellen und ihrer Verteilung in die verschiedenen öffentlichen und Privatbäder und aller Gebäude liefern zu müssen, verweise ich auf den hinten beigefügten Grundriss, den ich der Gefälligkeit des Herrn Leonhard Schulthess im Lindengarten zu verdanken habe, welcher auf seinem Originalplan die jedes Jahr vorfallenden Veränderungen mit grosser Genauigkeit nachträgt.13
Über die Quellenrechte und das jedem Eigentümer zukommende Quantum Wasser wachen und ordnen wie vormals Schultheiss und Rat nunmehr der Ammann und die Stadträte, unter deren Aufsicht die Sammler und Leitungen gemeinschaftlicher Quellen in den Grossen Bädern alle Jahre einmal, am Montag in der Karwoche, untersucht und gereinigt werden. Als Grundlage der Ansprüche jedes Teilhabers wird ein altes, die Badschüssel genanntes Modell des Kessels unter dem heissen Stein, mit allen Seitenöffnungen und den auf messingenen Stäben genau verzeichneten Ausmessungen der verschiedenen Wasserausteilung im Stadtarchiv aufbewahrt. Wenn ich den Überfluss und Gehalt dieses wohltätigen Mineralwassers, die schöne Gegend, in der es hervorquillt und das Bedürfnis des Zeitalters betrachte, so kann ich mich des Wunsches nicht erwehren, dass sämtliche Bäder und Gasthöfe in Baden von einer liberalen Regierung gekauft und nach einem einzigen neuen, alles umfassenden Plan von Grund ausgebaut und eingerichtet werden möchten.
Auf beiden Limmatufern sprudeln in einem kleinen Umkreis 17 warme Quellen, die im Fluss noch vorhandenen nicht gerechnet, aus der Erde hervor und liefern nach Scheuchzers schon im Jahr 1732 bekannt gemachter Berechnung in 24 Stunden 463,036 Badener Stadtmasse14 warmen Mineralwassers. Wie mannigfaltig könnte ein solcher Reichtum benutzt werden!
Alle auf dem linken Ufer befindlichen Wirtshäuser und Bäder sollten weggeräumt und dagegen vier bis fünf grosse zusammenhängende, mit Hofräumen versehene Flügelgebäude aufgeführt werden. In den Fassaden Speise- und Gesellschaftssäle, Küchen und eine Apotheke, nebst Reihen abgesonderter Zimmer für einzelne Gäste. In den Flügeln Wohnungen von mehreren zusammenhängenden Zimmern und Kabinetten für ganze Familien, mit kleinen Küchen, womöglich mit eigenen Seitentreppen (escaliers dérobés) in das jeder Abteilung zustehende Bad. Im ersten und zweiten Stock könnte mit einiger Abwechslung, kleiner oder grösser, wohlfeiler oder kostbarer, je nach dem Bedürfnis ungleich begüterter Menschen eine ähnliche Einteilung stattfinden. Auf jeder Türe müsste neben der Nummer der Mietpreis angeschrieben stehen. In kleineren Seitengebäuden eigene Einrichtung und Wirtschaft für Bauern oder andere weniger bemittelte Leute, die doch noch im Fall wären, ihre Kur zu bezahlen. Ein geräumiges, aber einfaches Schauspielhaus. Für die ganze Anstalt müsste ein geschickter Arzt als Oberaufseher, für jedes Hauptgebäude ein Wirtschaftsverwalter vorhanden sein. Die Umgebungen könnten, wenn der Natur auch nur einigermassen nachgeholfen würde, in die reizendsten Anlagen verwandelt werden.
Die reichhaltigen Quellen des rechten, mit dem linken durch eine Brücke verbundenen Ufers würde ich ausschliessend wohltätigen Zwecken widmen. Dort sollte in Form eines grossen Hospitals ein weitläufiges Gebäude aufgeführt werden nebst geräumigen Bädern, jedes zu 30 bis 40 Personen, wo beide Geschlechter voneinander getrennt baden, schröpfen und ihre Kur unter der Aufsicht eines vom Oberarzt abhängigen Chirurgen gebrauchen könnten. Hier müssten alle Armen und Kranken unentgeltlich verpflegt werden.
Doch, was nützt es, dergleichen nur auszusprechen? Wie und woher sollten sich die zu einer solchen Unternehmung erforderlichen Summen zusammenbringen lassen? Unsere Vorfahren zeichneten sich durch milde grosse Stiftungen auf Jahrhunderte aus und pflanzten Linden, deren Schatten den spätesten Enkeln zugutekommen. Wir werfen den Armen einen Kreuzer in den durchlöcherten Hut, nehmen hochgepriesenen Teil an wohltätigen Subskriptionen, deren Ertrag auf das Bedürfnis des Augenblicks verwendet wird, und pflanzen Akazien, die vor unserem Tod verdorren. Die Welt ist nicht zu ändern, und mein Plan für Baden wird ewig ein frommer Wunsch, eine müssige Träumerei bleiben.
So wollen wir denn froh sein, dass wenigstens Herr Egloff nach dem Verhältnis seiner Kräfte etwas Besseres als das bisher Bestandene aufgestellt hat.
Und nun, da wir nach einem langen kritischen Spaziergang durch alle Bäder und Anstalten endlich spät und müde wieder in unserem Hinterhof angelangt sind, wollen wir uns auskleiden, auf unsere Betten hinlegen, und unter den Schreck- und Finsteraarhörnern unserer Federdecken so sanft als möglich dem kommenden Tag, mit welchem unser Badleben eigentlich erst beginnen wird, entgegenschlummern.
DIE TAGWACHE
In Pyrmont wird der Kurgast alle Morgen von einer Oboistengesellschaft aufgeweckt, welche ihn am Eingang der Allee mit lieblichen Harmonien zur sprudelnden Quelle ruft. Hier ist es anders. Der Gänsejunge öffnet früh das kleine Tor, das auf die Matte geht, und dann unter dem Fälklein die Ställe des Federviehs. Als ob das Capitol in Gefahr wäre, drängen sich einige Hundert Gänse und Enten hervor, erheben sämtlich ihre Stimmen und verbreiten sich auf dem Platz mit gellendem Geschnatter. Das ist die Tagwache, welche den Morgenschlaf aus dem Hinterhof verbannt. Nachdem die verschiedenen alten und jungen Familien aus dem Geschlecht der gelben Breitschnäbel einander weitläufig begrüsst, gemustert und auf dem Hofe sich gehörig umgesehen, ob aus dem Kehricht kein Stoff zur Unterhaltung aufzuschnobbern sei, so watschelt die gesprächige Gesellschaft früher oder später, je nachdem die Ausbeute reichhaltiger oder kärglicher ist, gegen das Tor, begibt sich auf die Matte und sucht dort Zeitvertreib und Nahrung im Grünen. Diese Szene ist eine Art von Prolog zu dem Schauspiel, welches gewöhnlich einige Stunden später an der nämlichen Stelle von ehrbaren Frau Basen und Muhmen aufgeführt wird. Wer auch durch diese Gänsesymphonie aus dem Schlafe geweckt, sich demselben noch gern auf eine Weile hingeben möchte, der wird durch die Bäckerinnen, welche mit Tagesanbruch aus dem Städtchen herabkommen, alle Türen bestürmen und ihre Eierweggen, ihre Rahmpastetchen, die beliebten Chräbeli und besonders die hochgefeierten Spanischbrötchen mit Ungestüm feilbieten, alle Augenblicke wieder wach gepocht. Wo nicht gleich Antwort gegeben wird und die Türe nicht abgeschlossen ist, treten diese Weibsleute mit ihren gepuderten Haaren, deren Geflecht hinten mit silbernen Nadeln in Gestalt eines Löffels aufgeheftet ist (wenn sie nicht etwa schon das Nationalkostüm der neueren Mode geopfert haben), ohne Umstände ins Zimmer, preisen ihre Ware an und lassen sich nur mit Not abweisen. So wird auch der Langschläfer früh genug auf und ins Bad getrieben; ein Zeitgewinn, dessen er sich den ganzen Vormittag zu erfreuen hat.
DAS BAD
Ich möchte jedem, der sich am frühen Morgen ins Bad begeben will, die bequeme Kleidung empfehlen, deren ich mich seit Jahren zu diesem Behuf bediene. Sie hält warm, ist in einem Augenblick an- und ausgezogen und besteht einzig in einem Kamisol von feinem englischen Flanell für den blossen Leib, einem weiten Strumpfpantalon von dichterem Flanell und einem Schlafrock von ähnlichem Stoff mit weiten Ärmeln, der vermittelst eines hinten befestigten Gürtels vorn mit einem Knopf geschlossen werden kann und einen aufstehenden Kragen hat, der unter dem Kinn eingeknöpft wird. Bei dieser aus nicht mehr als drei Stücken bestehenden Kleidung braucht man weder Hemd noch Strümpfe noch Unterhosen noch Halstuch mitzunehmen, was alles sonst im Badgewölbe herumhängen und nur mühsam wieder angezogen werden müsste. Nach dem Bad ist es auch besser, in lauter Wolle eingewickelt zu sein, deren sanftes Reiben besonders wohltätig auf die Haut wirkt. Den Frauenzimmern würde ich eine ähnliche Bekleidung anraten, wenn sie sich über dergleichen ins Toilettenfach einschlagenden Gegenstände etwas vorschreiben liessen.

Das Fälklein im Hinterhof.
So gegen die kühle Morgenluft geschützt, schlüpft man hinab ins Badgewölbe, in welchem selbst man sich unmöglich erkälten kann, weil da die Luft vom Dunst des Wassers immer angenehm erwärmt ist.
Dem Badwäscher ist deswegen zu empfehlen, dass er die Fenster nur so lange offen lasse, bis die Luft erneuert ist, welches über die Zeit geschehen kann, wo er das Bad bereitet, und da dieses wohl auf der Stelle wärmer, aber nicht kälter gemacht werden kann, wenn man nicht gewöhnliches Wasser aus der Limmat beimischen will, so muss es sechs bis acht Stunden, ehe man sich desselben bedienen will, gefüllt sein, und sich bis auf etwa 23 Grad Réaumur durch Verdunstung abkühlen können.
Ob das Bad in der Zwischenzeit von keinem ungebetenen Gast gebraucht worden, lässt sich an einem dünnen Häutchen erkennen, welches vermutlich von der Einwirkung der atmosphärischen Luft auf das Wasser gebildet, auf dessen Oberfläche schwimmt und von der leisesten Berührung verletzt wird. Es sieht demjenigen ähnlich, welches auf dem künstlichen Kalkwasser entsteht, wenn dieses einige Zeit der Luft ausgesetzt war, und mag einige äusserst feine Schwefelblumenteilchen enthalten.
Da man bei verschiedener Lufttemperatur den Wärmegrad des Wassers unmöglich durch das blosse Gefühl bestimmen kann, so ist es nötig, ein Badethermometer bei sich zu haben, das man während des Auskleidens ins Wasser senkt und so viel warmes aus der Röhre nachlaufen lässt, bis die Wärme auf den Grad, dessen man bedarf, gesteigert ist. Vermittelst dieser Massregel kann man sicher sein, immer in der gleichen Temperatur zu baden.
Auf den Thermometern nach Réaumur ist der 25. Grad für die Bäder bezeichnet. Allein nicht alle solche Instrumente sind gehörig reguliert, und die Körperwärme der Menschen ist sehr verschieden. Das beste Regulativ für jeden möchte folgendes sein: Man stecke das Thermometer in einem Augenblick, wo man weder erhitzt ist noch friert, unter die Achselhöhle auf den blossen Leib und knöpfe die Kleider wieder zu; nach Verfluss von höchstens fünf Minuten wird der Weingeist oder das Quecksilber genau die Blutwärme dessen bezeichnen, der sich das Thermometer anpasste. Man merke sich bestimmt und ein für allemal den Grad und bade immer in dieser Temperatur, wenn der Arzt nicht verordnet hat, dass man wärmer oder kälter als der Blutgrad baden soll.
Bauern und viele andere unberatene Leute wähnen, nie warm genug baden zu können, je heisser das Wasser, desto kräftiger glauben sie, sei es. Dies ist aber gar nicht der Fall und wer im Bade geschwitzt und sich rotgebrüht hat, wird Kopfschmerzen und Schwindel bekommen, sich geschwächt fühlen und, zumal bei kühler Luft, sich im Freien bald erkälten. Ob man nur bis an die Brust oder bis ans Kinn im Wasser sitzen müsse, darüber herrschen verschiedene Meinungen. Salomon Hottinger sagte drollig genug und Scheuchzer hat es ihm nachgeschrieben: «Dass der Nabel so viel als der Marchstein, wie des Menschen unteren und oberen Leibs, also auch des Sitzens in dem Bad sei.» Wer indes keine schwache Brust hat und überhaupt keine Unbequemlichkeit davon spürt, tut meines Erachtens wohl daran, wenn er das heilsame Element so viel als möglich auf die ganze Oberfläche seines Körpers wirken lässt.
Wer nach des Arztes Verordnung durch längeres Baden den so manchen Krankheitsstoff durch die Poren ausführenden, oft äusserst wohltätigen Ausschlag bekommen soll, fängt mit zwei Stunden vormittags und einer des Abends an, steigt bis auf fünf Stunden im Tag, und wenn der Ausschlag sich gehörig gebildet hat, so badet man denselben, die Stundenzahl allmählich vermindernd, wieder weg, welches alles in 21 Tagen möglich ist. Viel Bewegung im Freien und an der Sonne fördert diese Krisis; allein man soll sich dabei sorgfältig vor jeder Erkältung hüten, welche den Ausschlag immer richtig wieder zurücktreibt und schwerere Krankheiten verursachen kann, als die war, wegen der man ins Bad kam.
Wer es hingegen zu keinem Ausschlag soll kommen lassen, darf nicht länger als vormittags eine ganze und abends eine halbe Stunde im Bade verweilen.
Auf keinen Fall darf der Badende sich im Wasser dem Schlaf überlassen. Alle Ärzte raten das wohlmeinend und schon vor drei Jahrhunderten schrieb Alexander Sytz: «Man soll allenthalben im Bad etwas Kurzweil haben mit Fabulieren und dergleichen, um damit dem Schlaf zuvorzukommen, denn der Schlaf zieht die Geister hinein und das Bad heraus.»
Die meisten Kurgäste gebrauchen das zweite Bad nachmittags um vier oder fünf Uhr und gehen dann wieder aus und dem Vergnügen nach. Manche setzen sich, nur um bald fertig zu sein, gleich nach dem Essen ins Wasser, was aber höchst schädlich ist, weil die Verdauung dadurch gestört und das Blut nach dem Kopf getrieben wird. Ich habe mich immer am besten dabei befunden, wenn ich erst abends nach vollbrachtem mässigem Spaziergang noch ein halbes Stündchen in der Dämmerung badete. Dann hatte ich mich zu keinem Ausgang mehr anzukleiden, lief nicht Gefahr, mich an der Nachtluft zu erkälten und legte mich, vom Bad angenehm abgekühlt, nach einer leichten Nachtsuppe früh zu Bett. Die Stille beim matten Schimmer einer Kerze hat etwas Trauliches im tiefen Badgewölbe, und nicht selten erhebt darin das einsame Heimchen seine zirpende Stimme.
Aber auch zu jeder anderen Tageszeit ist es eine wahre Wollust, sich hier zu baden. Man befindet sich kaum ein paar Minuten im Wasser, so empfindet man eine sanfte Abspannung, eine unbeschreibliche Behaglichkeit und kann sich frei und bequem in dem weiten Raum herumbewegen.
Zwar sind hier die in den Boden eingesenkten Bäder weder mit Marmor noch mit Zinn oder Porzellan wie in Pyrmont, sondern lediglich mit Holz ausgefüttert und haben ringsumher etwa fusshohe Bänke; dagegen aber sind die meisten derselben und besonders die älteren so tief und weit, dass eine ganze Familie darin Platz findet. Die Kinder überlassen sich in diesen Wassern meist einer ausgelassenen Freude. Sie jubeln, kreischen, spritzen einander, tauchen unter und schwimmen, ihre Schiffchen vor sich herschiebend wie Fische in dem Behälter herum. Oder wenn sie allmählich ruhiger werden, bilden sie mit den Badhemden grosse Blasen, drücken diese aus und treiben allerlei mutwilliges Spiel.
Was enthält aber dieses herrliche Wasser? Welche Wunderkraft ist ihm gegeben, so mancherlei Elend zu mildern, so viele Krankheiten zu heilen? Seitdem Herr Morell im Jahr 1788 seine Analyse desselben bekannt werden liess, sind bedeutende Fortschritte in der Chemie und besonders in der Wasserscheidekunst gemacht worden. Herr Bauhof, Direktor einer Vitriolölfabrik in Aarau, ein ausgezeichneter Chemiker, hat kürzlich eine neue Analyse vorgenommen, aus welcher sich folgendes Resultat ergab:15
Temperatur der Quelle 37 Grad über Null, Réaumur Eigentümliche Bestandteile in 300 Unzen Wasser (ungefähr 6 Mass)
48 Kubikzoll kohlensaures Gas Schwefel-Wasserstoff-Gas in geringer, unbestimmter Quantität
233 Gran schwefelsaurer Kalk (Gips)
186 Gran salzsaures Natrum (Kochsalz)
51 Gran salzsaure Bittererde
48 Gran schwefelsaures Natrum (Glaubersalz)
36 Gran kohlensaurer Kalk
31 Gran schwefelsaure Bittererde (Bittersalz)
11 Gran kohlensaure Bittererde (Magnesia)
5 Gran Extraktiv-Stoff
1 Gran Eisenoxyd
Bestandteile des Selenits oder Badsteins
In tausend Teilen desselben:
790 kohlensaurer Kalk
117 schwefelsaurer Kalk
51 kohlensaure Bittererde
2 salzsaure Bittererde
3 Eisenoxyd
37 Wasser und etwas Extraktiv-Stoff
Diese Analyse erwähnt keinen in konkreter Gestalt vorgefundenen Alaun, womit doch zuweilen die Mündungen der Teichel überzogen sind. Herr J. J. Irniger, Kantons-Apotheker in Zürich, ein trefflicher Chemiker, hat eine solche von einer Wasserröhre in den Kleinen Bädern abgebrochene Kruste mit heimgenommen, welche sich bei chemischer Prüfung als reiner Alaun bewährte. Der Kern des Badsteins unter den Ablassrinnen hinter dem Raben könnte vielleicht darüber einige Resultate liefern, wenn einer dieser jahrhundertealten Stalaktiten zu diesem Behuf zerschlagen und genau untersucht würde.16 In Hinsicht auf die Temperatur der Quellen scheint Herr Bauhof einen Mittelschlag angenommen zu haben, indem er dieselben im Allgemeinen auf 37 Grad über Null nach Réaumur bestimmt. Allein wenigstens vier Quellen sind um einen ganzen Grad wärmer, nämlich die unter dem grossen heissen Stein, die unter dem kleineren daneben, die Verenaquelle und die auf dem rechten Limmatufer. Diese allein treiben den Weingeist oder das Quecksilber auf 38 Grad, wovon ich mich selbst überzeugte, indem ich den Beobachtungen meines verewigten Freundes, Herrn Doktor Zwingli, beiwohnte, welcher die sorgfältigsten Untersuchungen mit drei verschiedenen Thermometern darüber anstellte. Die Wärme der übrigen Quellen ist von ihm nicht gemessen worden.
Herr Doktor Dorer hat also in seiner Beschreibung der Bäder von Baden, worin derselbe der eigenen Quelle des Hinterhofs und derjenigen unter dem vorderen heissen Stein 125 Grad, der Verenaquelle sogar 127 Grad nach Fahrenheit zuschreibt, dagegen die Temperatur der Quelle in den Kleinen Bädern auf 115 Grad herabsetzt, sich ganz bestimmt geirrt, was zumal mit mangelhaften Instrumenten sehr leicht geschehen kann. 127 Grad Fahrenheit betragen ungefähr so viel als 42 Grad Réaumur, und so warm ist nicht einmal die Hauptquelle in Leuk; 115 Grad Fahrenheit sind nicht völlig 37 Grad Réaumur, und dass die Hauptquelle in den Kleinen Bädern eine Wärme von vollen 38 Grad habe, ist durch obenerwähnte Prüfung unumstösslich erwiesen. Johann Jakob Scheuchzer hat im Jahre 1730 seine Untersuchungen dieses Wassers an allen Quellen und mit jeder besonders vorgenommen; allein die neueren Chemiker, welche uns Beschreibungen desselben lieferten, scheinen anzunehmen, dass alle Quellen die nämlichen Bestandteile in gleichen Verhältnissen enthalten, weil sie nicht sagen, aus welcher derselben sie das Wasser, das sie untersuchten, genommen haben und doch kann nicht bezweifelt werden, dass zum Beispiel die Quelle unter dem grossen heissen und diejenige unter dem daneben liegenden kleineren Stein von verschiedenem Gehalt sein müssen. Beim jährlichen Ausreinigen der Leitungen findet man in dem Teiche, der das Wasser aus der Quelle unter dem kleineren Stein in das Freibad führt, immer gegen zwei Pfund wirklichen, schön brennenden Schwefel, indes man diesen in den Teicheln, welche das Wasser aus der Quelle unter dem grossen heissen Stein in verschiedene Bäder leiten, gar nicht oder doch nur in geringem Masse vorfindet. Dagegen scheint in dieser letzteren die Schwefelleberluft im Verhältnis zu jener vorzuherrschen. Es würde sich also der Mühe lohnen, jede Hauptquelle besonders zu analysieren, damit der Arzt jedem Kranken bestimmt diejenige empfehlen könnte, welche ihm am besten dienen wird.