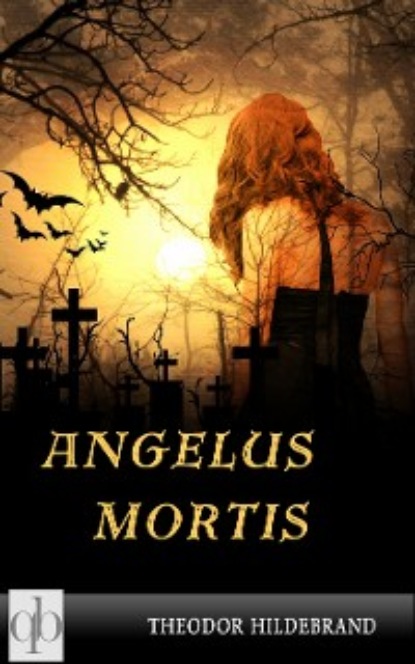- -
- 100%
- +
Derart mit sich selbst beschäftigt, hatte er das Näherkommen der jungen Dame gar nicht bemerkt, sodass er plötzlich jäh durch eine ihm wohlbekannte Stimme, die aber in diesem Augenblick etwas so Dumpfes und Feierliches hatte, dass er sich davon bis ins Innerste ergriffen fühlte, aus seinen Gedanken gerissen wurde.
»Nun Werner«, sprach sie ihn an, »was habe ich dir getan, dass du stets gegen mich bist? Wirst du deine ungerechte Abneigung gegen mich denn niemals ablegen?«
Aufs Äußerste überrascht durch diese Worte, schlug der Soldat die Augen auf, entfernte sich von dem Baum, an dem er gelehnt hatte, und schien wenig geneigt, ihr zu antworten. Doch er überwand sich und sagte:
»Was wollen Sie von mir, Lodoiska? Warum haben Sie ihr Vaterland verlassen? Was suchen Sie hier in Deutschland? Ist die Zeit denn spurlos an ihnen vorübergegangen? Sollten sie tatsächlich noch immer das gleiche Ziel wie in ihren Jugendjahren verfolgen? Dann bedauere ich sie oder vielmehr beklage ich ihren Wahnsinn.«
»Die Zeit«, antwortete die Fremde in dem feierlichsten Ton, »vermag mir jetzt nichts mehr anzuhaben; es gibt ein Leben, in dem sie keine Macht mehr besitzt und die Empfindungen unveränderlich werden wie die Ewigkeit, von der sie ein Teil sind. Wundere dich nicht über meine Gegenwart, denn nicht mein Wille ist es, der mich leitet; ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern einem grausamen, gebieterischen Herrn, der mir jeden meiner Schritte vorzeichnet. Meine alte Wunde blutet noch und die Zeit, wie du sie nennst, hat das Recht verloren, sie zu vernarben.«
»Warum aber«, erwiderte Werner, »sich mit unnützen Hoffnungen quälen? Zwischen ihnen und dem Oberst ist alles vorbei. Er hat vielleicht ein Unrecht gegen sie begangen, aber er darf daran nicht mehr denken. Schon seit mehreren Jahren ist er der Gatte einer Frau, die seine Liebe verdient. Wollen sie etwa seine häusliche Ruhe stören? Treibt die Rache sie so weit, dass sie das Herz seiner Gemahlin zerreißen könnten?«
»Durfte er sich denn verheiraten, Werner? Gehörte dein Herr nur sich selbst, dass er sich so frei hinzugeben vermochte? Hat er nicht mit seinem eigenen Blut das Versprechen unterschrieben, nur mit mir vor den Altar zu treten? Weißt du das alles nicht mehr, du, der du so dreist von der Vergangenheit sprichst, die den Treulosen vernichten wird? War ich weniger schön als deine jetzige Gebieterin oder gar weniger tugendhaft? Was habe ich Unrechtes getan? Etwa, weil ich Liebe für Liebe gab und mich gänzlich einem Gefühl überließ, das ich für aufrichtig hielt? Habe ich mein Versprechen zurückgenommen, das auch ich mit meinem Blut unterschrieben habe? Liegt es nicht immer noch in Alfreds Händen, und kann er vor Gott der rechtmäßige Gatte einer anderen sein? Was habe ich Unrechtes getan? Er kann mir keine Vorwürfe machen, während ich ihn durch die Menge der meinen zu Boden schlagen könnte!«
Während die schöne Fremde so sprach, schien sie der Erde gar nicht mehr anzugehören; ihre hohe und schlanke Gestalt, der unstet umherschweifende Blick, die in ihren Gesichtszügen deutlich sichtbaren Anzeichen des Unwillens, die ihrem Mund einen furchtbaren Ausdruck gaben, all dies ließ sie wie ein überirdisches Wesen erscheinen. Werner war nicht imstande, dem Blick ihres forschenden Auges standzuhalten, das seine Gedanken bis in die innersten Falten seines Herzens zu verfolgen schien. Insgeheim musste er zugeben, dass sein Herr ihr Unrecht getan hatte; aber es war auf keine Weise wiedergutzumachen und Lodoiska musste, trotz der Rechtmäßigkeit ihrer Ansprüche, auf die Einlösung des Versprechens verzichten. Dies versuchte er, ihr in seiner Antwort begreiflich zu machen.
Die Fremde hörte ihm mit einem verächtlichen Lächeln zu, ohne ein Anzeichen von Erstaunen oder Unzufriedenheit zu zeigen. Schon gab er sich der Hoffnung hin, sie überzeugt zu haben, und wollte gerade ansetzen, seinen Sieg zu vollenden, als sie plötzlich ihre rechte Hand auf seine Schulter legte. Diese mit einer Art von Nachlässigkeit ausgeführte Bewegung brachte in ihm eine geradezu außerordentliche Wirkung hervor. Dort, wo Lodoiskas Hand seine Schulter berührt hatte, verspürte er plötzlich ein ganz seltsames Gefühl, und es schien ihm, als wenn er auf einem glühenden Ofen säße und gleichzeitig mitten in ein Meer von Eis geschleudert würde; dieses Gefühl verlor sich aber sogleich wieder, nachdem die Hand, die es ausgelöst hatte, zurückgezogen wurde.
»Habe ich ihn von seinem Versprechen entbunden?«, fragte Lodoiska ruhig, ohne auf die Gründe einzugehen, die ihr Werner soeben dargelegt hatte. »Besitzt er unseren schriftlichen Vertrag noch?«
»Es ist ganz gleich, ob er ihn noch hat oder nicht, es kommt ja doch nicht mehr darauf an; mag er in seinen Händen sein oder in den ihren, wozu könnte er noch dienen? Die Gerichte werden ohnehin keine Rücksicht darauf nehmen.«
»Es ist gut möglich, leichtsinniger Soldat, dass die menschlichen Gesetze gegen diese Art von Meineid nichts vermögen; aber in der jenseitigen Welt gibt es einen unbestechlichen Richter. Und dieser war Zeuge des Versprechens; an ihn habe ich mich gewandt, um Gerechtigkeit zu erlangen, und ich bin mir sicher, diese auch zu erhalten.«
»Nun ja, Lodoiska«, erwiderte Werner lächelnd, »da werden sie wohl noch lange warten müssen, bis das Urteil, von dem sie sprechen, vollzogen wird. Glauben sie mir, es wäre am besten für sie, wenn sie in ihr Vaterland zurückkehrten und dort ruhig bei ihrer Familie lebten. Seien sie überzeugt, dass der Oberst nicht zögern wird, ihnen durch ein anständiges Jahresgehalt eine ruhige und sorglose Zukunft zu ermöglichen.«
»Das steht nicht mehr in seiner Macht«, antwortete die Fremde in einem noch feierlicheren Ton als bisher. »Ich habe keine Familie mehr, die ganze Erde ist nun mein Vaterland, und der Mittel, die du mir in Alfreds Namen versprichst, bedarf ich nicht. Das Geld ist in meinen Augen verächtlich und ich besitze es im Überfluss. Wenn du mir versicherst, deinem Herrn nicht zu melden, dass ich hier bin, verspreche ich dir mehr Reichtümer, als du dir wünschen kannst. Hier«, fuhr sie fort, eine sehr große gefüllte Geldbörse hervorziehend, »nimm dies als Anzahlung darauf, was du noch in Zukunft von mir erhalten sollst.«
Die seltsamen Worte Lodoiskas machten das Erstaunen des alten Soldaten vollkommen. Er wusste, dass sie, die Tochter eines moldauischen Bauern, nicht reich war, und jetzt gab sie ihm den Beweis des Gegenteils. Dies trug keineswegs dazu bei, sein Misstrauen ihr gegenüber zu verringern, und so war es wenig verwunderlich, dass es der Fremden nicht gelang, ihn mit ihrem Angebot zu verführen.
»Auch ich, Lodoiska«, sagte Werner, »bin über meine Bedürfnisse erhaben. Dennoch danke ich ihnen für ihr großmütiges Angebot; doch es könnte mich nicht reizen, selbst wenn ich die Absicht hätte, dem Oberst zu schreiben, dass sie hier sind.«
»Lügner!«, antwortete Lodoiska lebhaft. »Du hast sie, diese Absicht, und du hast schon versucht, sie auszuführen.«
Diese zuversichtliche Behauptung, die für ihn einer Beleidigung gleichkam und für die eine männliche Person mit ihrem Blut hätte bezahlen müssen, ließ den erstaunten Werner fast erstarren. Er wusste nicht, ob er seinem Zorn freien Lauf lassen sollte oder ob es nicht besser wäre, ihn zu unterdrücken; doch die Heftigkeit seines Charakters riss ihn mit fort und er rief voller Unwillen:
»Danken sie es ihrer weiblichen Kleidung, die sie vor meiner augenblicklichen Rache schützt! Aber welchen Titel verdienen sie wohl, unvorsichtiges Weib, die sie sich erdreisten, heimlich in fremde Häuser einzudringen und die Handlungen ihrer Bewohner auszuspionieren? Sie stehen früh genug auf, wie es scheint; aber seien sie sicher, dass sie so bald nicht wieder ohne mein Wissen ins Schloss eindringen werden.«
Ein Lächeln, das Werner nicht zu deuten vermochte, war Lodoiskas ganze Antwort darauf. Dann aber nahm sie plötzlich eine würdevolle Miene an und sagte:
»Bedenke, Werner, dass du tätigen Anteil an meinem Unglück gehabt hast; ich warne dich jetzt, nicht blind in den Abgrund des Verderbens zu rennen. Glaube mir, es wird am besten für dich sein, unparteiisch bei dem Kampf zu bleiben, der sich bald erheben kann; dies ist der einzige Weg für dich, dem nahenden Ungewitter zu entgehen.«
Bei diesen Worten sprühten ihre Augen wie Feuer. Und ohne noch den Stimmen der beiden Kinder Beachtung zu schenken, die, ihrer Spiele müde, sich näherten, um mit ihr zu plaudern, machte sie gegen Werner eine fürchterlich drohende Gebärde und ging mit schnellen Schritten auf einen schmalen Fußweg zu, der sie schon bald den Blicken entzog. Werner stand wie unbeweglich da und war in tiefes Nachdenken über das Unglück versunken, das er schon mit Gewissheit heraufziehen sah, als er plötzlich durch Wilhelm aus seiner Träumerei geweckt wurde.
»Werner, hörst du den Donner nicht, der dort aus der schwarzen Wolke herüberrollt? Sieh doch, welch schöne Blitze! Es wird gewiss ein Gewitter geben.«
»Ein Gewitter?«, rief Werner erstaunt. Sollte ihre Prophezeiung schon so schnell in Erfüllung gehen? — Er erblickte nun ebenfalls die heranziehenden schwarzen Wolken, aus denen sich immer häufiger Blitze entluden, und da die Vorsicht nicht erlaubte, den Spaziergang noch weiter fortzusetzen, nahm er seine beiden jungen Freunde an die Hand und kehrte auf dem kürzesten Weg mit ihnen zum Schloss zurück.
Fünftes Kapitel
Helene, die bereits von ihrem Fenster aus gesehen hatte, dass ein Gewitter heraufzog, war schon in großer Sorge darüber, dass ihre Kinder noch nicht zurück waren. Voller Ungeduld verließ sie daher das Schloss, um ihnen entgegenzugehen; doch sie war noch gar nicht weit gekommen, als sie auch schon das laute Lachen der kleinen, übermütigen Julie hörte, und bald darauf sah sie die teuren Wesen auf sich zulaufen. Die Kinder sprachen von nichts anderem als von der schönen Dame und von den Geschenken, die sie ihnen gemacht hatte. Helene war viel zu sehr Mutter, um nicht gleich ein günstiges Urteil über die Person zu fällen, die ihren teuren Kindern eine solche Freude machte. Mit Spannung erkundigte sie sich, was die Fremde gesagt hatte.
»Oh, diesmal«, antwortete das kleine Mädchen, »hat sie nicht lange mit uns geplaudert. Sie sprach die ganze Zeit nur mit Werner, den sie am Ende voller Wut verließ.«
Diese wenigen Worte des Kindes stürzten alle Pläne über den Haufen, die der Unteroffizier sich unterwegs schon zurechtgelegt hatte. Er wusste, dass die Oberstin ihm nicht glauben würde, wenn er der kleinen Julie widerspräche; doch ein Entschluss musste gefasst werden, und obwohl er es verabscheute zu lügen, wartete er nicht erst ab, bis Helene ihn fragte, sondern tischte ihr, gleich nachdem sie die Kinder durch einen Wink fortgeschickt hatte, folgende Geschichte auf:
»Frau Oberstin, ich hatte vollkommen recht damit, der Unbekannten nicht zu trauen. Glauben sie mir, dass sie ihren Aufenthalt hier in R… nicht ohne gefährliche Absichten gewählt hat. Eine ganze Stunde lang hat sie mich mit Fragen über ihre Familie und die gesamte Nachbarschaft gepeinigt. Sie wollte alles wissen, das Alter, den Rang, die Beschäftigung eines jeden, und sie wurde gar nicht müde in ihren Versuchen, mich auszufragen. Anfangs versuchte ich, ihren unverschämten Fragen mit Höflichkeit auszuweichen, aber sie hielt sich noch nicht für besiegt und kehrte zum Angriff zurück. Eine Frage folgte auf die andere, gleichsam wie ein ununterbrochenes Heckfeuer, sodass ich der Sache schließlich überdrüssig wurde. Ich nahm meine Truppen zusammen und rückte ihr mit gefälltem Bajonett auf den Leib, sodass ich ihr eine völlige Niederlage beibrachte. Mein Widerstand rief eine solche Bestürzung bei ihr hervor, dass sie in höchst übler Laune ihren Rückzug antrat.«
Diese mit militärischen Ausdrücken vermischte Rede rang der Oberstin ein Lächeln ab. Die Fragen der Fremden schienen ihr gar nicht so unverschämt, wie Werner sie darstellte; sie hielt es für ganz natürlich, sich nach den Familien der Gegend, in der man sich niedergelassen hatte, zu erkundigen.
»Ich hoffe, mein lieber Werner, dass deine Antworten nicht beleidigend gewesen sind; man muss Achtung vor den Damen haben und gerade ein Soldat sollte im Umgang mit dem schwachen Geschlecht ein zuvorkommendes Verhalten an den Tag legen.«
»Das mag für unsere Herren Offiziere gelten«, erwiderte Werner; »aber wir, die wir nicht deren Vorrechte genießen, brauchen auch nicht ihre Höflichkeiten nachzuahmen.«
Mit diesen Worten, die er absichtlich etwas hart aussprach, entfernte sich der alte Soldat und Helene kehrte nun zu ihren Kindern zurück, während das Gewitter immer näher kam und der Regen schon in Strömen niederfiel. Helene fürchtete das Rollen des Donners so wenig wie ihre Kinder; aber Lisette und Marie waren in größter Angst. Sie eilten zu ihrer Herrin, um bei ihr Schutz zu suchen, den sie ihnen auch nicht verweigerte. Da Werner unterdessen ungestört sein konnte, begab er sich auf sein Zimmer, und trotz eines unwillkürlichen Schauders, der sich mehrmals in seinem Innern erhob, setzte er sich an seinen Schreibtisch, um ein zweites Mal an seinen Herrn zu schreiben.
Das Gewitter wurde immer heftiger und die Winde kämpften so fürchterlich miteinander, dass sie in ihrer Wut das Schloss in seinen Grundfesten zu erschüttern drohten. Von Zeit zu Zeit erschien es Werner sogar, als ob sich klagende Stimmen unter das Rollen des Donners und das Heulen des Sturmes mischten; ja, er hörte Worte, deren Ton seinem Ohr nicht unbekannt war. Mehrere Male hörte er unwillkürlich auf zu schreiben; dann aber, voller Scham über seine Schwäche, sammelte er seine Gedanken wieder und zur Stunde des Abendessens war sein Brief an den Oberst fertig.
Da er sein Schreiben nicht abermals den Versuchen Lodoiskas aussetzen wollte, schloss er es in einen Kasten ein und legte diesen in seinen Kleiderschrank. Von beiden nahm er die Schlüssel an sich und verließ dann ruhig sein Zimmer, überzeugt davon, dass sein Geheimnis nun in Sicherheit war.
Draußen tobte noch immer das Unwetter und Lisette wie auch Marie waren schon fast tot vor Angst. Die Kinder, des Wartens auf das Abendessen müde, schliefen auf einem Sofa, und Helene las in einem guten Buch. Werners Eintritt in das Zimmer belebte die beiden Mädchen wieder, die sich nun entschlossen, zu ihren jeweiligen Verrichtungen zurückzukehren, und bald darauf wurde auch das verspätete Abendessen aufgetragen.
Erst gegen Mitternacht wurde der Himmel wieder heiterer und nach und nach beruhigte sich die Natur. Werner hatte dem Unwetter mit heimlichem Vergnügen zugesehen, denn er wusste, dass es bei solchen Regenmengen mehrere Tage lang unmöglich sein würde, spazieren zu gehen; und er hoffte, dass während dieser Zeit irgendein Umstand eintreten möge, der die neue Bekanntschaft zwischen den Kindern und Lodoiska beenden würde; ja, er schmeichelte sich, dass die Antwort des Obersts auf seinen Brief dem ganzen Leben der Familie eine andere Richtung geben könnte.
Mit diesen Gedanken beschäftigt, die ihm keine Ruhe ließen, schlief der brave Soldat nur wenig. Der neue Tag war noch nicht angebrochen, als Werner schon wieder auf den Beinen war. Er nahm seine Schlüssel und öffnete den Schrank und den Kasten, um den Brief herauszunehmen, den er unverzüglich nach Prag auf die Post senden wollte. Er fand ihn tastend und steckte ihn in seine Tasche, ohne einen Blick darauf zu werfen, da es ohnehin noch dunkel war; hierauf ging er hinunter in den Hof, um den Knecht zu rufen, der ihm als Bote dienen sollte.
Ehe er ihn fand, verging einige Zeit, und die heraufsteigende Morgenröte erhellte bereits die Erde ringsumher, als er den alten Peter damit beauftragte, sich sogleich auf den Weg zur Stadt zu machen, um einen höchst eiligen Brief auf die Post zu bringen. Während er mit ihm sprach, zog er den Brief aus der Tasche und warf noch zufällig einen Blick darauf, ehe er ihn übergab. Doch was er nun sah, machte ihn schier fassungslos … denn das Papier war mit großen Blutstropfen befleckt, sodass nicht einmal mehr die Aufschrift zu entziffern war! —
Unwillkürlich presste sich ein Schrei aus der Kehle des zutiefst erschrockenen Soldaten. Er glaubte, seinen Augen nicht zu trauen; unbeweglich stand er da, den Brief zwischen den Fingern hin- und herdrehend, ohne noch immer zu begreifen, was er in den Händen hielt. Dann kehrte er schnell seine Tasche um, aber sie war völlig rein, ohne auch nur die geringste Spur von Blut aufzuweisen. Hastig eilte er ins Schloss zurück auf sein Zimmer, um den Kasten zu untersuchen, in dem der Brief gelegen hatte; aber auch hier fand sich nichts, was das Papier beschmutzt haben könnte. Wie erstarrt stand Werner nun in seinem Zimmer, ohne noch einen klaren Gedanken fassen zu können; doch schon bald erholte er sich wieder und ohne Zeitverlust schrieb er den Brief nun zum dritten Mal. Zwar kürzte er ihn ab, aber sein Inhalt war desto dringender, und sobald er fertig war, übergab er ihn dem Boten, den er zur größeren Sicherheit noch ein gutes Stück weit begleitete.
Werner besaß Mut, aber dennoch konnte er sich jetzt einer gewissen abergläubischen Furcht nicht erwehren. Mit der größten Unruhe erinnerte er sich an die Erzählungen, die er in Russland und vor allem in der Moldau und Walachei gehört hatte, als er sich mit seinem Regiment dort aufhielt; an die Sagen von Menschen, die ihre Seele dem Teufel verkauft hatten und dadurch eine übernatürliche Macht zum Schaden ihrer Mitmenschen erlangten. All jene Märchen fielen ihm jetzt wieder ein, und das, was er soeben erlebt hatte, verleitete ihn sogar zu dem Glauben, dass Lodoiska sich durch ein solches Bündnis eine ähnliche Macht verschafft haben könnte. Doch schon bald verwarf er diese Gedanken wieder. »Was für ein Tor ich doch bin«, sagte er zu sich selbst, »an solchen Unsinn zu glauben. In der Moldau und Walachei mag so etwas angehen, da dort ohnehin nur Barbaren wohnen; aber in Deutschland hat der Teufel schon lange sein Recht verloren oder es bloß den Taschenspielern überlassen; das sind die Einzigen, die bei uns noch für ihn arbeiten, und vielleicht ist Mamsell Lodoiska eine solch geschickte Taschenspielerin. Aber sie mag sich in Acht nehmen; denn es würde ihr übel ergehen, wenn ich sie einmal auf frischer Tat ertappen sollte.«
Nachdem er hierauf einer Flasche mit gutem alten Rum, die auf seinem Tisch stand, einen Besuch abgestattet hatte, vergrößerte sich sein Mut noch und er nahm sich vor, seine Wachsamkeit künftig zu verdoppeln, um herauszufinden, wodurch sich Lodoiskas Einfluss bis ins Schloss erstreckte. In der Hoffnung, recht bald vom Oberst Antwort zu erhalten, ging er dann wieder seinen gewöhnlichen Geschäften nach.
Die Einsamkeit, in der die Familie Lobenthal im Schloss R… lebte, ging indessen nicht so weit, dass sie nicht von Zeit zu Zeit durch einige Besuche unterbrochen worden wäre, welche die auf den umliegenden Gütern wohnenden Herrschaften im Schloss abstatteten. Sie wurden stets mit großer Höflichkeit und Gastfreundschaft empfangen und Helene sah sie sogar mit Vergnügen, besonders seitdem ihr Gatte abwesend war; denn sie bedurfte der Zerstreuung jetzt mehr als früher und fand sie im Umgang mit den Nachbarn. Daher war es auch nicht ungewöhnlich, als noch am selben Tag, nachmittags um zwei Uhr, ein alter Edelmann aus der Nachbarschaft im Schloss eintraf, der früher Oberjägermeister gewesen war, jetzt aber ruhig sein Feld bestellen ließ.
Herr von Krauthof war ein großer Esser und ein erprobter Trinker, der seine freie Zeit fast ausschließlich mit Besuchen zubrachte und dabei weder die Schlösser der Herrschaften noch die Häuser der Pächter verschmähte. Seine vorzüglichste Eigenschaft bestand darin, stundenlang nichts als Komplimente herzusagen; und nachdem er diesem wichtigen Ritual auch heute wieder beim Eintritt in Helenes Zimmer Genüge getan hatte, kam er endlich auf einen Gegenstand zu sprechen, der uns hier näher angeht.
»Nun, Frau Oberstin«, fuhr er im Fluss seiner Rede fort, »sie haben ja eine liebenswürdige Nachbarin bekommen. Ich sage: liebenswürdig, obgleich ich nicht recht weiß, warum; denn mich hat sie mit einer verzweifelten Strenge behandelt. Erst am vergangenen Dienstag erfuhr ich, dass sich hier in der Gegend eine fremde Dame niedergelassen hat, deren Schönheit allgemein gelobt wird; ich hielt es daher für meine Pflicht, ihr sogleich einen Besuch abzustatten, nicht zuletzt, um ihr einen guten Eindruck von unseren hiesigen Herren zu vermitteln. Gestern also begab ich mich zu dem Häuschen im Wald, meinen Regenschirm unter dem Arm, weil man dem Wetter derzeit ebenso wenig trauen kann wie den Menschen. Als ich ankam, war die Haustür verschlossen. Ich fand dies nicht ungewöhnlich, weil ja ein jeder in seinem Hause Herr sein will; ich klopfte daher an und man öffnete. Schon war ich im Begriff einzutreten, als ich plötzlich ein wahres Gespenst vor mir sah, das mir den Weg versperrte. Stellen sie sich den größten und zugleich den magersten aller Menschen vor: ein Gesicht wie ein Jesuit, Augen wie eine Eule und eine Miene, als wenn er eher ein Bewohner jener als dieser Welt wäre; eine raue und hohle Stimme, eine Manier wie ein Holzblock und einen völlig verpesteten Atem.
›Was wollen sie hier?‹, fragte er mich, ohne weiter irgendeine Höflichkeitsformel hinzuzusetzen.
Diese unartige Frage überraschte mich zwar ein wenig, da sich aber ein Edelmann aus altem Geschlecht so leicht nicht in Verlegenheit bringen lässt, so antwortete ich ihm:
›Ich bin ein Edelmann aus der Nachbarschaft, der deiner Herrschaft seine Hochachtung erweisen will und daher bei ihr vorgelassen werden möchte.‹ — Nach dieser artigen Rede hatte ich einiges Recht zu glauben, dass ich sogleich Zutritt bei der Dame erhalten würde; aber ich irrte mich gewaltig, wie sie gleich hören werden. Denn dieser neue Zerberus nahm auf meine Höflichkeit gar keine Rücksicht.
›Ich kann sie nicht einlassen‹, antwortete er mir, ›denn meine Herrschaft ist stets mit Geschäften überhäuft und hat keine Zeit, Besuche zu empfangen. Sie ist nicht hierhergekommen, um Gesellschaft zu suchen, und sie würden auch beim nächsten Mal vergebens hierherkommen.‹
So sprach der grobe Mensch, und ohne meine Antwort abzuwarten, trat er einen Schritt zurück und schlug mir mit heftigem Geräusch die Tür vor der Nase zu. Ich würde nicht imstande sein, ihnen meinen Ärger hierüber der Wahrheit gemäß zu schildern. Natürlich entfernte ich mich sogleich voller Verachtung von diesem ungastfreundlichen Haus und fasste den festen Vorsatz, alle meine Nachbarn vor einem gleichen Schicksal zu warnen, falls es ihnen etwa einfallen sollte, den hergebrachten Formen der Höflichkeit nachzukommen.«
Diese Erzählung belustigte Helene sehr; sie nahm sich jedoch vor, sich keinesfalls einer ähnlichen Ablehnung auszusetzen, so groß auch ihr Wunsch war, die geheimnisvolle Fremde kennenzulernen. Sie hoffte, ihr auf einem Spaziergang mit ihren Kindern zu begegnen; für jetzt tadelte sie aber hart die Unhöflichkeit des Bedienten, indem sie die Bemerkung machte, dass Herr von Krauthof ihm ohne Zweifel völlig unbekannt gewesen sein müsse; denn, setzte sie hinzu, hätte er gewusst, mit wem er die Ehre gehabt hatte, zu sprechen, würde er sich einer solchen Grobheit gewiss nicht schuldig gemacht haben.
Der ehemalige Oberjägermeister wurde durch dieses, aus einem so schönen Mund hervorgegangene Kompliment beinahe völlig für sein Missgeschick getröstet, und um es desto besser zu vergessen, beeilte er sich, eine andere Unterhaltung aufs Tapet zu bringen. Er fing an, von Politik zu sprechen. Helene wusste, dass man dem Strom seiner Rede bei diesem Thema freien Lauf lassen musste und er ganz entzückt diejenigen Häuser verließ, wo man ihn, ohne ihn zu unterbrechen, anhörte. Auch sprach er heute so ganz nach Herzenslust, der gute Mann! Ihm war nichts unbekannt, alle Geheimnisse der Höfe lagen offen vor ihm; er setzte Minister ab und schuf neue; er sagte den Gang der politischen Ereignisse voraus, kurz, er spielte eine ganze Stunde lang den Gesetzgeber von ganz Europa. Helene hörte ihm mit einem Anschein von Teilnahme zu, die ihn ganz bezauberte, und voller Zufriedenheit verließ er das Schloss, um einen benachbarten Grafen zu besuchen, wo er im Lob der Oberstin unerschöpflich war.
»Alles gut und schön«, entgegnete man ihm dort; »aber von welcher Familie stammt sie ab? — Sie und ihr Mann, mein Bester, sind Emporkömmlinge, und als solche werden sie immer nur ehrliche Bürgersleute bleiben, was doch wahrhaftig nicht viel ist!«
Конец ознакомительного фрагмента.