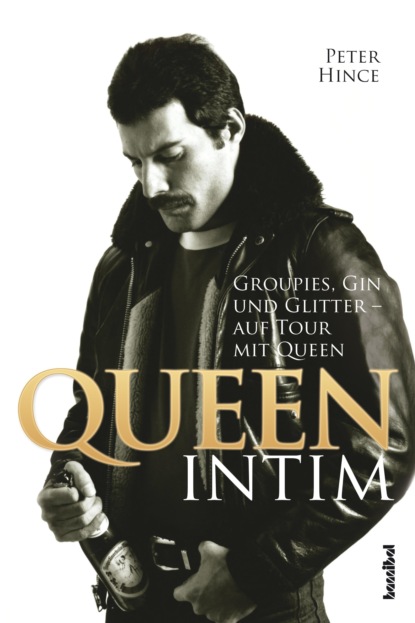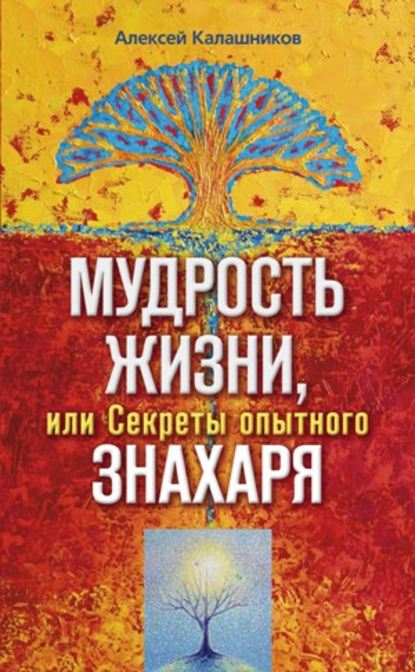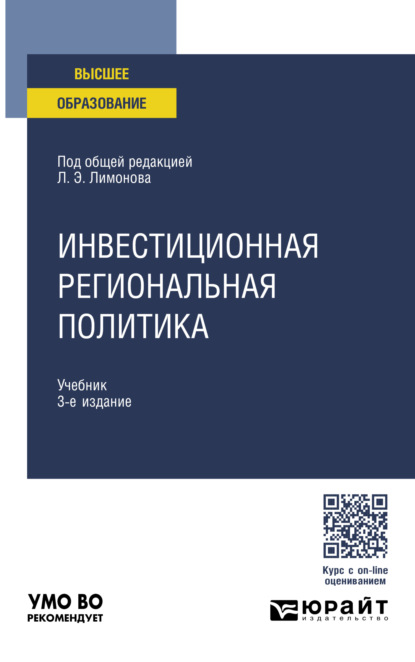- -
- 100%
- +
Ungefähr in der Mitte der Show führten Queen ein akustisches Intermezzo auf: Zeit also, sich am vorderen Bühnenrand auf Barhocker zu setzen, wobei Roger manchmal nach vorne kam, den Schellenkranz oder die Bass-Drum im Rhythmus spielte oder sang. Für Fans bedeutete das die einzige Chance, RMT (Roger Meddows Taylor) deutlich zu sehen, abgesehen von seiner Verbeugung am Ende des Auftritts. Unglücklicherweise sah er sie nicht sonderlich gut, denn Roger hatte eine schlechte Sehkraft und musste Kontaktlinsen tragen, was er nicht immer machte. Als er im Studio in Montreux eine Nummer im New-Orleans-Bluesstil übte, verpasste man ihm 1978 den Namen Blind Melon Taylor. Roger hatte viele Spitznamen, darunter den bekanntesten: Rainbow Man. Als das am meisten modebewusste Mitglied von Queen kaufte er sich ständig neue Klamotten, häufig in sehr klaren und knalligen Farben, die er zu allem Überfluss in den ungewöhnlichsten Kombinationen trug. (Er hätte sich damit problemlos für die Hauptrolle in dem Musical Joseph And The Technicolor Dreamcoat bewerben können.)
Hier eine Liste von Spitznamen der Queen-Musiker:
Freddie: Kermit – nach dem Muppet-Charakter Kermit, der Frosch. Während Freds „Ballett-Periode“ 1977 trug er meist weiße Trikots. Wenn er unter grünen Scheinwerfern stand, ähnelte sein geschmeidiger Körper in dem knallengen Kostüm der Muppet-Puppe – speziell, wenn er sich auf die Stufen des Bühnenaufbaus setzte. „Na, Fred, schon die halbe Leiter hoch?“ (Allerdings traute sich niemand, ihn mit Kermit anzusprechen oder einen Witz über einen Wetterfrosch zu machen.) Nach einem Interview mit Fred während dieser Zeit konnte sich der NME nicht die Schlagzeile verkneifen: „Ist der Mann ein Volltrottel?“ Man kann sich gut vorstellen, dass er sich nicht sonderlich darüber freute, was zu einer langen und angespannten Beziehung mit der Presse führte. Meist sprach ihn die Crew einfach mit Fred an, doch wenn er launisch war, wurde aus ihm der „Schurke mit den Goofy-Zähnen“. Agierte er noch schwieriger, tauchten alle nur erdenklichen unschönen Schimpfwörter auf, darunter sogar „Pferdchen“. Natürlich hatte das überhaupt nichts mit seinen Zähnen zu tun, sondern mit der Begeisterung für den geschmeidig tanzenden und in Russland geborenen Balletttänzer Vaslav Nijinsky.
„Wer?“, fragte die Crew. Gewann der nicht einige Pferderennen?
Wie dem auch sei, der Mann war eine große Inspiration für ihn. Fred benutzte ähnliche Kostüme bei den Konzerten von Queen, darunter ein schwarz-weiß gemustertes. Mary Austin, seine langjährige Freundin, die 1977 noch mit ihm zusammenlebte, schenkte Freddie (sie nannte ihn niemals Fred) einmal ein glänzendes, schweres Coffeetable-Buch über Nijinsky. Sie hatte eine Widmung in das Buch geschrieben: „Für den wahren Künstler, der du bist.“
Nicht zu vergessen das Rennpferd namens Mercury, das ein Vollblüter wie Fred war und zahlreiche Preise einheimste.
Brian: Percy – nach Percy Thrower, dem ersten britischen TV-Gärtner. Brian war versessen auf die Natur und die Arbeit im Garten. 1976, als ich einmal nachts noch Equipment zu seinem Londoner Haus lieferte, öffnete er mir die Tür in zerlumpter Kleidung, eine Taschenlampe in der Hand und in der Mähne kleine Zweige und Blätter. Er kroch tatsächlich noch in der Dunkelheit im Garten herum, um seine geliebten Pflanzen und Bäume zu pflegen. Aufgrund seiner Astrophysik-Studien und der Beschäftigung mit der Infrarot-Astronomie hätte man ihm eigentlich den Titel „Infrarot-Gärtner“ verleihen müssen.
John: Birdman oder Deaky (erklärt sich von selbst, da der letzte eine Abkürzung seines Namens ist). Zu Beginn der US-Tournee hatte sich John die Haare im Militärstil schneiden lassen und sah wie The Bird Man Of Alcatraz (dt. Der Gefangene von Alcatraz) aus. Er nahm die Hänseleien auf die leichte Schulter und trug die ihm von der Crew gekaufte Häftlingskleidung bei der Zugabe.
Die schwulen Mitarbeiter der Crew hatten eine eigene Art, sich Spitznamen auszusuchen, indem sie den männlichen Mitgliedern der Entourage und anderen „Freunden“ Frauennamen verliehen. Für sie war jeder Mann eine „Sie“.
Andere Spitznamen von Queen:
Freddie Mercury: Melina (Melina Mercouri – griechischer Filmstar).
Brian May: Maggie (Maggie May – Song von Rod Stewart).
Roger Taylor: Elizabeth (Schauspielerin Elizabeth Taylor).
John Deacon: Belisha (Belisha Beacon …?).
Mich nannte man Helen. Bitte keine weiteren Fragen.
Der Höhepunkt des Akustik-Intermezzos war erreicht, wenn Fred und Brian eine vereinfachte Fassung von „Love Of My Life“ spielten – für das Publikum war es dann an der Zeit, mitzusingen, und das war ein eindeutiger Höhepunkt der Show. Auf einer Tournee konnte man schnell überheblich und blasiert gegenüber den Zuschauern werden, speziell wenn die Gewinnerarroganz einsetzte. 130.000 Menschen in einem Stadion in einer für sie fremden Sprache perfekt singen zu hören, war aber etwas Besonderes. Es mag sich jetzt wie ein altes Klischee anhören, doch Musik überwindet alle Barrieren und Grenzen.
Mittlerweile ging es mit voller Kraft dem Finale entgegen. Die Band spielte große Hits wie „I Want To Break Free“, Rocker für Headbanger wie „Hammer To Fall“ und Songs wie „Radio Ga Ga“, bei denen die Menge mitklatschen konnte. Bei den Konzertproben hatte Fred das Wort „Radio“ durch das sich reimende „Fellatio“ ersetzt. Das löste bei der Band einen wahren Lachanfall aus, doch die Zuschauer bekamen niemals die Chance, sich dem in vollen Zügen hinzugeben. Fred liebte es, zu überraschen und zu provozieren, doch vor allem liebte er Auftritte und besonders leidenschaftliche und gute Auftritte.
Lediglich bei einem Konzert enttäuschte er mich auf der Bühne, denn sonst war er immer ein Profi par excellence.. Es war das einzige Konzert in Neuseeland, das Queen je spielten, und fand im Mount Smart Stadium in Auckland statt. Neuseeland – ein wunderschönes Land, doch kaum ein Paradies für Rock-Tourneen, da es an Clubs, Drogen und leichten Mädchen mangelte. Wir vermuteten, dass die Regierung bei der Einwanderungskontrolle ein Schild aufgestellt hatte: Bitte geben Sie hier ihre Genitalien ab – Sie werden sie während des Aufenthalts nicht benötigen. Es sei denn, man mag Schafe. Die gab es dort in reicher Auswahl.
Als Fred bei der Eröffnungsmelodie vom Band am Bühnenrand auftauchte, war er zu spät dran und zudem noch offensichtlich betrunken. Hatte er sich gelangweilt oder war er schlecht beeinflusst worden? Beides! Tony Williams alias Mr Hyde, unsere Garderoben-„Tussi“, trug dafür die Schuld, denn er hatte ihm die Hosen verkehrt herum angezogen, was tatsächlich erst auf dem langen Weg zur Bühne aufgefallen war. Er war die meiste Zeit selbst sturzbesoffen, ihn plagte häufig das klassische Alkoholikerzittern und er musste fragen: „Mein lieber Junge, könntest du mir beim Einfädeln zur Hand gehen?“ Ein liebenswerter Mann, der sich im Suff aber in Mr Hyde verwandelte. Dann wurde die Freundschaft zu ihm ein regelrechter Vollzeitjob.
Zu Beginn der Show kicherte Fred ständig und vergaß den Text. Er hatte kein Zeitgefühl mehr und fragte mich sogar, welche Songs als nächstes kamen – und wie man sie spielte! Trotzdem wurde die Show kein Desaster und einige der Stücke liefen sogar ganz gut, doch gelegentlich verlor Fred die Kontrolle, worunter die anderen Musiker litten. Als Zugabe spielten Queen den Elvis-Presley-Klassiker „Jailhouse Rock“, wozu man Tony auf die Bühne bat – nicht den betrunkenen „Garderoben-Tony“, der wahrscheinlich geglaubt hätte, mitgrölen zu dürfen, sondern Tony Hadley, den Sänger und Frontmann von Spandau Ballet. Tony, der damals eine kurze Tourneepause einlegte, ist ein großartiger, unprätentiöser Typ, der aber leider nicht den Text kannte. Ein Rockstar, der den Text von Elvis Presleys „Jailhouse Rock“ nicht kennt?
Während ich hinter Freds Piano hockte und ihm dabei zusah, wie er sich die Seele aus dem Leib sang, blickte ich manchmal ins Publikum und stellte mir Fragen über das Leben, den Tod und meinen persönlichen Lebensweg. Was soll ich machen? Welchen Sinn hat das Leben? Warum mache ich das hier?
Im Alter von 25 Jahren war aus mir ein Sub-Steinway-Weiser geworden. „Is this the real life? Is this just Battersea?“ „Nothing really matters“, die vorletzte Zeile von „Bohemian Rhapsody“, fiel mir oft auf, während ich über die Sinnlosigkeit des ganzen „Rock-Krams“ sinnierte und darüber, wie schnell man auf einer Tournee übersättigt war. Wenn der Song jedoch endete, die Scheinwerfer erstrahlten und Tausende von Menschen in Licht hüllten, die von „Bo Rhap“ ganz aus dem Häuschen waren, erkannte ich: Für manch einen war es von großer Bedeutung, und Queen wurden zu einem wichtigen Teil seines Lebens.
Als ich weiter grübelte, donnerte Queen in die nächste Rocknummer und meine Innenschau löste sich in Luft auf. Zurück zum Geschäft – wie üblich. Der letzte Song ihres Sets endete mit einer Reihe pyrotechnischer Explosionen am vorderen Bühnenrand als Höhepunkt, die ich startete und mit denen ich einige Fotografen und Leute von der Security versengte. So ist das nun mal im Sport. Brian war das einzige Mitglied von Queen, das das Publikum bei einem Auftritt direkt ansprach, dabei beschränkte er sich aber auf ein oder zwei Ansagen. Mitte der Siebziger, vor der letzten Nummer eines Konzerts, sagte Brian mal: „Wir möchten euch wie immer mit den besten Wünschen verlassen – und im Schoße der Götter wissen.“ (Crew-Version: „Wir möchten euch wie immer mit den besten Wünschen verlassen – gelangweilt und nach Rückgabe des Eintrittsgelds schreiend.“)
Queen verließen die Bühne unter donnerndem Applaus, Stampfen und Schreien im Dunkeln, woraufhin wir quasi in einer Zwielichtzone vor den Zugaben schwebten. Um uns herum sahen wir Tausende angezündeter Streichhölzer oder Feuerzeuge, die durch die rauchdurchdrungene Luft schimmerten, die Luftfeuchtigkeit, den Staub der Pyrotechnik und die energiegeladene Atmosphäre. Eine Flamme aufleuchten zu lassen, entwickelte sich schnell zu einem allzu gewohnten Anblick, doch als ich das erstmalig in den USA erlebte, hätte ich am liebsten innegehalten, das alles auf mich wirken lassen und dabei spekuliert, wie lange dieser Anblick wohl anhält.
Möchten Sie noch mehr?
Eine Zugabe vielleicht?

Die Zugabe bei einer Rock-Show – man weiß, dass sie kommt. Ein kleiner zweiter Auftritt oder vielleicht auch ein dritter. Mitte der Siebziger trat Fred bei einer Zugabe an den Bühnenrand und warf rote Rosen ins Publikum. Die Dornen der Rosen waren natürlich zuvor entfernt worden, was eine mühselige Aufgabe war, doch Fred beschwerte sich immer darüber, nicht genügend Blumen zur Verfügung zu haben. Unvermeidbar wurden einige kleinere Dornen übersehen, die auf seinen zarten Händchen eine unbeabsichtigte Akupunktur hinterließen. Um Freds Nachschub zu garantieren, das Budget nicht zu überschreiten und weiteres Blutvergießen zu vermeiden, verlagerte man die Auswahl auf Nelken, die ich in Wassereimern unter dem Flügel versteckte.
Auf ein Zeichen hin rannte ich mit einem Arm voller Blumen zu Fred. Während er sie an den Stielen in ein regelrechtes Meer aus ausgestreckten, greifenden Armen warf, nahm ich das Mikro mit zur Bühnenseite und stellte den nächsten Strauß zusammen. Wenn er alle Nelken verteilt hatte, sprintete er zum Flügel, und ich beeilte mich, ihm auf halbem Weg das Mikro zu geben. Ein nettes Beispiel für eine Choreographie. Fühlte Fred sich übermütig, schnappte er sich die Plastikeimer mit den Blumen und schüttete den gesamten Inhalt aufs Publikum, über sich selbst – oder über mich.
Bei den frühen Queen-Tourneen führte die Band den leicht tuntigen Kabarett-Song „Big Spender“ von Shirley Bassey auf: „The minute you rolled up the joint …“ Fred schlich sich in einem mit Pailletten bestickten japanischen Kimono auf die Bühne, den er wie ein Stripper abstreifte und dabei rot-weiß gestreifte Shorts mit passenden Hosenträgern enthüllte. Er riss dramatisch am Gürtel des Kimonos, damit dieser an ihm herunterfiel. Was nicht immer geschah. In einem bis auf den letzten Platz gefüllten Hammersmith Odeon versuchte ich ihn nervös von dem japanischen Kleidungsstück zu befreien und zog dabei die Shorts unbeabsichtigt halb herunter. Panisch schnitt ich Fred mit einem rasierklingenscharfen Stanley-Messer los. Nach dem Zwischenfall lag ständig eine handlichere und sichere Schere in der Nähe. Freds Stimme war schon hoch genug und sicher nicht auf einen spontanen chirurgischen Eingriff durch den Roadie angewiesen.
Freddie Mercury hielt während einer Queen-Tournee alle Mitarbeiter auf Trab – alle, und auch ich blieb davon nicht verschont. Er agierte spontan, wenn man es überhaupt nicht von ihm erwartete, und änderte seinen Bewegungsablauf, den Rapport und sogar die Texte. Spielten Queen „Jailhouse Rock“ als Zugabe, konnte man auf neue Wörter zur Bereicherung des englischen Wortschatzes gefasst sein. In einem Mix aus Singen und Sprechen murmelte er rhythmische Phrasen, während die Band einen ausgedehnten Boogie hinlegte. Ich kann mich noch an folgende Sprachfetzen erinnern: „Shaboonga“, „Shebbahhh“ und „Mmmmmmuma muma muma muma muma muma muma muma muma muma muma – Yaatch!“ Mmmm? Eine alte persische Sprache? Vielleicht ein lokaler Dialekt aus Sansibar?
Wenn wir Fred nach Bedeutung und Herkunft der Laute fragten, antwortete er verteidigend: „Das singe ich doch nicht – oder?“ Doch! Den Beweis lieferte der Tontechniker, der ihm einen Mitschnitt der Show vorspielte. Auch wies man Brian darauf hin, dass der Beginn des Gitarrensolos der TV-Westernserie Bonanza verdächtig ähnelte. Schließlich kamen noch Roger und John an die Reihe, denen man klarmachte, dass sie die Rhythmus-Sektion sind, also auch die Verantwortung für das Timing tragen – sollten!
Nach kurzer Zeit einigte man sich auf eine stets gültige Titelabfolge der Queen-Zugaben: Zuerst spielte die Band Brians „We Will Rock You“, gefolgt von Freds „We Are The Champions“. Als Fred im Sommer 1977 während der Proben zu den Aufnahmen von News Of The World in die Shepperton Film Studios stolzierte und bekanntgab, einen Song für Fußball-Fans zu haben, reagierte die Band skeptisch und mit einem gesunden Misstrauen – was machte er denn nun schon wieder? Von der Rockmusik zur Oper bis hin zu Stadionrängen und Hooligans? Es funktionierte. Fred mag ein zurückgezogen lebender Mensch gewesen sein, oftmals ruhig und reserviert, aber nicht, wenn er auf die Errungenschaften von Queen hinwies: „We are the champions – of the world!“
Ich bin mir sicher, dass er das Potential seiner Sporthymne schon erkannt hatte und zugleich wusste, dass sich die Nummer erfolgreich in ein Konzert einfügen würde. Allerdings bezweifle ich sehr, dass Fred jemals Fußball gespielt oder auf den Rängen eines Stadions gestanden hatte (Sansibar Rovers?). Er erkannte jedoch das bei einem Fußballspiel entstehende Gemeinschaftsgefühl, die Leidenschaft und die Begeisterung. Trotz seiner eher elitären Erziehung konnte Fred gut mit ganz normalen Menschen kommunizieren und die Fans verstehen. Er sah sich im Fernsehen Fußballübertragungen an und liebte alle größeren Sportveranstaltungen. Sein Lieblingsteam – nach England – war Brasilien. Er bewunderte das geschmeidige Auftreten der Brasilianer, das Lächeln, das die Lippen der Sportler umspielte, und die hingebungsvolle „Karneval-Armee“ enthusiastischer Fans. Wenn aus der Menge ein Ball geflogen kam, kickte er manchmal auf der Bühne und schoss ihn kraftvoll und mit ein wenig Stil zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einen starken und nach vorne drängenden Mittelfeldspieler abgegeben hätte, der jede Lücke im Tor der Gegenspieler ausnutzt. Doch Fred betrieb nur einen Outdoor-Sport – Tennis, das auch Roger gerne spielte, wann immer sich dazu die Gelegenheit bot.
Der Aspekt Sport tauchte manchmal bei Queen-Shows auf. Zur allerersten Aufführung von „We Are The Champions“ im Dezember 1977 im Madison Square Garden in New York erschien Fred mit einer blau-weißen Jacke der New York Yankees und einer Baseball-Kappe. Die Yankees hatten gerade die World Series gewonnen. Trotz der Tatsache, dass der Garden im fünften Stockwerk lag, brachte die Menge von 20.000 Zuschauern den Veranstaltungsort mit ihrem Beifall zum Beben. Beim Bühnen-Baseball erwies Fred sich als äußerst geschickt, denn als diverse Gegenstände auf die Bühne flogen, betätigte er sich als Batter und setzte den umgedrehten Mikrostab zur Abwehr ein. Die Japaner entwickelten eine wahre Leidenschaft für den Sport. Zu ihrer großen Begeisterung heimste Fred einige Home-Runs mit den bunten Plastikbällen ein, die sie gerne auf die Bühne warfen. Zum Dank warf er einige Flaschen Heineken zielsicher ins Publikum.
Auf der Magic-Tour entfaltete sich während des zweiten Auftritts in München ein wahrhaft magisches Szenario. Abgesehen von der Tatsache, dass man die Stadt als zweite Heimat von Queen bezeichnen konnte und hier viele Freunde wohnten, war es der Tag des Fußball-WM-Endspiels 1986 zwischen der BRD und Argentinien. Die deutsche Crew und das Backstage-Personal in der Olympiahalle klebten förmlich an einem kleinen Fernseher. Das Spiel wurde verlängert und Queen mussten auf die Bühne, ohne das Endergebnis zu kennen. Fred hatte aber einen Masterplan. Im Falle eines Siegs der deutschen Mannschaft wäre er bei „Champions“ in einem dementsprechenden Trikot auf die Bühne gegangen und hätte ein oder zwei Bälle in das zweifellos begeisterte Publikum gekickt. Leider gewann Argentinien, wodurch Fred bei seinem letzten Auftritt in der Stadt, die er so liebte, ein angemessener Höhepunkt verwehrt blieb.
Fußball ist des kleinen Mannes Sport. Trotz der Universitätsabschlüsse und der gelegentlich arroganten Haltung, waren Queen eine Band des Volkes. Sie gaben den Menschen mit ihren Shows stets einen angemessenen Gegenwert für ihre Geduld und ließen ihren Reden auch Taten folgen, womit sie sich kontinuierlich den Kritikern widersetzten. Queen und ihre Musik zu mögen war verpönt, vermutlich, weil sie Erfolg hatten. Ja, so etwas gibt es bei uns in Großbritannien einfach nicht – Leute, die Talent haben und erfolgreich sind. Um eine erfolgreiche Karriere im Musikbusiness aufrecht zu halten, muss man vor allem über Talent und Können verfügen: Auch Zielstrebigkeit, Glaube und Durchhaltevermögen sind notwendig, um ein hohes Niveau zu wahren. Queen hatten das alles. Fred sogar im Überfluss.
Leider bezog sich der Überfluss auch auf negative Aspekte, denn von einigen Zeitungen und besonders von der Regenbogenpresse wurde Fred geradezu mit Mist überschüttet. Sie interessierten sich nur für seine Schwächen, den Lebensstil und die Sexualität. Trotz seiner starken Willenskraft und seines unbeugsamen Charakters verletzte ihn das manchmal. Wenn sich Fans über einen Fußballspieler hermachen, weil er nicht in Form ist oder keine Tore schießt, antwortet er ihnen auf die best mögliche Art – indem er das spielentscheidende Tor schießt, oder, noch besser, einen Hattrick abliefert. Fred antwortete auf die Medienschelte, indem er eine weitere Hit-Single komponierte, Queen ein neues Platin-Album ergatterten und begeisterte Besprechungen für ihre rekordverdächtigen Konzerte erhielten, die sie als die wahren Champions herausstellten.
Das Ende von „Champions“ war das Ende der Zugabe. Die halbkreisförmige Lichttraverse wurde mit voller Beleuchtung wieder herabgefahren, neigte sich zunächst und näherte sich dann wie von einer magischen Hand gesteuert dem Publikum, während Nebel und Trockeneis die Bühne verhüllten und die Band förmlich verschluckten. Nachdem sie sich verbeugt hatten, verschwanden die erhitzten und schwitzenden Musiker von der rechten Bühnenseite, zum Klang des applaudierenden Publikums und dem vom Band gespielten „God Save The Queen“.
Die Assistenten warfen den Musikern kuschelige Bademäntel über, während man sie schleunigst zur Garderobe geleitete, wo sie feiern, sich streiten oder sich einfach stillschweigend hinsetzen konnten. Nach einer kurzen Zeit ging es weiter, wobei man die eben genannten drei Optionen wechselte.
Wie hatten sie heute gespielt? Wie kamen sie an? An den Abenden, an denen sie sehr gut spielten, erkannte man das gewisse Etwas, das Magische an der Band. Falls dem nicht so war, wussten sie es, wussten wir es, aber das Publikum beschwerte sich niemals. Für sie wurde es immer zu einem Erlebnis. Es gab einige Städte und Veranstaltungsorte, die Queen zu Höchstleistungen anspornten: Mir fallen da spontan das L.A. Forum ein, der Madison Square Garden, das Montreal Forum, die Festhalle in Frankfurt/Main, Budokan in Tokio, nicht zu vergessen Auftritte in den Niederlanden und in London – dort gelang es Queen, etwas Besonderes in ihrem Programm herauszuarbeiten. Während der Magic-Tour 1986 brillierten Queen bei zahlreichen Open-Air-Konzerten in Stadien. Bei den Südamerika-Terminen 1981 spielten sie überragend, wobei die dritte Show in Buenos Aires meiner Meinung nach das beste Open Air war, das Queen jemals ablieferten.
Bis auf das engste Personal wurde niemand nach einem Gig in die Garderobe gelassen. Das geschah erst bei einer ausgeglichenen Stimmung. Manchmal mussten alle Mitarbeiter raus, da die Musiker den Abend ausgiebig diskutierten. Wenn etwas bei der Show schief gelaufen war, rief man die Verantwortlichen zur Besprechung der schlechten Leistung zu sich. Gerry Stickells, der Tourmanager, musste am häufigsten das Gewitter über sich ergehen lassen – wegen verpasster Einsätze, Problemen mit dem Equipment, einem schlechten Sound oder dem Muster des Garderobenteppichs.
Nach Verlassen der Bühne war die Show für die Band vorbei, doch nicht für die Roadies, denn uns stand eine zweite Show bevor. In dem Moment, in dem die Band von der Bühne ging, begann das geschäftige Treiben – sogar noch vor Ende des Einspieltapes und dem Aufflackern der Hauslichter. Die Bühne musste schnellstmöglich komplett geräumt werden, denn erst dann konnte man die PA abbauen. Auch mussten die über der Bühne befestigten Scheinwerfer heruntergelassen werden, bevor man sie und die Träger auseinandermontierte. Vor dem Abbau schaute man noch schnell über die Bühne, um zu erkennen, was dort für Goodies oder interessante Gegenstände lagen. Das variierte natürlich von Land zu Land: Neben an die Band adressierten Karten und Briefen (ab in die Mülltonne) fanden wir Münzen, Joints, Ringe (die wir behielten), Spielzeug (das später in die Luft gejagt wurde), Cassetten (meist zum Überspielen behalten), selbst gemalte Bilder der Band und Gedichte (Mülltonne), Zigaretten, T-Shirts (manchmal behalten) und Damenunterwäsche (behalten und sorgfältig aufbewahrt).
Bei der US-Tour 1980 wurden von einigen Fans Einwegrasierer auf die Bühne geschleudert, aus Protest, dass Fred nun einen Bart trug. Wie vorherzusehen, kommentierte er das mit einem „Fuck Off!“ Dann, als er sich zwischen den Songs mit dem Publikum unterhielt, legte ein Fred-Klon mit einem Oberlippenbart und einem Karomuster-Hemd einen kleinen runden Metallgegenstand auf den Catwalk zu seinen Füßen. Fred hob ihn auf. „Was haben wir denn hier?“, fragte er mit schriller Stimme und hielt dabei den Gegenstand in die Luft. „Einen Cock-Ring! Danke dir vielmals, mein Liebling.“
Fred lief zur rechten Bühnenseite und händigte ihn mir aus. Für mich sah das Ding wie ein Designer-Serviettenhalter aus. Ich legte den Ring in meine BLU 8, eine Werkzeugkiste, in der sich so einige Überraschungen befanden, als Paul Prenter, der sexuell unersättliche, schwule Assistent zu mir rüber lief und mir ins Ohr schrie: „Gib ihn mir – ich will ihn!“ Kein Problem – bei mir wäre er eh nur in der Werkzeugkiste gelandet, zusammen mit Schrauben, Hämmern und Nüssen. Ganz offensichtlich hatte Paul andere Pläne für den Ring, die aber ohne jeden Zweifel was mit Hämmern, Schrauben und zwei Nüssen zu tun hatten.
Nachdem alle nennenswerten Geschenke verstaut waren, begann das „Abreißen“ – schnell, aber gut organisiert. Alles, was wir mit Gaffa-Tape gesichert hatten, wurde von dem klebrigen Band befreit, gut eingepackt und dem am nächsten Stehenden zum Verstauen überreicht. Die lokalen Helfer entsorgten unverzüglich alle auf der Bühne stehenden Getränke: Drinks in Plastikbechern, offene Dosen und Ähnliches wanderten in große Plastikmülltonnen, die man am hinteren Bühnenrand aufstellte. Da John immer eine große Auswahl an Drinks zur Verfügung hatte, wurden einige davon als „Bonus-Bezahlung“ betrachtet und konsumiert. Der Tontechniker Tony „Lips“ Rossi kam als erster an die Reihe. Der auf Sparsamkeit bedachte Mann – man nannte ihn auch „Love Criminal“ – sammelte während drei aufeinander folgender Shows die Reste aus drei Rotweinflaschen und kippte sie in einer zusammen. Gefragt, warum er den nun nicht mehr sonderlich frisch anmutenden, sondern eher dubiosen Wein (Winter/Jahrgang 1980) nun wieder mit einem Korken verschloss, erläuterte er uns seinen Plan. Er wollte die Managerin der Vorband Straight Eight verführen, einen eindrucksvollen, feurigen Rotschopf aus besserem Hause. Keine leichte Aufgabe für einen Italo-Amerikaner aus Pennsylvania, der auf der Straße aufgewachsen war. Bewaffnet mit der Weinflasche und ein bisschen Koks, das er sich zurückgelegt hatte, schlich sich Rossi zur großen Verführung ins Park Hotel Bremen. Es klappte. Die beiden heirateten sogar. Doch die Ehe hielt nicht lange.