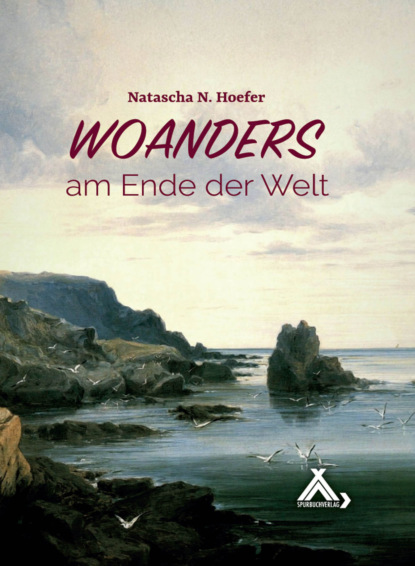- -
- 100%
- +
Doch nach Caen und dem zweiten Sekundenschlaf sah er ein, dass er bald ein Hotel suchen musste. Bayeux, der Name sagte ihm etwas; war da nicht dieser uralte Teppich mit den Bildern der NormannenSchlacht? Florian gähnte – und fuhr zusammen, als er dem dritten Wegelager des Tages in die Falle ging! War ganz Frankreich gespickt von solchen Dingern?! – Prompt verließ Florian Bayeux wieder, um über die nächstbeste Landstraße nach Porte-en-Bessin-Huppain zu gelangen, aber kein Hotel in dem Kaff zu sehen. Also weiter, in den nächsten Ort. Florian ließ die Fensterscheibe herunter, der salzige Geruch des nahen Meeres weckte ein wenig seine Lebensgeister. Und dann, nachdem er das Ortsschild von Colleville-sur-Mer passiert hatte, sah er es, an einem älteren Gebäude: das Wort »Hôtel«. Er bremste scharf und parkte am Straßenrand.
»Après douze heures, sonnez s. v. p.«, stand auf einem Schild am Eingang. Darunter auf Englisch: »After midnight, ring the bell please«.
Es war gegen ein Uhr morgens. Florian drückte den Klingelknopf. Eine Weile tat sich gar nichts. Sollte er etwa im Cayenne übernachten? Er klingelte noch einmal.
»J’arrive!«, rief eine tiefe Stimme aus dem Inneren des Hauses.
Jemand schloss die Tür auf und dann stand Florian vor einer alten gebeugten Frau in Morgenmantel und Pantoffeln, die ihn misstrauisch von unten anschaute.
»Can I have a room for one night, please?«, fragte Florian. Er war zu kaputt, um zu versuchen, Französisch zu reden. Er hatte zwar von der siebten bis zur elften Klasse Französisch in der Schule gehabt, aber das war lange her, und er war damals zu faul gewesen, um regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen.
Die alte Frau nickte und trat einen Schritt zurück, um ihn hineinzulassen. Florian folgte ihr an den Tresen, auf dem nichts stand als eine Vase mit drei kleinen Flaggen. Der französischen, der britischen und der amerikanischen. Wo bin ich denn hier hingeraten, fragte Florian sich, während die Alte in einem Buch blätterte und ihm dann einen Schlüssel reichte. »7«, stand auf dem Plastikschild daran.
»American?«, fragte sie.
»No, German«, antwortete Florian vorsichtig und sein Blick schweifte zurück zu der Vase mit den drei kleinen Flaggen. Er begriff: Der Sturm auf die Normandie, der Einfall der Alliierten – das musste sich irgendwo hier abgespielt haben, an dieser Küste.
»Ah«, knurrte die Alte, und Florian meinte, einen scheelen Blick von ihr einzufangen.
»C’est en haut«, sagte sie und wies mit der Hand Richtung Treppe.
»Merci«, erwiderte Florian doch auf Französisch, was ein winziges Lächeln in die zuvor nach unten gezogenen Mundwinkel seines Gegenübers zauberte.
Zimmer Nummer 7, das Florian rechts am Ende eines engen, dunklen Korridors fand, war mit einem Doppelbett, einem Schrank, einem Tisch und einem Stuhl möbliert. Auf dem Tisch stand ein kleiner dickbauchiger Fernseher. Florian legte sich auf das Bett. Nur kurz ausruhen, dachte er, und dann die Tasche aus dem Auto holen.
3. Unterwegs
Es führte zu nichts, länger im Bett zu bleiben und zur Decke zu starren. Überhaupt, dieses schreckliche Bett! Nach ihrer ersten Nacht im Garten war Marie doch in Elodies Schlafzimmer eingezogen. Nur, bei jedem Herumwälzen, und Marie schlief unruhig, quietschten die Federn der alten Matratze wie eine Katze, der man auf den Schwanz tritt, und das ganze Bett geriet ins Wanken wie eine Boje auf hoher See.
Wie eine Greisin schob Marie in Zeitlupe erst das linke, dann das rechte Bein von der Matratze. Sie griff sich an den Kopf. Schon wieder Kopfschmerzen, nach einer weitgehend durchwachten Nacht. Aber sie hatte sich vorgenommen, keine Schlaftabletten mehr einzuwerfen. Und jede zweite oder dritte Nacht gelang es ihr doch, vor Übermüdung zu schlafen.
Sie tappte hinunter ins Erdgeschoss und öffnete die Fensterläden. Aus dem linken Fenster beugte sie sich weit hinaus, um ihre Hortensien zu bewundern. Seitdem sie in Mengleuff war, hatte sie sie Tag für Tag und Woche für Woche mit viel Wasser und Liebe und gutem Zureden vor dem Vertrocknen gerettet. Sie liebte die zwischen rosa und hellblau changierende Farbe der prächtigen Blüten, den Duft, den sie verströmten. Sie liebte die den Pflanzen innewohnende Kraft, die eine solche Wiederauferstehung ermöglicht hatte. Die Hortensien sahen wieder prächtig aus, keine Fragen. Und wie ihre Hortensien, so würde auch sie selbst, Marie Cadiou, aus ihrem Tief wieder herauskommen, schwor sie sich – wie jeden Morgen, beim Öffnen der Läden. Aber leicht war das nicht.

Licht drang durch Florians geschlossene Augenlider. Dann die Erinnerung, der Schlag in die Magengrube. Langsam öffnete er die Augen.
Eine Weile starrte er nur an die Decke, versuchte zu verdauen, dass das alles kein bloßer Alptraum war, sondern die Realität. Katharina. Wie konnte sie ihm das antun?
Endlich rappelte er sich auf und kam am Bettrand zum Sitzen. Wie hässlich das primitive Hotelzimmer bei Tageslicht war. Die großgeblümten Tapeten wiesen in den Ecken des Raumes Risse auf und ihr weißer Grund war vergilbt. Eine leichte Übelkeit überkam Florian, er musste aufstehen und zum Fenster gehen, er brauchte Luft. Doch als er die alte Gardine beiseite zog, schreckte er zusammen. Sein Blick fiel auf schier endlose Reihen von weißen Kreuzen.
Er rieb sich die Augen. Das war doch ein Alptraum. Er musste weg hier. Duschen, frühstücken, weg hier. Halt, seine Tasche. Ans Auto musste er zuerst.
Draußen roch es nach Seeluft. Das tat gut, Florian sog begierig die salzige Luft ein. Auch den Cayenne vor dem Hotel vorzufinden, hatte etwas Beruhigendes. Er holte sein bescheidenes Gepäckstück aus dem Kofferraum und ging zurück in das Hotel, das bei Tageslicht auch von außen noch trostloser aussah.
Er fand die Dusche am anderen Ende des Korridors auf der Etage seines Zimmers; und keine halbe Stunde später saß er mit feuchten Haaren in dem kleinen Frühstücksraum. Es war gerade neun Uhr. Wortlos stellte die alte Frau, deren Bekanntschaft er in der Nacht
gemacht hatte, einen Korb mit Baguettestücken vor ihn. Dazu stellte sie einen Teller mit verpackten Butterstücken und kleinen Plastiktöpfchen mit Marmelade. Schade, keine Nutella. »Du café ou du thé?«, fragte die Alte dann, und nachdem Florian Kaffee bestellt hatte, schlurfte sie aus dem Raum.
Während Florian auf den Kaffee wartete, sah er durch das Fenster auf die unbelebte Straße. Vielleicht lag es daran, dass der Himmel bedeckt war, aber die verwitterten Fassaden der Häuser und das halb verrottete Schild »A vendre« im Ladenhaus gegenüber wirkten auf ihn bedrückend. Dieser Ort sah aus, als wäre er vom Aussterben bedroht. Aber vielleicht sah er das nur so, weil es ihm selbst so schlecht ging.
Die alte Frau kam mit dem Kaffee. Eine große Tasse voll, er roch gut, eine dünne Schicht Milchschaum lag auf der Oberfläche. Neben die Tasse stellte die Frau eine Dose Zucker.
Der Kaffee schmeckte ausgezeichnet, stark, aber nicht bitter, und die Baguette war frisch und eben so, wie französische Baguette sein sollte. Erst beim Essen merkte Florian, dass er Hunger gehabt hatte. Während er auf einen zweiten Kaffee wartete, sah er schon munterer durch den Frühstücksraum. Erst jetzt fiel ihm das Tischchen in der Ecke neben der Eingangstür auf, auf dem verschiedene Prospekte lagen. Er schlenderte hin und überflog den Flyer eines »D-Day-Museums«. Jaja, so war das. Der Zufall hatte es so gewollt, dass er hier gelandet war, an diesem Ort, der direkten Bezug zum zweiten Weltkrieg hatte und zur Westfront – einen Bezug zu seiner eigenen Oma … Florian seufzte und legte den Flyer zurück. Das D-Day-Museum im benachbarten Arromanches würde er nicht besichtigen; aber vor der Abreise würde er noch einen Blick auf den Friedhof werfen, dessen Anblick ihn nach dem Aufstehen so erschreckt hatte.
Sechzehntausend amerikanische Soldaten seien hier beerdigt, las Florian auf einem Informationsschild, ehe er nach dem Auschecken den Friedhof durch ein breites Tor betrat. Er sah um sich. Parallele Reihen von weißen Kreuzen, ein riesiges Feld davon. Er begann, aufs Geratewohl eine Reihe abzuschreiten, las beiläufig Namen und Geburtsdaten, begann, im Kopf zu rechnen. Hier waren nur junge Männer beerdigt. Richard Brown, knappe zwanzig geworden; Euston McCullom, einundzwanzig; Jeffrey Pendleton, zwanzig … Ich lebe schon fünfzehn Jahre länger als Jeffrey Pendleton; in fünf Jahren habe ich doppelt so lange gelebt wie dieser junge Mann, der 1944 in das Abwehrfeuer der Deutschen gelaufen ist.
»Hey, guys, come here!«
Florian fuhr herum. Zwei Kreuzreihen weiter sah er sie, die drei Männer. Sie waren mittleren Alters, trugen Armeehosen, Baseballkappen und große Fotoapparate in den Händen. Jetzt lichteten sie sich gegenseitig vor einem Grab ab. Lachend, laut und aufgeregt durcheinander redend.
Irritiert wandte Florian sich ab. Was waren das für merkwürdige Typen? Touristen, die die »D-Day-Küste« life erleben wollten? So etwas gefiel ihm gar nicht. Er verließ den Friedhof und stieg in den Cayenne.

Jeden Tag machte Marie sich ein straffes Programm; es gab immer genug zu tun, in Mengleuff, und sich abrackern war der beste Weg, um die Trauer abzuarbeiten; oder fortzuschieben, zumindest. Die Trauer um den Mann, an den sie nicht mehr denken durfte und nicht mehr denken wollte; denn er hatte nicht vor – nach fast drei Wochen ohne Lebenszeichen von ihm hatte er wirklich nicht vor, um sie zu kämpfen. (Aber die Hoffnung stirbt leider immer zuletzt; und dieses allmähliche Absterben tat weh, so weh …) Wenn Marie aber einmal Pause machen und mit einem Menschen reden wollte, der ihr ein kleines Gefühl der Geborgenheit gab, dann ging sie zu Yvonne Le Roux.
Yvonne war mittlerweile die Dorfälteste und gehörte für Marie untrennbar zu Mengleuff. Sie war »schon immer« da gewesen; nämlich soweit Maries Erinnerung an Mengleuff reichte. Yvonne strahlte eine unglaubliche Ruhe und gewitzte Weisheit aus; und sie hatte den schönsten Garten des Dorfes. Die alte Dame liebte Blumen. Sie hatte ein Meer verschiedenster Sorten davon, dazu aber auch nutzbare Pflanzen: Gemüse, Himbeer- und Stachelbeerbüsche und alte Apfelbäume. Dazwischen gackerten freilaufende Hühner. Deshalb hatte das Haus mit dem idyllischen Garten ein Gartentor, das niemals offenstehen durfte.
Marie lehnte sich über dieses Tor und rief: »Bonjour! Darf ich reinkommen?«
Yvonne saß auf dem Bänkchen neben der Haustür und schälte Kartoffeln. Die Schalen ließ sie in ihre karierte Schürze fallen, die geschälten Kartoffeln plumpsten in einen zerbeulten Eimer aus Blech. »Komm nur, Marie Cadiou, aber schließe das Törchen, wegen der Hühner!«
Marie tat es und setzte sich auf eine Geste der alten Dame hin neben diese auf die Bank.
»Na, hast du dich inzwischen gut eingelebt?«, erkundigte sich
Yvonne. Sie konnte schälen, fast ohne hinzusehen.
»Ich komme gut voran mit dem Renovieren«, antwortete Marie ausweichend. »Den Dielenboden musste ich gar nicht abschleifen, ölen genügte. Meinen Teppich aus der alten Wohnung habe ich in das Schlafzimmer gelegt, ein Berber in warmen Farben, sieht gleich ganz anders aus. Die Tapeten im Schlafzimmer sind cremeweiß, unten habe ich weiß mit einem Hauch von gelb gestrichen. Ist wirklich schön. Aber die Plackerei mit dem Entleeren und Verschieben aller Möbel! Und dann gibt es noch ein Zimmer komplett zu renovieren, in dem hat früher mein Großvater geschlafen, als Kind …« Marie musste gähnen.
»Du arbeitest zu viel. Warum hilft dir niemand? Hast du keinen Freund?«, fragte Yvonne geradeheraus.
Marie wollte aufspringen. Die Vernunft hielt sie davon ab. »Ich habe einen besten Freund, er heißt Pierre, der wird mir bei den noch ausstehenden Möbeltransporten helfen«, brachte sie hervor.
»Und deine Eltern?«
»Bloß nicht!«
Verblüfft hielt Yvonne mit dem Schälen inne, und Marie erklärte müde: »Sie wissen vielleicht, dass mein Vater Elodies Patensohn war. Da dachte er … oder besser, meine Eltern dachten beide, sie würden ihr Haus erben. Wie ich mittlerweile erfahren habe, sind sie die letzten zehn Jahre lang, als Elodie nicht mehr kam, regelmäßig hierher gefahren, um das Haus instand zu halten. Ich wusste davon nichts; und überhaupt, ich kann nichts dafür, dass Elodie mir das Haus vermacht hat – warum auch immer!«
Yvonne Le Roux legte den Kopf schief. »Hauptsache ist, dass das alte Haus der Cadious wieder bewohnt ist. Es stehen so viele Häuser leer. Auch das neben deinem. Wie schade. Früher lebte die Familie Lévénès darin. Fünf Kinder. Was aus denen allen geworden ist? Der Vater war Dachdecker.«
»Dann ist es aber lange her, dass die Familie Lévénès nicht mehr in dem Haus wohnt! Ein Dachdecker hat sich dem Dach ewig nicht mehr genähert. Die losen Schieferplatten fallen herunter wie Regen.«
»Siehst du, schade. To pa ri ti, Pa ri ti to1, sagt das Sprichwort. Dein Haus braucht ein Dach, und solange das Dach hält, kannst du dein Haus retten. Ist das Dach futsch, hast du bald eine Ruine.«
»Wem gehört das Haus denn inzwischen?«
»Einem deutschen Monsieur. Aber den habe ich nur einmal vor Jahren gesehen. Ab und zu kommt ein Mann, der ein bisschen Rasen mäht und Efeu zurückschneidet. Aber das genügt nicht. Das Haus verfällt, wenn nicht bald etwas geschieht. Der deutsche Monsieur müsste kommen. Schade, schade.« Yvonne zuckte die Achseln.
Schade? Im Gegenteil! Marie war erleichtert. So hatte sie im Garten ganz ihre Ruhe, und wenn sie nur daran dachte, dass sie einen männlichen Nachbar hätte haben können, kamen heftige Abwehrgefühle in ihr auf. Sie hatte die Nase voll von Männern; jedenfalls hatte sie keinen Bedarf an einem fremden Mann, der sie über die Grenzbüsche zwischen beiden Gärten hinweg anglotzen, anlabern oder im schlimmsten Fall anmachen könnte!
Nach ihrer Rückkehr von Yvonne machte Marie sich den Spaß, einmal um das leere Nachbarhaus herumzuschleichen. In gewisser Hinsicht hatte Yvonne natürlich recht: Es war ein altes Haus wie ihres und der Garten war ähnlich groß, ohne knorrige alte Apfelbäume allerdings, dafür mit einigen interessanten Felsblöcken, die aus dem hohen Gras ragten. War das Natur oder hatten einmal die keltischen Vorfahren Hand angelegt? Das war oft schwer zu sagen. Einer der Felsen sah nach menhir aus; ein anderer nach dem flachen Deckstein eines dolmen.
Marie ging bis zu den gelb blühenden Grenzbüschen und schaute hinüber in ihren eigenen Garten. Die Büsche waren hoch, aber natürlich gab es Sichtlücken. Nein nein, es war wirklich ein Glück, durch keine neugierigen Blicke gestört zu werden!
Gedankenverloren zupfte sie eine Blüte ab, die wärmer gelb war als die des Ginsters: eine verlorene Stechginsterblüte. Sie hielt sich die Blüte an die Nase, schloss die Augen und sog ihren Duft ein, der herb und süß zugleich war, ein wenig wie der von Kokos.
Sie würde jetzt hochgehen, in papys altes Schlafzimmer. Sie würde sich überlegen, was sie daraus machen würde – ein Gästezimmer? Ein Arbeitszimmer mit Leseecke und Schreibtisch? Oder beides kombiniert?
Oben im Zimmer war es warm und stickig. Marie öffnete Fenster und Dachluke. Dann wandte sie sich um, zu dem Bettgestell, das wirklich nicht mehr zu gebrauchen war, und seufzte. Noch etwas, das entsorgt werden musste. Aber der Schrank? Besonders schön war er nicht, aber stabil, aus Massivholz.
Sie drehte am Schrankschlüssel, um hineinzusehen, doch der Schlüssel drehte sich nur zur Hälfte. Ungeduldig ruckelte und drückte sie daran herum, bis er doch knackend nachgab. »Mit dem klemmenden Schloss kommst du doch weg«, beschimpfte Marie den Schrank, während sie die schweren Türen aufzog. Sie stieß einen leisen Schrei aus und sprang zurück, dann begriff sie: Die Augen, die sie aus dem Schrank heraus anstarrten, gehörten einer Figur aus bemaltem Holz.
»Was machst du denn im Schrank?«, fragte Marie laut in das leere Zimmer, um auch den letzten Rest ihres Schreckens loszuwerden. »Du bist mir ja eine schöne Heilige, mit der Oberweite«, grinste sie dann. Die dargestellte Heilige war eine junge Frau mit langem blondem Haar und stattlichem Dekolleté. In den Händen hielt sie einen kleinen Turm; ihre Miene hatte einen leidenden Ausdruck. Marie legte den Kopf schief. Es war eine Figur, wie sie in Kapellen stehen, nicht in Wohnhäusern und schon gar nicht in Schränken. Wo die beiden Schranktüren rechts und links der Heiligen zurückgeschlagen waren, sah das allerdings ein wenig wie ein Altar aus. Ein Haus-Altar?
Marie sah von der Figur zu ihrem Sockel; aber es war gar kein Sockel, es war eine Truhe. Eine hölzerne Truhe, mit Eisen beschlagen. Was war darin? Sofort wollte Marie es wissen! Sie hatte keine Lust, die Heilige anzufassen, hob sie aber doch aus dem Schrank, um den Deckel der Truhe zu öffnen. Sie sah hinein. Ha, da waren sie also, die alten Fotoalben! Sie hatte sich schon gefragt, wo Elodie ihre persönlichen Dinge aufbewahrt hatte.
Marie griff nach dem obersten Album. Es enthielt jedoch keine Fotos, das Album entpuppte sich als Mappe mit Zeichnungen.
Auf dem Rand des alten Bettgestells sitzend, blätterte Marie langsam die Zeichnungen durch. Sie waren alle datiert und signiert; Marie konnte den Namen »Elodie Cadiou« entziffern. Es waren Modezeichnungen aus den sechziger Jahren, und Marie hatte ja gewusst, dass ihre Großtante Modemacherin gewesen war, und keine unbekannte. Trotzdem hatte sie nicht gewusst, dass Elodie so gut, so künstlerisch zeichnen konnte. Marie ließ sich Zeit zum Bewundern jedes einzelnen Blattes, bevor sie sich die nächste Mappe holte. Es gab davon in der Truhe, soweit sie es im Halbdunkel des Schrankes erkennen konnte, zwei dicke Stapel.

Marie hatte alles um sich herum längst vergessen. Fasziniert war sie Mappe für Mappe durchgegangen und hatte nebst den Modeentwürfen aus verschiedenen Jahrzehnten die Zeichnungen von Menschen entdeckt – Portraits, die Elodie von Freunden oder Geliebten gemacht hatte, und Aktzeichnungen (die eine oder andere erotische Zeichnung hatte Marie in Verlegenheit gebracht). Aber das, was sie jetzt in den Händen hielt, war anders. Ganz unten aus der Truhe hatte sie diese grün-schwarz eingebundene, an den Kanten beschabte Mappe gehoben. Und die enthielt Bilder von – Heiligenfiguren! Lauter akkurat und aus mehreren Perspektiven gezeichnete Heiligenfiguren! Das fiel nun wirklich aus dem Rahmen. Und dann sah Marie auf das Datum unterhalb einer Signatur. 1943. Sie blätterte weiter. 1943, 1943 … Und da jetzt, 1944 … Aber da war doch Krieg gewesen! Elodie hatte im Krieg Heiligenfiguren gezeichnet? Warum? Und wo? Die stammten garantiert nicht aus einer Kirche, nicht einmal aus einer sehr großen!
Immer erstaunter über die Anzahl der Figuren und die große Präzision der teils mit Aquarellfarbe kolorierten Bilder blätterte Marie den ganzen Stapel durch, war nun fast unten. Da fiel ein kleineres Blatt ihr in die Hände. Sie zog eine Augenbraue hoch. Eine Liste der gezeichneten Figuren. Nach Monaten sortiert. Wie ein Heiligenkalender. Merkwürdig, wirklich merkwürdig.
Sie ließ die Liste sinken und schaute auf die unterste Heiligenzeichnung – heho, das war die Heilige, die vor ihr stand! »Wenn du reden könntest«, warf Marie der Blonden mit der Märtyrermiene bedauernd zu. Dann hob sie die Zeichnung hoch, um sie ins Licht zu halten. Da entdeckte sie, dass doch noch ein letztes Blatt unter ihr verborgen gewesen war. Mit spitzen Fingern nahm sie das Werk aus der Mappe und sah es sich mit gerunzelter Stirn an.
Das war kein Heiliger gewesen. Helle Augen, eine klassisch-gerade Nase, hohe Wangenknochen, ein energisches Kinn. Ja, der Portraitierte war regelrecht schön gewesen – nur – die militärische Mütze mit dem Adlerzeichen darauf, die war doch die eines Deutschen! Marie las hastig das Datum unter der Signatur: 25. Dezember 1943. Weihnachten. Im Krieg! Was hatte Elodie Weihnachten 1943 bei diesem deutschen Offizier gemacht? Hatte er sie gezwungen, ihn zu portraitieren? Aus einer Ahnung heraus wandte Marie das Blatt um. Und da stand es: »Pour mon amour.« Für meinen Geliebten.
Erschrocken ließ sie das Blatt los. Es glitt zu Boden, von wo aus der deutsche Offizier sie höhnisch anzusehen schien. »Nein, das ist unmöglich«, wies Marie sich zurecht und bückte sich nach der schockierenden Zeichnung. Sie verglich die Signatur mit der Schrift auf der Rückseite. Doch ja, dieselbe Schrift, kein Zweifel. Pour mon amour.
»Hier stimmt etwas nicht. Dafür gibt es eine andere, sinnvolle Erklärung«, sagte Marie sich laut, legte fast böse das Portrait zurück in die Mappe, schlug diese zu, warf sie in die Truhe auf den bereits durchgesehenen Stapel, wuchtete die Heiligenfigur darauf, schloss die Schranktüren und drehte den klemmenden Schlüssel. »Nicht zu fassen«, murmelte sie befremdet und beschloss, im Garten Unkraut mit Wurzel auszugraben, anstatt den zweiten Stapel Mappen durchzusehen, der ruhig länger in der Truhe vor sich hinmodern sollte!

Florian hatte die kleinen Straßen genommen. Er hatte die normannische Schweiz kennengelernt, eine Gegend mit sanft geschwungenen Hügeln, weidenden Kühen und Pferden und weiten Aussichten. In der Bucht von Avranches hatte er die berühmte Silhouette des MontSaint-Michel erspäht, jener beeindruckenden Klosteranlage, die auf einer Flutinsel aus Granitfelsen errichtet war und deren höchster Turm wie ein Pfeil in den lichtdurchfluteten Himmel geragt hatte. Dann war er entspannt die Bucht von Cancale entlang gefahren, hatte die alten Windmühlen an den Straßenrändern ebenso bestaunt wie in den kleinen Badeorten die phantasievollen Villen mit ihren Aussichtstürmchen und den großen Balkons. In Saint-Malo hatte er auf der hohen Altstadtmauer gesessen und ein riesiges Eis gegessen, mit Blick auf das glitzernde Meer mit den kleinen Granitinseln darin, bis – und das war ein Schock gewesen – eine große Sturmmöwe ihn attackiert und einen Teil seiner Eiswaffel erbeutet hatte. Zwei äußerst hübsche Bretoninnen hatten ihn gefragt, ob alles »bien« sei; und er hatte die Hürden der Sprachlosigkeit empfunden und kein vernünftiges Wort den beiden Schönen gegenüber herausgebracht.
Später am Tag hatte es dann noch einen Schrecken gegeben, als er die – zumindest kostenfreie – bretonische Autobahn benutzt hatte, aber dafür mit mehr als hundertzehn Kilometern pro Stunde über der Schlucht von Saint-Brieuc geblitzt worden war. Sorry nochmals, Boris. Seitdem fuhr er wieder auf kleinen Straßen; zu weit nördlich, er wusste es, aber er hatte ja Zeit; und die Aussichten, die er soeben genoss, waren atemberaubend. Die ganze Steilküste und die ihr vorgelagerten Inseln, alles war aus rosa Granit! Im goldenen Abendlicht erglühte der Stein fast orangefarben. Die Versuchung auszusteigen, sich auf einen der orange-rosa Felsen zu setzen und den Sonnenuntergang zu erwarten, war schon groß. Aber er widerstand ihr; er wollte nicht erst spät in der Nacht in Mengleuff ankommen.
Andererseits hatte er Zeit genug, um die Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Fortan fuhr Florian langsam, langsamer als erlaubt, und den einen oder anderen Fahrer hinter ihm nervte das. Die meisten überholten ihn einfach und gut war’s. Aber irgendwann war da dieser eine, der sich auf das Lichthupen versteifte. Florian war empört und fuhr erst recht nicht schneller. Da setzte der Hintermann im großen Renault endlich zum Überholen an. Shit. Der Renault blinkte nach rechts, als Signal, auch Florian solle an den Rand fahren. Es war ein Auto der Gendarmerie. Florian blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Er hielt hinter dem Polizeiwagen, und prompt stiegen aus dem gleich zwei Gendarme aus. Florian ließ resigniert die Seitenscheibe herunter.
»Vos papiers!« Der eine der beiden war an sein Fenster getreten und streckte fordernd die Hand aus.
»Sorry, but I wasn’t too fast«, stellte Florian klar, beugte sich aber trotzdem zu seiner Tasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Durch das Beifahrerfenster schaute nun der zweite Gendarm in den Cayenne, mit verschränkten Armen, in einer selbstgefälligen Pose. Florian konnte nicht umhin, den Mann halb amüsiert, halb verächtlich anzugrinsen – was der überraschenderweise erwiderte.