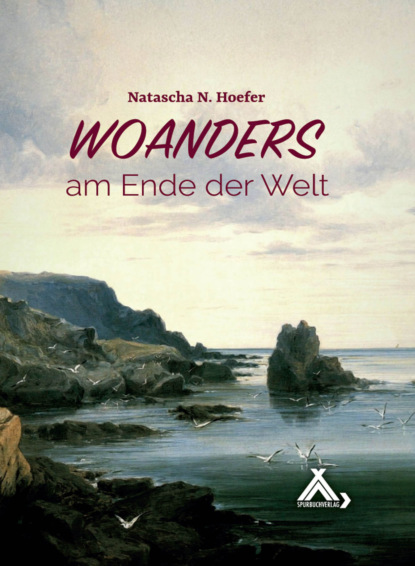- -
- 100%
- +
Der Gefechtslärm ist jetzt weit weg. Die Frauen legen sich wieder auf ihre Liegen. Doch an Schlafen ist nicht zu denken. Sie warten. Horchen in die Nacht und warten.

Irgendwann, Marlene weiß nicht, wie lange sie so lagen, reißt Rosen die Tür auf. Draußen ist es dämmrig, ein neuer Tag beginnt.
»Alles wieder ruhig«, versichert Rosen. Ein Versuch der feindlichen Armee, am Strand von Dieppe zu landen, sei erfolgreich abgewehrt worden.
Keine der Frauen lächelt den attraktiven Marinesoldaten an. Nicht nur Marlene ist Rosen nach dem Schuss auf den unbewaffneten Soldaten unheimlich geworden.
»Die Eisenbahnpioniere sorgen dafür, dass es weitergeht, meine Damen«, sagt Rosen aufmunternd und lässt sie unter sich.
Schon bald ruckt der Waggon an, die Fahrt geht weiter. Marlene und Gisela schauen wieder durch ihr Guckloch am Fenster; doch die Landschaft kommt ihnen nicht mehr so schön vor wie am Tag zuvor.

21. August 1942. Der Zug steht im Bahnhof von Brest. Requirierte Lastwagen stehen zur Weiterfahrt bereit. Marlene hat in den sechs Tagen im Eisenbahnabteil den Vorteil eines Koffers zu schätzen gelernt. Gisela muss mehrmals am Tag ihren Seesack komplett auslehren, weil das, was sie sucht, wieder ganz nach unten gewandert ist. Marlene hat in ihrem Koffer ihre penible Ordnung problemlos wahren können.
Die Frauen besteigen die Ladefläche eines Renault-Lastwagens. Marlene setzt sich auf ihren Koffer. Die LKW-Plane ist an den Seiten aufgerollt. Der Fahrer ist ein grobschlächtiger Matrose, der sich als Robert vorstellt. »Auf geht’s in die Sommerfrische«, ruft er. Rosen setzt sich auf den Beifahrersitz und die Fahrt geht los.
Es ist merkwürdig still um sie herum, merkwürdig friedlich. Die Geschehnisse der Reise scheinen wie weggewischt, dieser Aufbruch hat wirklich etwas von einer Fahrt in die Sommerfrische. Marlene kann sich an der neuen Umgebung nicht satt sehen. Wie gut tut es, die Meeresluft einzuatmen, nach der stickigen Luft des Zugabteils! Sie staunt, als sie die Granitfelsen sieht, schwarz und zerklüftet, denn sie fahren auf einer Küstenstraße oberhalb des fremden Meeres entlang. Das also ist der Atlantik!
Die Lastwagen fahren im Konvoi in Richtung einer Halbinsel namens Crozon. Marlene freut sich fast wie ein Kind, als die Lastwagen nach einigen Kilometern auf eine Fähre auffahren. Eine Schifffahrt! Danach geht es wieder auf einer Küstenstraße weiter. Plougastel, liest Marlene auf einem Ortsschild. Sie weiß nicht, wie der fremde Name ausgesprochen wird. Loperhet, Daoulas; nach Le Faou ist die Landstraße bald von dichtem Wald umgeben und wird kurvig und eng. Plötzlich fährt der Konvoi aus dem Wald heraus auf eine lange Hängebrücke. Der Fluss tief unter ihnen glitzert in der Sonne.
»Was ist das für ein Fluss?«, fragt Marlene laut.
Gisela beugt sich seitlich über die Ladefläche des Lastwagens. »Robert, was ist das für ein Fluss?«, ruft sie.
»Aulne, der fließt in die Bucht von Brest. Das ist die Bucht, an der wir entlangfahren«, dröhnt Robert zurück.
Hat er »Olln« gesagt? Oll findet Marlene den Fluss unter ihr gar nicht. Sie muss lachen.
»Voilà, die Halbinsel Crozon«, verkündet Robert laut, als sie auf der anderen Seite der Brücke angekommen sind.
Marlene ist nicht die einzige, die von der Fahrt durch die fremde Landschaft regelrecht berauscht ist. Die Sonne brennt; links erhebt sich jetzt ein rundlicher Berg, laut Robert der Ménez-Hom, Möwen schreien über ihnen, obwohl sie inzwischen auf dem Festland der Halbinsel sind und sich von der Küste weiter entfernen. Nach einiger Zeit nähert sich der Konvoi einem Ort, sie sehen Häuser und darüber einen spitzen Kirchturm.
»Telgruc, Ihr Kurort, meine Damen«, ruft Robert, als er am Rande des Dorfes anhält.
»Absitzen«, befiehlt Rosen.
Zwei Baracken an der Straße. Es riecht nach frischem Holz und Teer. Ein paar junge Männer in Zivil, sehr einfach, fast armselig gekleidet, stehen vor dem Eingang der rechten Baracke. Es müssen Einheimische sein, Kriegsgefangene.
»Allez, Allez!«, ruft Rosen.
Die Kriegsgefangenen kommen zögernd näher. Marlene sieht, dass einer klobige Holzschuhe an den Füßen trägt.
»Vite, vite«, schnauzt Rosen die fremdartigen Gestalten an.
Diese ergreifen die Gepäckstücke der Frauen. Marlene hält zögernd ihren Koffer fest, als einer, mehr Junge als Mann, auf sie zukommt.
»S’il vous plaît, Mademoiselle«, sagt der Junge, seine Stimme klingt sanft.
Marlene schaut ihm in die schwarzen Augen und lässt unwillkürlich den Koffer los.
»Vite«, brüllt Rosen und stößt dem Jungen den Kolben seines Karabiners in den Rücken.
Erschrocken und empört sieht Marlene Rosen in das Gesicht und in seine kalt glänzenden Augen. Der Leutnant zieht die Mundwinkel spöttisch nach unten und wendet sich ab. Schnell schaut Marlene zurück zu dem jungen Mann mit ihrem Koffer. Der hat sich einige Schritte von ihr entfernt, dreht sich plötzlich zu ihr zurück – und zwinkert ihr zu.
Florian zuckte zusammen. Jemand klopfte vehement an die Haustür. Der Verwalter? Und er war noch im Bademantel! Egal, er sprang auf.

Der Mistkerl war groß, Marie musste zu ihm hochschauen, aber ansonsten war er eine jämmerliche Erscheinung: unrasiert, ungekämmt, blaue Ringe unter müden Augen, die ganze Gestalt in einen vertrieften Bademantel gehüllt. Dass der Jammerlappen sie seinerseits vom Kopf bis zu den Füßen taxierte, machte Marie nur noch wütender! Na und? Dann trug sie eben ihren ausgelutschten Pyjama und die alten charantaises an den Füßen! »Was fällt Ihnen ein, meine Blumen zu töten?«, barst es aus ihr heraus.
Die erschrockenen Augen des Typs weiteten sich. Auch das noch, der konnte nicht einmal Französisch! Marie kramte aus den Kammern ihres Gedächtnisses nach passenden deutschen Worten. »Sie haben getötet meine hortensias!«, fuhr sie den Dreckskerl an und zeigte hinter sich, Richtung Tatort.
Der Deutsche reckte sich, um über sie hinwegzuspähen, behauptete aber: »Ich verstehe nicht.«
Aber dass der sich dumm stellte, kam gar nicht in Frage! Entschlossen packte Marie den Mann am Ärmel und zog ihn hinter sich her, quer über den Hof bis zu ihrer Hausecke mit dem Desaster. »Voilà«, stieß sie traurig triumphierend hervor. Doch der Typ gab sich aalglatt und zuckte die Achseln, als würde ihn das alles nichts angehen! So nicht, dachte Marie und packte ihn erneut am Ärmel, um ihn zu seiner Protzkarosse zu ziehen, auf deren Kotflügel die abgerissenen Blüten für sich sprachen. Und endlich zeigte der Hortensienmörder ein Lebenszeichen: »Oh nein!«, rief er aus, »das war es also! Oh nee, Scheiße …« Und er streichelte dem Kotflügel die Blüten herunter – um nach Kratzern im Lack zu suchen!
Das war Marie zu viel. »Heho, das dicke Auto lebt, aber nicht meine hortensias«, brüllte sie, im vollen Bewusstsein dessen, dass sie eben die Kontrolle verlor.
Der Deutsche richtete sich auf und sah plötzlich gar nicht mehr hilflos aus wie ein Kaninchen. »Jetzt schreien Sie nicht so«, schrie er zurück, »das ist gestern Nacht passiert, es war dunkel ohne Straßenlaternen, ich habe das nicht gesehen!«
»Nicht gesehen? Und das? Mein Haus? Sie haben es auch nicht gesehen, vielleicht? Sie sind fast gefahren in mein Haus! Fast in mein Haus gefahren«, korrigierte Marie ihre Wortstellung und spie noch aus: »Eh, merde!«
»Das stimmt, ja, oh Mann, das war knapp … Wenn dem Cayenne was passiert wäre …«
»Ho, la pauvre Cayenne, das arme, arme Auto!«, Marie äffte übetrieben einen mitleidigen Tonfall nach, dann fixierte sie den Saukerl gnadenlos und brüllte: »Und meine hortensias?« Sie ballte die Fäuste und stampfte auf.
Der Fremde hob abwehrend die Hände. »Das ist eben blöd gelaufen, das kann schon mal passieren, auf so einem engen Feldweg …«
»Das ist kein enger Feldweg, das ist die alte Straße! Und sie ist nicht eng für normale Autos; nur für Panzer!« Marie schnappte nach Luft. Ha, sie war stolz darauf, sich an dieses Wort zu erinnern: Panzer, das hatte sie von Paul gelernt, dessen Brüder in der Résistance gekämpft hatten, gegen feindliche Panzerfahrer wie diesen!
»Was reden Sie da von Panzern?«, fragte der Fremde halb erschrocken, halb irritiert. »Wir sind nicht mehr im Krieg, seit 1945! Aber es tut mir aufrichtig leid, dass ich Ihre Hortensien angefahren habe, und ich werde Ihnen den Schaden bezahlen.«
Marie presste die Lippen zusammen, ehe sie verkündete: »Ich weiß nicht, wie das ist in Ihrem Land, aber hier in der Bretagne denken die Menschen nicht, alles ist mit Geld zu bezahlen!« Sie wandte sich ab. Dass ihr die Tränen gekommen waren, durfte der bescheuerte Deutsche nicht sehen. Ihre geliebten Hortensien! Wenn der wüsste, was sie ihr bedeuteten … Aber so einem wie dem da war das doch egal!
»Ist ja dramatisch«, ließ der Deutsche jetzt fallen, »aber Ihre Hortensien wachsen wirklich ganz schön in den Fahrweg hinein…«
»Sie wollen sagen, ich bin schuld?« Marie fuhr noch einmal herum. Das war nun wirklich … Sie rang nach Luft, dann stieß sie aus: »Meine Hortensien haben das Recht, in diesem Land, das ist ein freies Land, in Freiheit zu wachsen – en liberté, c’est clair? Wenn Sie noch einmal eine Blüte mit ihrem Panzer berühren, dann …« Sie blitzte ihn drohend an und ließ ihn stehen. »Grand niais germanique«, fauchte sie noch vor sich hin (großer germanischer Trottel) und wischte sich wütend die Tränen fort, egal, ob er das sehen würde oder nicht.

Da hatte Olivier wohl Recht, mit seiner Warnung vor bretonischen Zicken, sagte Florian sich bitter. So ein Konflikt hatte ihm gerade noch gefehlt. Aber hatte sie geweint, als sie gegangen war? – Unmöglich. Und wenn, dann bloß aus lauter Wut. Gift und Galle war sie gewesen, eine Furie!
Er brauchte jetzt eine Dusche. Ob die Badewanne dreckverkrustet war oder nicht, war ihm egal, er musste jetzt duschen!
Während er in zusammengekauerter Körperhaltung unter der Dachschräge hockte und das ganze Bad vollzuspritzte (musste ja ohnehin geputzt werden), ging Florian wider Willen die Nachbarin nicht aus dem Kopf. Was hatte die gehabt, das war doch eine totale Überreaktion von ihr gewesen? Aber natürlich war es blöd, dass das mit den Hortensien passiert war. Nur mal ehrlich, was sollte er tun, wenn sie nicht zumindest seine materielle Entschädigung annehmen wollte? Und sie hätte ihn wirklich nicht derart anschreien müssen!

Der Verwalter kam nicht, und Florian bekam Hunger. Die Mittagszeit war längst rum, und er musste irgendwoher etwas zu essen beschaffen. Außerdem machte es ihn halb wahnsinnig, dieses Warten. Er würde jetzt einen Rundgang durch Mengleuff machen.
Er verließ das Haus und folgte dem Feldweg (oder der alten Straße, wie die Furie den sagenhaften Weg also nannte), in entgegengesetzte Richtung ihres Hauses. Der eigentliche Dorfkern lag wohl rechts von ihm, lauter Feldsteinhäuser mit ummauerten Höfen, auf unübersichtliche Weise ineinandergeschachtelt; sein Weg aber, die famose alte Straße, führte ringförmig um diesen Dorfkern herum.
Florian hatte das Dorf fast komplett umrundet, als er es vorzog, umzukehren; bis zum Haus der Furie wollte er nicht gehen! So kam er ein zweites Mal an einem Haus vorbei, das bereits zuvor seine Aufmerksamkeit erregt hatte, und blieb davor stehen. Dieses Gebäude war nicht besonders schön mit seinem grauen Verputz, der an der Schlechtwetterseite rötlich verfärbt war; aber der Garten … Ein reines Meer von Farben und Düften, von Blumen und blühenden Sträuchern! Und um das alles noch pittoresker zu machen, erschien nun eine alte Dame mit einem Eimer, aus dem sie Korn unter ihre frei umherlaufenden Hühner warf.
Die Dame war alt, aber hellwach. Obwohl Florian keinen Laut von sich gegeben hatte, hatte sie ihn sofort entdeckt. »Degemer mat«, sagte sie und trat an das Gartentor.
»Wie? – Äh, bonjour«, gab Florian zurück.
»Je peux vous aider?«, fragte die Alte.
»Do you speak English?«, versuchte es Florian.
Die Alte lachte und machte eine abwehrende Handbewegung.
»Hm, supermarché?«
Die alte Dame sagte etwas von »Telgruc« und »dimanche«, das hieß Sonntag. Das Kopfschütteln dazu sprach für sich.
»Das dachte ich mir«, Florian zuckte resigniert die Achseln.
Nun stellte die alte Dame ihm eine Frage, in der das Wort »habiter« vorkam. »Ich wohne da hinten, là«, Florian zeigte vage in Richtung seiner Unterkunft.
»La maison à côté de celle de Marie? C’est vous, le propriétaire?« Florian blähte die Backen auf. Marie – hieß so seine schreckliche
Nachbarin?
»Attendez, Monsieur«, sagte die alte Dame und wies ihm an, am
Gartentor stehenzubleiben. Was hatte sie vor?
Sie verschwand in ihrem Haus und kam kurz darauf mit einem Eierkarton und einer Flasche Wasser zurück. »Tenez«, sagte sie und hielt ihm beides hin. »Des oeufs tout frais!« Sie strahlte ihn an, ehe sie hinzufügte: »Trista tra ’zo er béd: Eun oaled heb tan, Eun daol heb bara, Eun ti heb maouez2.«
»Wie bitte?«, fragte Florian zurück. War diese Sprache etwa Bretonisch gewesen?
»Pour vous, pour vous! Ah, attendez!«, rief die alte Dame, schlug sich an die Stirn und verschwand noch einmal in ihrem Haus. Was jetzt noch, fragte Florian sich und musste lächeln. Als seine Wohltäterin eine Untertasse mit einem großen Stück Butter auf dem Eierkarton platzierte, hatte er Mühe, seine Gaben festzuhalten.
»Du bon beurre, du beurre breton! Ça ira?«, fragte seine neue Bekannte.
Brot, Ein Haus ohne Frau.
»Klar, ça va«, grinste Florian. Er wollte der alten Dame vorschlagen, ihre Lebensmittel zu bezahlen. Doch dann fielen ihm die Worte dieser Marie ein: »In der Bretagne denken die Menschen nicht, alles ist mit Geld zu bezahlen!« Starker Spruch, echt bühnenreif, dachte Florian ironisch. Trotzdem wollte er nicht noch einmal ins Fettnäpfchen treten. Also sagte er nur: »Merci, merci beaucoup. Hm, à propos: Je m’appelle Florian Reinart.«
»Moi, c’est Yvonne Le Roux«, gab die alte Dame heiter zurück. Sie winkte ihm zu und fuhr fort, ihre Hühner zu füttern.
Yvonne Le Roux. Ein warmes Gefühl stieg in Florian auf. Es gab also doch auch freundliche Nachbarinnen in der Bretagne.
Zurück in Boris’ Küche, drehte Florian todesmutig am Verschluss der Gasflasche – er hatte keine Erfahrung damit – und schaffte es, eine Herdflamme zu entzünden. Das war schon mal etwas. Dann machte er sich Rührei, in Butter gebraten. Er fragte sich, was Yvonne Le Roux ihren Hühnern zu fressen gab, ein so orange-gelbes Eigelb hatte er noch nie gesehen. Die Butter schmeckte salzig, und das nicht wenig. Das war praktisch, so musste er nicht würzen, und Gewürze gab es nicht in Boris’ famosem Ferienhaus. Als Nachtisch aß Florian von den leckeren Frühstückskeksen. Danach holte er sich den Bretagne-Reiseführer und setzte sich hinter das Haus in den Garten. Gartenstühle gab es nicht, aber einen Felsstein, dessen glatte Oberfläche zum Sitzen einlud.
Florian reckte sich und ließ den Blick schweifen. Aus dem Grundstück konnte man etwas machen, fand er. Es war groß, mit Wildblumen und diesen interessanten Felsbrocken hier und da im hohen Gras. Um den Garten herum lief eine uralt aussehende Mauer aus Feldstein, die, wie die Rückseite des Hauses, teilweise mit Efeu, Rosen und Brombeerzweigen überrankt war. Nur zum Nachbargrundstück hin (zum Glück war nichts von der Kratzbürste zu sehen!) ersetzten blühende Ginsterbüsche und pieksige Stechginsterbüsche die Umfriedungsmauer. Auch das Haus, so ungepflegt es war, war an sich ein reizvoller historischer Bau. Es war ein Fehler, es so herunterkommen zu lassen. Das Ensemble hier könnte ein kleines Idyll sein. Das musste man der Furie von drüben lassen, ihr Haus mit dem Garten und dem alten Nebengebäude war ein kleines Idyll.
Florian seufzte und öffnete den Reiseführer. Crozon waren mehrere Seiten gewidmet. Steilklippen und Grotten, Strände und Fischerorte mit bunten Häusern, die Fotos sahen vielversprechend aus. An einem davon blieb sein Blick hängen. Es zeigte eine Hafenansicht; in den Hafen hinaus führte eine schmale Landzunge, die das Hafenbecken schützend umschloss. Auf der Landzunge standen eine kleine Kapelle und ein blockartiger historischer Wehrturm aus rotem Stein. Der Ort hieß Camaret-sur-Mer. Der Reiseführer sprach auch von einem hervorragenden Fischrestaurant, Chez Philippe.
Florian schlug den Reiseführer zu. Die Möwen kreischten über ihm und sprachen von der Nähe des Meeres. Es war ein herrlicher Sommertag, und er hatte keine Lust, länger auf den Verwalter zu warten.

»Ah, du lebst noch.« Wie zu erwarten, hörte Isabelle sich am anderen Ende der Leitung pikiert an.
»Mehr oder weniger, ja. Aber es geht mir nicht gut«, gab Marie aufrichtig zurück und reckte sich dabei, das Telefon am Ohr, um durch das Fenster Richtung Ginsterhecke zu sehen. War er im Garten? Von hier aus sah sie es nicht. Verdammt, sie wollte in den Garten, aber nicht, wenn der bescheuerte Deutsche in seinem war!
Isabelle seufzte hörbar. »Ich kann mir denken, dass du am Boden zerstört bist. Nach all den Jahren, in denen du gehofft hast … Willst du mir endlich alles erzählen?«
»Euh – nein. Ich – kann noch nicht darüber reden, ohne die Fassung zu verlieren und so weiter. Deshalb konnte ich mich auch bei niemandem melden, nicht mal bei dir. Aber ich spüre, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um wieder ein bisschen unter Menschen zu gehen. Du fehlst mir. Wollen wir nicht ausgehen? Den Sommerabend genießen, etwas Leckeres essen … Ich lade dich ein!«
»Bei dir, in deinem neuen alten Haus?«
»Lieber ein anderes Mal; ich würde gern wegfahren. Wie wär’s?« Nachdem Isabelle zugesagt hatte, fühlte Marie sich erleichtert.
Heute Abend würde sie nicht in dumpfem Brüten versacken, sie würde mit ihrer Freundin lecker essen gehen, und vorher, jetzt gleich, würde sie schwimmen!
Die Küste lag zwei Kilometer von Mengleuff entfernt, Marie war die Strecke schon zu Fuß gegangen, aber heute hatte sie Lust auf Fahrtwind. Auf ihrem alten Rennrad strampelte sie eilig am Nachbarhof vorbei (er war irgendwo da; das Drecksauto parkte an derselben Stelle im Hof wie am Morgen), dann ging es den Hügel hoch und aus dem Dorf hinaus. Sie erreichte die Kuppe, von hier an ging es nur noch abwärts. Vor sich, oder genauer unter sich, sah sie das Meer; es war, als würde sie mit dem Fahrrad gleich von der Landstraße abheben und über den Ozean fliegen …
Plötzlich war das Auto hinter, jetzt direkt neben ihr – Marie schwenkte nach rechts, bremste, konnte dem Graben eben noch ausweichen … Schwer atmend stand sie und schaute dem Auto nach, das sie fast von der Straße gedrängt hatte. Natürlich, ein silberner Porsche Cayenne … War das Absicht gewesen?! »Das geht zu weit! Wir sind nicht wirklich im Krieg«, rief sie ihm nach. Dann atmete sie tief durch und fuhr weiter.
Der Cayenne parkte auf ihrem Parkplatz. Wütend kettete Marie ihr Fahrrad an einer Aussichtsbank fest. Aber klar war er hierhergefahren. Alle parkten hier, die zum Strand der großen Bucht wollten. Zum Glück lag ihre Lieblingsbucht woanders.
Marie folgte dem Küstenwanderweg, der an dem Parkplatz losging. Zwischen Heidekraut und Ginster wand er sich am Abgrund entlang. Nach einem knappen Kilometer bog sie auf den schmalen Pfad ab, der die Steilküste hinunterführte, zu einer kleinen, geschützten Bucht. Kaum jemand hatte Lust, das Strandzeug bis dorthin zu schleppen. Für gewöhnlich hatte Marie ihre Bucht für sich alleine. Umso größer der Schock, als es heute anders war.
Entgeistert starrte Marie auf das männliche Wesen, das in einigen Metern Entfernung arglos auf dem Bauch lag und sich die Sonne auf die blasse Haut knallen ließ. – Langsam und leise trat sie den Rückzug an. Sie war lange nicht mehr in der großen Bucht schwimmen gewesen, vielleicht doch keine schlechte Idee, für einmal. Aber nur für einmal! Das ging nicht an, dass dieser Deutsche hier auftauchte, sich an ihren Hortensien verging, sie selbst fast umfuhr mit seinem Panzer, dann ihre Bucht in Besitz nahm und sie obendrein zur FKKZone erklärte!

Florian war begeistert. Obwohl der Autositz im sonnenverbrannten Rücken sich nicht angenehm anfühlte, genoss er seine erste Erkundungsfahrt über die Halbinsel Crozon. Diese Landschaft, er war dabei, sich in sie zu verlieben! Diese Ausblicke auf das Meer! Immer, wenn man es wiedersah, hatte es eine andere Farbe, leuchtendes Türkis, tiefdunkles Blau oder Hellblau mit weißer Schaumkrone. Hinter jeder Kurve konnte es auftauchen, die Küste war so zerklüftet. Mal führte die gewundene Straße auf einen Hügel, mal hoch hinauf auf die Steilküste, dann wieder talwärts direkt an den Meeresrand, zu größeren oder kleineren Stränden. Felsnasen rahmten sie ein, weit streckten sie sich vor in die See. Hier und da tauchten Granitinselchen zwischen den Wellen auf. Es war schön, einfach schön!
Und nicht nur die Landschaft sprach Florian an, auch die Architektur. Hier standen wirklich überall alte, teils uralt aussehende Häuser aus bräunlichem Feldstein, erfrischend wenig oder gar nicht modernisiert. Die meisten hatten dunkelgrau-glänzende Schieferdächer, wenige waren strohgedeckt. Alle hatten sie hölzerne Fenster und Türen, die im Kontrast zu den Farben des Steins und des Schiefers in kräftigen Farben gestrichen waren. Und genau so ein Haus hatte Boris! Und er machte nichts daraus! Nein wirklich, das konnte er nicht verstehen. Er würde die Läden an Boris’ Haus übrigens blau streichen. Ein intensives Mittelblau, ähnlich wie an dem Haus der unmöglichen Nachbarin. Geschmack hatte die Frau schon, das ja. Aber Geschmack ist in manchen Fällen nicht alles.
Jetzt fuhr er eine steile Anhöhe hinauf und vorbei an zwei Ortsschildern: das obere war auf Französisch, das untere auf Bretonisch. Bretonisch hieß Camaret also Kameled. Dann bremste Florian abrupt, denn die Aussicht, die sich jenseits der Hügelkuppe vor ihm auftat, war überwältigend. Tief unter ihm lag der Hafen, wie aus der Vogelperspektive sah man auf ihn, mit seinen weißen Segelchen auf dem tiefblauen Wasser und mit einem roten Punkt, das musste der Wehrturm aus dem Reiseführer sein, und daneben, ganz winzig, ein graues Kirchlein …

Marie und Isabelle fielen sich vor dem Chez Philippe in die Arme. Ach, es war doch schön, sich wiederzusehen! Sie setzten sich an einen Tisch auf der Terrasse, und als der Kellner kam, bestellte Isabelle Kir mit Cidre als Aperitif.
»Warum das? Gibt es etwas zu feiern?«, fragte Marie.
»Natürlich«, erwiderte Isabelle vergnügt. »Das Leben ist schön, besonders, wenn man seine beste Freundin nach langer Zeit wiedersieht und sie eine richtige Entscheidung getroffen hat. Aber ich weiß schon, du kannst oder willst nicht darüber reden, du freie Frau!«
Marie musste wider Willen lachen. Isabelle war wunderbar. Sie strahlte ihre eigene Heiterkeit aus und einen schier unermüdlichen Optimismus.