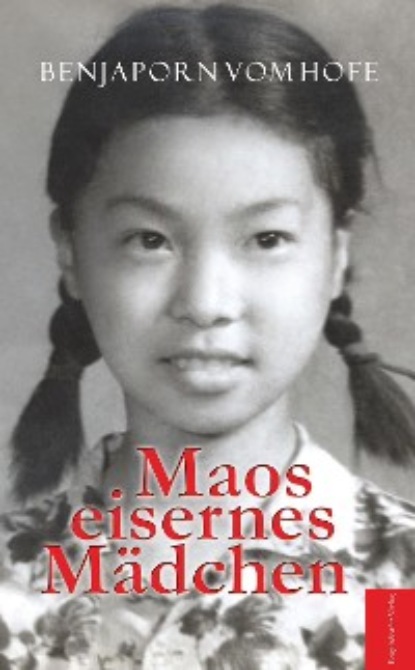- -
- 100%
- +
Ein anderes Mal hatten mein Bruder und ich unbedingt mit einem vorbeifahrenden Kutscher mitfahren wollen. Der Kutscher, ein fröhlicher Bauer, ging dann auch darauf ein und erlaubte uns, bis zum nächsten Dorf mitzufahren. Wir saßen stolz oben auf dem Wagen, der voll beladen war mit allen möglichen Getreidesäcken und mit uns über die unebenen Landstraßen holperte, vorbei an den Maisfeldern, kleinen Teichen und einsamen Gehöften. Unser Weg führte über mehrere kleine Brücken und Bächlein. Das alles war für uns Großstadtkinder faszinierend, die ganze Gegend so malerisch schön. Wir schauten neugierig umher und kamen aus dem Staunen nicht heraus. Wir genossen nach Herzenslust den goldenen Überfluss der Welt: die herrliche Landluft, den Duft des Getreides, selbst den Geruch des Viehmistes. Darüber vergaßen wir vollkommen die Zeit und verloren schließlich das Gefühl dafür, dass wir uns schon recht weit vom Haus unserer Großeltern entfernt hatten. Erst am späten Abend kamen wir endlich auf dem gleichen Weg wieder nach Hause zurück, wo unsere Großeltern und Onkel schon unruhig, ja fast verzweifelt am Dorfrand auf uns gewartet hatten.
Diese Erlebnisse waren mir sofort wieder in Erinnerung gekommen, als mein Vater von Großmutters Besuchsabsicht geredet hatte. Endlich war’s dann soweit. An einem frühen Sommertag sollte die lange und sehnsüchtig erwartete Großmutter ankommen. Mein Vater fuhr mit mir zum Bahnhof, um sie abzuholen.
Als wir sie auf dem Bahnsteig in Empfang genommen hatten, machte mein Vater zu meinem Erstaunen aber überhaupt keine Anstalt, unseren Besuch sofort nach Hause zu bringen. Er steuerte vielmehr einen leeren Platz unter einem Baum vor dem Bahnhof an und verhielt sich damit für mich völlig unbegreiflich und sonderbar. Er legte dann Zeitungspapier auf dem Boden aus und bat meine Großmutter sich dort hinzusetzen. Mir erklärte er nur, er habe etwas Wichtiges mit Oma zu besprechen, ich möge sie deshalb für kurze Zeit allein lassen und in seiner Sichtweite doch ein bisschen spielen. Ich sah ihn etwas ungläubig und irritiert an, verstand die Situation überhaupt nicht und wollte natürlich dabei bleiben und auch hören, was denn für wichtige Angelegenheiten mein Vater mit der Oma zu bereden hätte. Doch mein Vater schaute mich ernst an wie ein General, dessen Befehlen man unbedingt zu gehorchen hatte. Und so fügte ich mich als gehorsame Tochter und entfernte mich.
Unwillig ging ich zum nächsten Baum, wollte mich dort allein beschäftigen, summte vielleicht ein Liedchen, spielte mit einem Zweig herum, grub in der Erde oder zeichnete irgendetwas in den Boden, erfasste einen kleinen Baumstamm wie eine Stange und drehte mich um ihn im Kreis. Immer wieder schweifte mein Blick in Richtung meines Vaters, der mit ernster Miene meiner Großmutter gegenüber saß und ständig zu reden schien, wobei er eine Zigarette nach der anderen rauchte. Meine Oma hörte offensichtlich aufmerksam zu, und ab und zu wischte sie sich mit ihrem Ärmel die Augen. Ich konnte leider nicht hören, worüber sie redeten, doch den ernsten Gesichtern der beiden konnte ich ablesen, dass es sich wohl um ein besonders schwieriges und ernstes Thema handeln musste.
Ich hörte mit meiner Spielerei auf und lehnte mich nur noch an meinen Baum, um die beiden noch genauer beobachten zu können. Meine Oma saß mit dem Rücken zu mir im Schneidersitz mit gekreuzten Füßen, ihre beinahe noch weißen Schuhsohlen stachen mir in die Augen. Offenbar trug sie ein Paar neue Schuhe, weil die Sohlen noch nicht gedunkelt waren. Und sie hatten eine zierliche nußartige Form, vorne spitz, hinten rundlich. Großmutter hatte mir einmal gesagt, dass sie schon seit vielen Jahren, seit die herkömmliche Sitte des Füßebindens verboten worden war, ihre Füße nicht mehr so fest band wie früher und diese damit ein wenig größer geworden waren, obwohl sie immer noch winzig schienen. Selbst meine Füße, so mein Eindruck, waren noch größer als ihre. Einmal hatte sie mir auf meine Bitte hin ihre Füße gezeigt. Schön waren die wirklich nicht mit den vorne krummen, verbogenen Zehen und dem hinteren ziemlich dicken, geschwollenen Teil, der wie eine Kugel aussah. Doch die Füße waren ihr ganzer Stolz, so hatte sie mir erzählt. Mit sechzehn Jahren war sie wegen ihrer besonders winzigen Lotosfüße gerühmt worden, und ihr Ruf als schönfüßige Frau war sogar in die Nachbardörfer gedrungen. Wen wundert es da, dass die Ehevermittlerinnen die Türschwellen ihres Elternhauses beinahe plattgetreten hatten! Jede von ihnen hatte damals um ein Muster ihrer Schuhsohlen als Beweis dafür gebeten, dass die Oma damals in der Tat wunderschöne winzige Füße hatte, und hatte dies immer in Familien mit heiratsfähigen Söhnen gezeigt. Zuletzt hatte ihr Vater, also mein Urgroßvater, einen Sohn aus einer mittelreichen Bauernfamilie als Prinzen auserwählt, und so war meine Großmutter eines Tages in einer Sänfte, deren Vorhänge mit Mandarinentenpärchen und Blüten geschmückt waren, ins Haus meines Großvaters getragen worden. Als die Braut dann aus der Sänfte gestiegen war, hatten alle ihre Blicke auf deren Füße geworfen (ihr Gesicht war ja noch mit einem roten Tuch bedeckt). Erst nach dem Ritual aller möglichen Verbeugungen vor dem Himmel und vor der Erde, vor dem Altar der Vorfahren, vor den Schwiegereltern, vor sämtlichen Verwandten und nach dem gegenseitigen Verbeugen der beiden Brautleute sowie anderen feierlichen Zeremonien hatte dann mein Großvater das Kopftuch seiner Braut heben dürfen und sie zum ersten Mal sehen können. Das gleiche war in diesem Augenblick auch meiner Großmutter widerfahren: Erst jetzt hatte sie ihren künftigen Mann zum ersten Mal gesehen. Doch selbst in diesem Moment hatte sie sich damaliger Sitte gemäß verhalten und sich geniert, hatte ihrem Mann nicht direkt ins Gesicht schauen können und verschämt ihre Augenlider gesenkt. So war das früher gewesen, und keineswegs nur bei den Großeltern, erfuhr ich nun. Man hatte nicht geheiratet, weil man sich kennengelernt und verliebt hatte, sondern man hatte sich eben erst nach der Heirat lieben gelernt. Und im Grunde waren meine Großeltern ein durchaus glückliches Paar, obwohl sie das doch nie ausgesprochen hatten. Jedenfalls so viel ich wusste, auch sagte mir das mein Gefühl.
Meine Gedanken waren vorübergehend ganz in Erinnerung an Großmutters Lebensgeschichte versunken. Doch jetzt schaute ich wieder hinüber zu meinem Vater, der immer noch auf die Großmutter einredete, und dachte, wann die beiden endlich fertig wären mit ihrem ernsten Gespräch, wann es endlich nach Hause gehen würde. Denn so langsam spürte ich meinen Magen knurren. Mein Vater schien meine Ungeduld bemerkt zu haben und rief mich zu ihnen. Meine Großmutter öffnete ihr mit einem Tuch umspanntes Gepäck und holte eine große Tüte mit geschälten und sogar gerösteten Erdnüssen heraus. Mein Vater ergriff eine Handvoll davon und steckte sie in meine Jackentasche. Und damit schickte er mich erneut zum Spielen in seiner Nähe fort. Die wichtige Unterredung hatte also doch immer noch kein Ende gefunden. Ich setzte mich wieder unter meinen Baum und begann, die Nüsse zu essen. Als ich die ganze Portion verdrückt hatte, schaute ich wieder hinüber zu den beiden, die immer noch einander gegenüber saßen, kaum noch miteinander sprachen, immer wieder sich schweigend ansahen. Mir riss so langsam die Geduld, wann würden wir denn endlich nach Hause gehen? Mein Vater schien sich damit immer noch Zeit zu lassen. Mir blieb nichts anderes übrig, als doch weiter zu spielen und mich selbst zu beschäftigen. Ich tauchte erneut in meine Erinnerungen ein. Was hatte mir nicht die Großmutter alles früher erzählt?
Sie war eine begnadete Erzählerin, und ich hatte ihr gern gelauscht, auch wenn ich manchmal dabei keine aufmerksame Zuhörerin gewesen und manchmal während ihrer Erzählung sogar eingeschlafen war. Das jedoch hatte sie niemals gestört, sie war meist in ihrem Erzählfluss geblieben. Vieles von dem, was sie mir damals erzählt hatte, habe ich erst sehr viel später verstanden. Von ihr hatte ich gehört, dass sie vor der Geburt meines Vaters noch zwei Töchter zur Welt gebracht hatte. Doch diese waren kurz nach der Geburt gestorben, an irgendeiner Krankheit. Großmutter hatte mir auch gesagt, dass sie schlecht von ihren Schwiegereltern behandelt worden sei, denn sie hatten ihr übelgenommen, dass sie keinen Sohn geboren hatte und offenbar dazu nicht fähig war. Erst nachdem dann mein Vater auf die Welt gekommen war, hatte sich ihr Leben qualitativ geändert. Seitdem hätte sie aufatmen können und einen festen Platz in der Familie gewonnen. Jetzt erst hatte man sie als Person wahrgenommen. Ich habe vermutet, dass meine Großmutter meinem Vater vielleicht deshalb sehr dankbar war, weil er die Ursache dafür war, dass ihre Position in der Familie entscheidend gestärkt worden war. Auch hatte sie vielleicht meinem Vater ihr weiteres Glück zugeschrieben, als wenn er ihr den Weg dafür geöffnet hätte, dass sie seit seiner Geburt nur noch Söhne in die Welt gesetzt hatte. Weitere vier Söhne hintereinander hatte sie dann der Familie geschenkt. Und mit der Geburt eines jeden Sohnes war ihre Bedeutung in der Familie gestiegen.
Meinen Großvater hatte man keineswegs zu den Armen zählen dürfen, aber er konnte es sich doch nicht leisten, mehrere Söhne in die Schule zu schicken. Da mein Vater der älteste Sohn war, hatte nur er den Vorzug einer Bildung und Förderung gehabt. Seinen Brüdern blieb dies notgedrungen verwehrt, sie hatten alle mit der Arbeit auf dem Land und auf den Feldern ihr Leben bestreiten müssen.
Früher hatte man seine Schulgebühren nicht mit Bargeld bezahlt, sondern mit Getreide. Jeweils nach den Ferien hatte also mein Vater zwei große Säcke Getreide mit einer Stange auf den Schultern in die Schule tragen müssen, um damit seine Gebühren zu begleichen.
Kaum zu glauben, aber noch ein anderes und besonderes Geheimnis hatte mir meine Großmutter verraten. In der Zeit vor der Bodenreform zu Beginn der fünfziger Jahre, womit die Epoche der feudalistischen Gesellschaft zu Ende ging, hätte der ganze Hof mit der Haupthalle und dem Ost - und Westflügel meinem Großvater allein gehört, geräumig und gemütlich eingerichtet, vor dem Tor zwei kleine Löwen aus Stein als Wächter, außerdem das weite Ackerland direkt hinter dem Hof gelegen. Nach den Bestimmungen der Bodenreform mussten alle reichen Bauern ihr ganzes Vermögen, das ihnen durch »Ausbeutung« zugefallen war, an die armen Bauern zurückgeben. So hatte man entsprechend den Hof meines Großvaters, das heißt den Ost- und Westflügel jeweils zwei armen Bauernfamilien zugewiesen. Nur der Hauptteil des Hofes mit der größeren Halle und mit drei Zimmern im Zentrum war dem Großvater als Eigentum geblieben. Das Ackerland hinter dem Hof hatte man kollektiviert, es gehörte jetzt der Volkskommune. Immer wenn meine Großmutter davon erzählte, dann war sie ins Flüstern geraten, als ob sie fürchtete, hinter der Wand könnten Ohren lauschen. Sie schien sich mit dieser Tatsache noch nicht abgefunden zu haben, denn sie betonte immer wieder nachdrücklich, Hof und Ackerland nicht durch Ausbeutung, sondern durch eigenen Fleiß erworben zu haben.
In der Abenddämmerung waren wir manches Mal aus dem Hof hinausgegangen und hatten die Gelegenheit genutzt, ein wenig Gemüse aus dem Ackerland hinter unserem Hof zu holen, das jetzt ja der Volkskommune gehörte. Meine Großmutter hatte dann für mich Wache gestanden, hatte am Hoftor gelehnt und nach allen Richtungen Ausschau gehalten. Wenn sie niemanden hatte kommen sehen, dann hatte sie mir ein Zeichen gegeben, dann war ich geduckt aufs Feld gelaufen, hatte einige Rüben gezogen oder ein paar Tomaten stibitzt. Meine Großmutter aber blieb stets bei ihrer Überzeugung, dass dies kein Klauen sei, hatte doch das Ackerland früher meinem Großvater gehört. Sie hatte sich im Recht gewusst und es deshalb für legitim erachtet, wenn wir uns vom im Grunde genommen eigenen Ackerland bedienten. Diese Bestimmung galt auch für den eigenen Gemüsegarten, den man ebenfalls nach der Bodenreform nicht mehr privat betreiben konnte, obwohl meine Großmutter eigentlich einen ziemlich großen Garten hatte. Doch jegliche Privatnutzung galt jetzt als unrechtmäßig, nicht einmal ein paar Lauchstangen oder Zwiebeln durfte man selbst anbauen. Meine Großmutter und ich hatten trotzdem ab und zu für Gemüsegerichte der Familie gesorgt, was freilich stets ein Geheimnis zwischen uns beiden geblieben ist.
Während ich noch immer in Erinnerungen und Gedanken verloren vor mich hin träumte, nahm ich plötzlich wahr, dass mein Vater unterdessen sich erhoben hatte und gerade dabei war, meiner Großmutter beim Aufstehen behilflich zu sein. Erleichtert dachte ich, na endlich! Es wird auch höchste Zeit, dass wir nach Hause gehen. Doch statt zur Bushaltestelle lenkte mein Vater seine Schritte in die umgekehrte Richtung, tatsächlich wieder ins Bahnhofsgebäude zurück. Mir gab er nur die unbegreifliche Erklärung, dass Großmutter doch nicht mehr zu uns nach Hause mitkommen könne, sondern spontan wieder zurückfahren müsste. Ich konnte mich nur sehr wundern und fragte mich nach dem Warum. Sie hatte uns doch besuchen wollen und manche Beschwernisse, die mit einer solchen Reise verbunden waren, tapfer auf sich genommen. Und jetzt sollte alles vergebliche Mühe gewesen sein! Die Fahrt zu uns war für sie, eine immerhin ältere Dame, keineswegs ganz einfach, ich hatte selber erlebt, wie umständlich das war und mit welchen Hindernissen verbunden, von ihrem Dorf bis nach Beijing zu kommen. Man musste sich erst von einem Kutscher bis zur fünf Kilometer entfernten Busstation bringen lassen, dann mit einer Leiter in einen offenen Lastkraftwagen klettern, denn dieser war nichts anderes als der damalige Fernbus, und dann noch damit zwei Stunden über eine holprige Landstraße bis zum Bahnhof fahren. Dort hatte man auch nicht sofort eine Zugverbindung, sondern musste sich bis zum andern Tag gedulden. Das bedeutete also in einem kleinen Gasthaus am Bahnhof zu übernachten. Der einzige Zug in die Hauptstadt ging eben erst am nächsten Morgen. Dann wieder acht Stunden Zugfahrt, wirklich eine zeitaufwendige Tour voller Umständlichkeit und Beschwerden!
Warum also jetzt diese übereilte Rückreise, ohne überhaupt wenigstens meine Mutter und meinen Bruder gesehen zu haben? Mein Vater erklärte mir schlicht und resolut, die Oma hätte sich anders entschieden. Meine Oma versuchte mich zu trösten mit der Versicherung, sie werde uns ein anderes Mal besuchen und bald wiederkommen. Und damit überreichte sie mir dann ein großes mit einem Tuch eingeschlagenes Gepäckstück, das alle möglichen Leckerbissen vom Land enthielt: Datteln, Süßkartoffeln und selbstgemachte Kekse. Kaum blieb Zeit für weitere Abschiedsworte, da fuhr auch schon der Zug an unserem Bahnsteig ein. Mein Vater befahl mir noch rasch, auf dem Bahnsteig auf ihn zu warten. Dann begleitete er meine Oma in einen Waggon. Ich sehe sie noch heute mit ihren kleinen gebundenen Füßen schwankend mühsam in den Zug einsteigen, meinen Vater, wie er ihr einen Platz gesucht und ihr Gepäck im Regal verstaut hat. Wahrscheinlich hat er auch noch die Sitznachbarn gebeten, doch vielleicht ein Auge auf die Großmutter zu haben und wenn nötig, ihr zur Hand zu gehen. Dann war das Abfahrtssignal ertönt und mein Vater hatte eiligst den Wagen wieder verlassen. Die Lokomotive begann viel Dampf auszustoßen und drei Mal zu pfeifen, und der Zug rollte allmählich davon. Die Großmutter hatte uns, den auf dem Bahnsteig Zurückgebliebenen, zum Abschied aus dem Fenster zugewinkt. Wir konnten es ihrem Gesichtsausdruck ansehen, dass sie offensichtlich sehr traurig und besorgt sein musste.
Eine Woche nach dieser ungewöhnlichen Abschiedsszene haben wir den dramatischen Auftakt der Kulturrevolution erleben müssen. Sehr bald erfolgte die große Kampagne der Verfolgung und Diffamierung aller Funktionäre, wovon natürlich auch unsere Schule betroffen war. Alle Schulleiter und Lehrkräfte wurden nach und nach aus ihren Ämtern gejagt, zumeist aus fadenscheinigen Gründen. Die Lage war undurchschaubar und chaotisch geworden. Von der fragwürdigen Kritik und jetzt systematisch betriebenen Diffamierung betroffen war auch und vielleicht sogar in vorderster Front mein Vater, dessen Position allein schon die fanatischen Mao-Anhänger provozieren konnte.
Jetzt begann ich langsam zu verstehen, warum mein Vater sich am Bahnhof mit der Großmutter in meiner Gegenwart so rätselhaft verhalten hatte. Er hatte den bevorstehenden Ausbruch der Kulturrevolution bestimmt geahnt und vorausgesehen! Jetzt wurde mir auch langsam klar, warum offenbar mein Vater am Bahnhof die Initiative ergriffen und in dem heimlichen Gespräch mit meiner Großmutter darauf hingewirkt hatte, sie noch an demselben Tag ihrer Ankunft zur unverzüglichen Rückkehr zu bewegen. Zu der Zeit, während meine Großmutter ihren Besuch geplant und vorbereitet hatte, hatte es noch keine Vorzeichen der dramatischen Ereignisse gegeben, die dann bald eintreten sollten. Die Situation hatte sich erst später zugespitzt, war vor kurzem noch keineswegs bedrohlich gewesen. Erst als meine Oma ihre Reise angetreten hatte, war die politische Situation schlagartig kritisch geworden. Mein Vater hatte wahrscheinlich am Tag der Anreise der Großmutter schon zumindest geahnt, dass auch er nicht verschont werden würde. Im Spiegel meiner späteren Erinnerung habe ich die erlebte Bahnhofsszene anders beurteilen gelernt. Die für mich damals rätselhafte und unverständliche Verabschiedung der gerade erst Angekommenen schien nun eine besonnene und vernünftige Entscheidung. Meiner Großmutter, der, wäre sie bei uns in Beijing geblieben, wahrscheinlich auch große Probleme wegen ihres früheren sozialen Status als Grundbesitzerin entstanden wären, sind auf diese Weise bestimmt viele Unannehmlichkeiten erspart geblieben. Auf jeden Fall hat sie unter diesen Umständen nicht Zeuge der schrecklichen Schikanen und entwürdigenden Demütigungen werden müssen, die bald auf meinen Vater zugekommen sind. Die dunklen Rätsel und Geheimnisse der Familienszene am Bahnhof waren wenigstens für mich also noch in ein neues Licht gerückt, wenn auch in ein Licht, das viele dunkle Schatten vorauswarf.
MEIN ERSTER SLOGAN
Im Sommer 1966 verkündete unser Grundschuldirektor auf einer Schulversammlung mit ernster Miene ein brandneues Ereignis: Eine von Mao eigenhändig verfasste Wandzeitung mit dem Titel »Bombardiert die Hauptquartiere« sei veröffentlicht worden. Der Große Vorsitzende habe damit in poetischen Worten an alle appelliert: »Man sollte es endlich wagen, den Kaiser von seinem Ross herunterzuziehen!« Mit diesem Aufruf und mit dem »Kaiser«, so erklärte er uns, habe Mao alle Funktionäre gemeint, alle, die den kapitalistischen Weg eingeschlagen hatten, wie man gemeinhin damals sagte. Diese müsse man jetzt öffentlich kritisieren und entschieden verfolgen. Eingeschlossen in den Kreis dieser Feinde wären alle Revisionisten, Antirevolutionäre und alle Vertreter der Bourgeoisie. Alle, die zur ausbeutenden Klasse gehörten, die müssten jetzt von ihrem hohen Ross geholt und zurückgeschlagen werden.
Unser Grundschulleiter erklärte uns dann die größeren Zusammenhänge dieses neuen Aufrufs. Der Vorsitzende Mao hätte von »vier großen Ideen« gesprochen: vom »Großen Krähen« (gemeint sind agressionsfreudige Reden) von der »Großen Gedankenbefreiung«, der »Großen Diskussion« und der »Großen Wandzeitung«. Und er hätte befohlen, man sollte ein mutiger Vorkämpfer sein, man dürfe künftig »keine Scheu mehr vor dem Himmel, vor der Erde, vor Geistern und vor Teufeln haben.«
Unser Grundschulleiter nahm des weiteren Maos Worte zum Anlass, uns Schüler alle zur tatkräftigen Mitwirkung in diesem jetzt gebotenen Kampf aufzurufen. Wir sollten uns doch die Studenten aus der Pekinger Universität zum Vorbild nehmen. Wie Paris die Welt der Mode anführt, so bildet die Beijing Universität bei jeder politischen Bewegung die Lokomotive. Einige unserer Lehrer waren schon zur Beijing Universität wie nach Mekka oder nach Jerusalem gepilgert und hatten uns enthusiastisch über die dortigen Aktivitäten berichtet. Die Studenten hätten bereits voller Begeisterung damit begonnen, die Ideen des Großen Vorsitzenden Mao in die Praxis umzusetzen und damit eindrucksvoll gezeigt, wie man die rote Fahne Maos hissen muss. Auch wir hätten uns nun um die Interessen der Partei zu kümmern und uns um den Vorsitzenden Mao zu scharen, hätten alle Subversionspläne der Revisionisten, sobald wir davon hörten, aufzudecken und öffentlich bekannt zu machen.
Wir konnten damals Sinn und Bedeutung dieses Aufrufs wohl noch nicht so richtig begreifen, aber wir hatten doch eine Ahnung davon, dass es sich hier um eine sehr wichtige Angelegenheit handeln musste. Unser Grundschulleiter hatte eine gewisse Ratlosigkeit in unseren Gesichtern erkannt und deshalb versucht, uns klar zu machen, was das für uns Schüler konkret zu bedeuten hätte. Er forderte uns auf, dem Aufruf Maos zur Herstellung einer Wandzeitung, die inzwischen schon wie ein politisches Manifest angesehen wurde, Folge zu leisten und jetzt auch »in die Schlacht zu ziehen« und alle Feinde, alle konterrevolutionär gesinnten »Revisionisten«, die man inzwischen meistens metaphorisch »Rinderdämonen« und »Schlangengeister« nannte, tatkräftig »niederzuschlagen«. Erst allmählich dämmerte es mir, was vielleicht damit gemeint sein könnte und was das heißen würde. Was man unter den Konterrevolutionären und Ausbeutenden zu verstehen hätte, das war nicht so schwer zu begreifen. Aber was sollten wir uns unter den »Revisionisten« vorstellen? Wer zählte denn zu dieser Personengruppe? Unser Grundschulleiter versuchte uns auf die Sprünge zu helfen. Darunter wären alle Funktionäre zu verstehen, die sich von den ursprünglichen Zielen von Karl Marx, Friedrich Engels, von Lenin und Stalin abgewandt hätten. Aber nicht nur von ihnen. Hier wären auch diejenigen Funktionäre gemeint, die sich über die Masse der Bevölkerung erhoben hätten. Aber selbst diese Erklärungen konnten uns anfänglich wenig helfen, eine deutlichere Vorstellung, ein klareres Bild von der vielgeschmähten Gruppe der Revisionisten zu gewinnen. Ich glaubte insgeheim, vielleicht würde unser Grundschulleiter ja selber nicht so genau wissen, wer und was hier öffentlich zu kritisieren wäre. Was man unter »Schlangengeistern« und »Rinderdämonen« zu verstehen hatte, das immerhin wusste ich. Waren hiermit doch nach chinesischem Volksglauben böse Geister bezeichnet, die eine menschliche Gestalt annehmen konnten und in aller Regel Unglück brachten. Wir alle waren also jetzt aufgefordert, diese bösen Geister in unseren Mitmenschen zu erkennen und sie zu enttarnen. Auch wir Schüler sollten von allen, die gegen die Diktatur des Proletariats, die gegen Mao und gegen die Partei aufgestanden waren, deutlich Abstand nehmen und sollten solche Mitmenschen als feindliche »Dämonen« entlarven und öffentlich kritisieren.
Nachdem wir diese unsere Mission allmählich zu begreifen gelernt hatten, erfasste uns eine wahre Leidenschaft für diese unsere große Aufgabe. Der Appell unseres Schulleiters bewirkte bald in unserer Einheit einen unglaublichen Aufschwung. Unsere Stimmung, unser aufflammender Enthusiasmus kannte mit der Zeit keine Grenzen mehr. Von einem normalen Unterrichtsalltag konnte fortan keine Rede mehr sein. Wir alle fühlten uns verpflichtet und auch stolz und stark genug, aktiv an der Revolution teilzunehmen und eine wichtige Rolle in der Kulturrevolution zu spielen. Alle wollten nun ihren Mut unter Beweis stellen, einen Tiger zu streicheln und einen Kaiser von seinem Ross zu stürzen (wie man damals bei uns Chinesen zu sagen pflegte). Den Pinsel sollten und wollten wir als Waffe in die Hand nehmen und diese gezielt auf die »Schwarzen Gruppen« (gemeint waren alle oben genannten Feinde und »Bösewichter«) richten. Alle wollten wir nun Vorkämpfer auf dem Weg zur Revolution werden! Aber wir alle machten jetzt auch unsere Augen weit auf und schauten sogar kritisch auf unsere Lehrer und Schulleiter, ob sich vielleicht auch unter ihnen verborgene »Schlangengeister« und »Rinderdämonen« oder andere verdächtige Feinde versteckt hielten, die letztlich auf eine Gelegenheit lauerten, das sozialistische System zu bekämpfen, es zu schwächen oder sogar zu beseitigen. Möglicherweise gab es selbst in unseren eigenen Reihen solche gefährlichen feindlichen Elemente, heimliche Anhänger der Bourgeoisie und maskierte Revisionisten, die uns vom rechten Weg abbringen wollten.
Alle Lehrer und Schüler befanden sich wie in einem Rausch, an einer so großen Aufgabe mitwirken zu können. Jedes gesprochene Wort des Gegenübers wurde nun auf die Goldwaage gelegt. Wir Schüler machten beinahe einen Sport daraus, die Verhaltensweisen aller Lehrer unter die Lupe zu nehmen, besonders natürlich, wenn diese in gehobenen Positionen mit leitenden Funktionen waren. Wir glaubten uns hierzu berechtigt, hatten die Lehrer selbst uns ja dazu angehalten. Und hatten wir doch in allen Klassen buntes Wandzeitungspapier, Pinsel, Tinte und Klebstoff erhalten und waren ermuntert worden, alles Verdächtige aufzuschreiben und gegen alle, die uns verdächtig schienen, mit unserem Schreibzeug zu Felde zu ziehen.