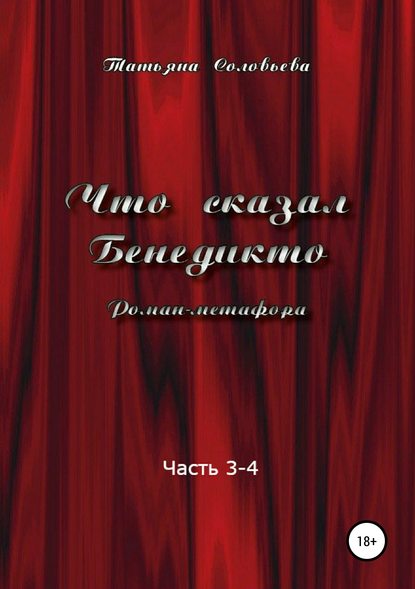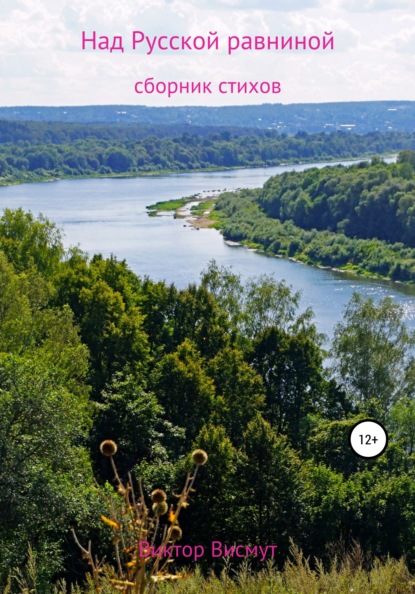Das Genie Wolfgang Amadé Mozart in literarischen Bildern romantischer Tradition der Kunstreligion und Musikästhetik
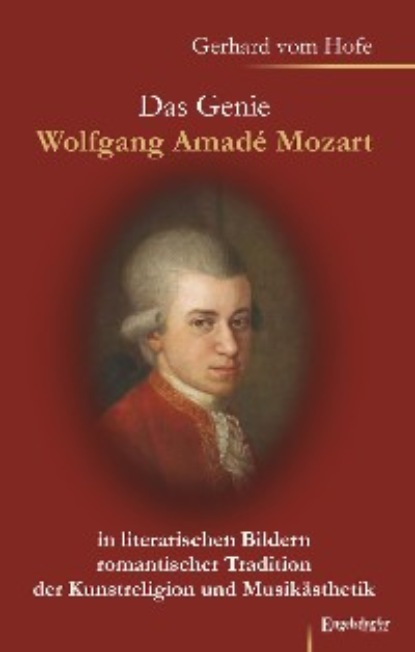
- -
- 100%
- +
Rochlitz reklamiert für Mozart (der Gedanke lag nahe) die Auffassung von der Musik als einer göttlichen, heiligen Kunst mit einer „religiösen Substanz“ im Sinne der Kunstfrömmigkeit der Romantik seiner Zeit, womit dann wiederum eine besondere Wertschätzung seiner Kirchenmusik verbunden ist und im Blick auf die erkannte Raffael-Parallele, speziell auf dessen Transfigurationsbild (seine Verklärung Christi von 1520)25 in Mozarts Komposition des Requiems dessen Vermächtnis und vermeintlich Mozarts höchst vollendetes Werk gesehen wurde.26
Der spekulative Vergleich Mozarts mit Raffael, dem erklärten Kunstgott der Romantik seit Wackenroders Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders und den von Tieck herausgegebenen Phantasien über die Kunst, verfolgt das Ziel, den Menschen Mozart zum vorbildlich idealen und einzigartigen Künstler zu erhöhen, ihn zu genialisieren und den religiösen Gehalt seiner Werke als Emanationen des himmlischen Kunstgeistes zu erklären.27
Der Dichter Franz Grillparzer zitiert in einem 1843 entstandenen Gedicht Zu Mozarts Feier das längst zum Topos gewordene Motiv der Künstlerparallele:
„Mit Raffael, dem Maler der Madonnen, steht er
Klassische und romantische Vorstellungen erscheinen bei der Berufung Raffaels als des neuzeitlichen Realisators des klassisch-antiken Schönheitsideals par excellence vermittelt. An das Raffael-Bild Winckelmanns29 erinnern die ästhetischen Prinzipien des Klassizismus30, die beispielsweise die Schlussstrophe eines Huldigungsgedichts mit dem Titel An Mozart des Königs Ludwig I. von Bayern von 1856 metaphorisch zur Sprache bringt, wenn er Mozart poetisch feiert als die Sonne, „welche ewig glüht“:
„Vermählet ist in deinen Tönen
Die Melodie mit Harmonie.
Es lebt das Ideal des Schönen
Im Zauber deiner Phantasie.“31
*****
Es scheint unverzichtbar, noch eine weitere Mozart-Publikation von Friedrich Rochlitz zu erwähnen, weil diese nicht weniger gravierende Folgen für das bis ins 20. Jahrhundert kanonisch gebliebene Mozart-Bild hatte. Es handelt sich hierbei (wie man heute weiß) um eine vorsätzliche Geschichtsklitterung: das 1815 veröffentlichte Schreiben Mozarts an den Baron von ...32, eine scheinbar authentische Antwort auf die Frage nach dem Schaffensvorgang des Komponisten. Hier sollte der Mythos vom leichthin im Kopf komponierenden Mozart, der experimentell nicht einmal auf das Klavier angewiesen schien, seine angeblich vom Komponisten selbst autorisierte Begründung finden. Diese eigentümliche und einzigartig geniale Kompositionsweise Mozarts, die vermeintlich nur noch eines mechanischen Schreibakts bedarf, wurde immer wieder als besondere Auszeichnung des göttlichen Musensohns hervorgehoben.
Goethe, ein großer Bewunderer Mozarts33, aber auch andere Prominente haben an diese Art göttlicher Inspiration Mozarts bereitwillig geglaubt. Und selbst wenn es so gewesen wäre und der Komponist nach dem Empfang seiner Eingebungen naturgemäß nur noch, wie mutmaßlich Thomas Bernhard (der Schluss von dessen Roman Das Kalkwerk kommt einem unwillkürlich in den Sinn34) gesagt hätte, „seinen Kopf urplötzlich von einem Augenblick auf den anderen (...) auf das Papier“ hätte „kippen“ müssen; selbst dann bliebe noch allein die mechanische Arbeit der Niederschrift von insgesamt 23.000 Seiten Noten nach Zählung der Neuen Mozart-Werkausgabe, und dies in einem Zeitraum von noch nicht einmal siebenunddreißig Lebensjahren (abzüglich der frühen Kindheitszeit) als eine beinahe unglaublich zeitaufwändige Fleißarbeit maßlos zu bestaunen.
Ulrich Konrads Habilitationsschrift über die Schaffensweise, über Skizzen und Notizhefte Mozarts hat diesen durch Rochlitz in die Welt gesetzten Mythos der Produktionsweise, dem die Familie Mozart selber durch briefliche Äußerungen Vorschub geleistet hatte, zuletzt entscheidend korrigiert und wenigstens tendenziell in den Bereich der Legenden verwiesen.35
Generell wird man Rochlitz vorhalten müssen, dass er im Interesse seiner apologetischen Absichten unhistorisch und fabulierend verfährt und mit seiner Idealisierung Mozarts der künftigen Verklärung gewollt oder ungewollt Vorschub geleistet hat. Sein Mozart-Bild spiegelt letztlich seine eigene Weltsicht und die Kunst- und Genieauffassung seiner Zeit, der Romantik, wider, klärt aber nicht die wahren Lebens- und Schaffensumstände Mozarts, versucht nicht die wahren Sachverhalte aufzuklären und die überlieferten Selbstzeugnisse und Dokumente zu befragen und dadurch eine Antwort zu finden auf die Frage, wie es eigentlich gewesen ist. Und dies lässt sich verallgemeinernd wohl von den meisten Mozart-Bildern des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts behaupten: Sie bringen eher die subjektiven Anschauungen der Interpreten zum Ausdruck und verraten oft die Tendenz der Vereinnahmung dessen, den sie ins Bild zu setzen versuchen.
Natürlich präfiguriert Rochlitz auch die Stilisierung Mozarts auf die apollinische Künstlerfigur, die dann in Mörikes berühmter Novelle von 1856, wenn hier auch ins Spielerisch- Selbstironische zurückgenommen und mit Vorbehalten versehen, noch einmal als zentrales Motiv angeschlagen wird.
Dies literarisch wirkungsmächtige Legendenmotiv geht schon bei den Zeitgenossen Mozarts eine harmonische Verbindung mit dem Topos des göttlichen Wunderkindes ein. Dafür boten sich genügend Anknüpfungspunkte in den Lebenszeugnissen, vor allem in den Briefen des Vaters und anderer Zeitgenossen. Allerdings fällt auf, dass Leopold Mozart die schon frühzeitig bemerkte außerordentliche Begabung seines „Wolferl“ wohl als ein Wunder begreift, es aber doch eher konventionell als ein Geschenk Gottes deutet und sein Erstaunen darüber im Zusammenhang mit seinem katholischen Weltbild „gläubig“ rationalisiert.
Beispielsweise ist vom sechs- und siebenjährigen Wunderknaben und der Wunderwirkung seines Klavier- oder Orgelspiels in den Briefen von der ersten großen Reise nach Wien 1762/63 des Öfteren die Rede: So berichtet der Vater seinem Freund Lorenz Hagenauer in Salzburg: „Hauptsächlich erstaunet alles ob dem Bueben, und ich habe noch niemand gehört, der nicht sagt, daß es unbegreiflich seye.“36 Sogleich nach ihrer Ankunft in Wien (so schreibt Leopold Mozart) habe er Befehl erhalten, an den Kaiserhof zu kommen. Der Ruf des Wunderknaben sei ihnen vorausgeeilt. Aus Wasserburg, wo Leopold seinem Sohn das Pedal der Orgel erklärt, habe Wolfgang dann „stante pede die Probe abgeleget, (...) stehend preambulirt und das pedal dazu getreten, (...) als wenn er schon viele Monate geübt hätte. alles gerüeth in Erstaunen und ist eine neue Gnad Gottes, die mancher nach vieler Mühe erst erhält.“37
Aus Paris im Februar 1764 erfährt Frau Hagenauer vom Vater Mozarts:
„stellen sie sich den Lermen für, den diese Sonaten (gemeint sind vier Klaviersonaten, die der Knabe gerade komponiert hat; d.Vf.) in der Welt machen werden, wann am Titlblat (sic!) stehet, daß es ein Werk eines Kindes von 7 Jahren ist (...).“ Ich „kann Ihnen sagen (...), daß Gott täglich neue Wunder an diesem Kinde wirket“.38
Und dann folgt eine für den Vater Leopold typische Bemerkung, die seine pädagogische Strategie verrät, die er mit den für ein Kind schließlich höchst anstrengenden, eigentlich unzumutbaren Reisen verfolgt:
„bis wir: wenn Gott will: nach Hause kommen, ist er (d.h. Wolfgang; d.Vf.) im Stande Hofdienste zu verrichten. Er accompagniert wirk: allerzeit bey öffent: Concerten. Er transponirt so gar à prima vista die Arien beym accompagniren; und aller Orten legt man ihm bald Ital: bald französ: Stücke vor, die er vom blatt=weg (sic!) spielet.“39
Aus London 1764 berichtet Leopold, Wolfgang habe dem König Stücke von Bach, Abel und Händel vom Blatt „weggespielt“, er habe die Königin bei einer Arie begleitet und über einem Bass die schönste Melodie gespielt, „so, daß alles in das äusserste Erstaunen gerieth.“
Was Wolfgang jetzt könne, das übersteige alle Einbildungskraft.40 Und eine letzte Briefstelle sei angeführt. Aus München im November 1766 rechtfertigt Leopold wieder einmal seine Erziehungsmethode gegenüber Lorenz Hagenauer:
„Gott (...) hat meinen Kindern (die Tochter Nannerl also eingeschlossen; d.Vf.) solche Talente gegeben, die, ohne an die Schuldigkeit eines Vatters zu gedenken, mich reitzen würde, alles der guten Erziehung derselben aufzuopfern. jeder Augenblick, den ich verliehre, ist auf ewig verlohren. und wenn ich jemahls gewust habe, wie kostbar die Zeit für die Jugend ist, so weis ich es itzt. Sie wissen daß meine Kinder zur arbeit gewohnt sind: (...) sie wissen auch selbst wie viel meine Kinder, sonderlich der Wolfgangerl zu lernen hat.“41
Hier spricht der christlich denkende Aufklärer, dem bewusst ist, dass es mit dem Genie des Wunderknaben allein nicht getan ist. Und Leopold Mozart leitet aus dem ihm und der Welt von Gott gesandten Wunder die geradezu missionarische Verpflichtung ab, das ihm mit Wolfgang anvertraute Gottesgeschenk zu hüten, es durch sorgsame Belehrung in seiner Entwicklung zu fördern – und es der Welt zu demonstrieren. Hier verrät sich ein christlich religiöses Motiv für die großen strapaziösen Reisen durch Europa, das sich übrigens für den Vater mit dem profanen Aspekt des Ruhm- und Gelderwerbs, einer ganz praktisch und ökonomisch motivierten Bildungsreise zum Zwecke der „Vermarktung“ des Wunderknaben mühelos zu verbinden schien.42 Ein Brief aus Rom vom April 1770, ein Zeugnis der ersten Italienreise, die nicht mehr nur privat arrangierte Konzerte zumeist in Adelshäusern anstrebte, sondern bewusst mit dem Versuch unternommen wurde, für Mozart einen Produktionsvertrag für die italienische Oper abzuschließen, bringt unmissverständlich zum Ausdruck, dass nunmehr Wolfgangs mit Fleiß erworbenes handwerkliches Können und sein ungemein rasches Fortschreiten in der „Compositionswissenschaft“ der Hauptgrund für die allerorts spürbare Bewunderung ist (und der Ruf des Wunderkindes allein nicht mehr zieht): „ie tiefer wir in Italien kamen, ie mehr wuchs die verwunderung. der Wolfg. bleibt mit seiner Wissenschaft auch nicht stehen, sondern wächst von tage zu tage, so, daß die grösten kenner und Meister nicht worte genug finden ihre Bewunderung auszudrücken (...).“ 43
Schon während der großen Westeuropa-Reise der Jahre 1763 bis 1765, stärker ausgeprägt freilich dann später in den Jahren der Italienreisen 1771-1773 und in denen der „Orientierung“ 1777 – 178144, hier besonders in der Mannheimer und Pariser Zeit, tritt Mozarts musikalische Welterkundung, das forcierte Lernen und Arbeiten, das Sich-Vertraut machen mit den verschiedenen zeitgemäßen Stilrichtungen der Musik in den europäischen Zentren in den Vordergrund und gewinnt als das heimliche pädagogische Konzept Leopolds und als Hauptzweck der Reisen immer mehr an Bedeutung. Die Erinnerungen an die ersten Auftritte des Wunderkinds in der Fremde verblassen mehr und mehr. Bald bricht die Zeit der professionellen Bewährung des außerordentlichen Talents an. Der junge Komponist wird zunehmend selbstbewusster. Er weiß sich zum „Kapellmeister“ geboren, und er thematisiert in seinem Brief vom 11. September 1778 aus Paris an seinen Vater sein Selbstbewusstsein als ein „Mensch von superieuren Talent“, „welches ich mir selbst, ohne gottlos zu seyn, nicht absprechen kan.“45
Und in demselben Brief heißt es weiter:
„ich darf und kann mein Talent im Componiren, welches mir der gütige Gott so reichlich gegeben hat, / ich darf ohne hochmuth so sagen / denn ich fühle es nun mehr als jemals nicht so vergraben.“46
Wie der Vater beruft auch der Sohn das biblische Gleichnis vom Talentwucher und leitet daraus die religiöse Selbstverpflichtung ab, seine göttliche Berufung zum Komponisten als seine Lebensbestimmung zu verwirklichen. Das Klavier sei eigentlich nur seine „sehr starcke nebensach“, das Komponieren sei dagegen seine „einzige freüde und Paßion“.47
Die Tätigkeit des Unterrichtens, worauf Mozart noch während seiner Wiener Jahre ohne eine höfische Position angewiesen war, galt ihm eher als eine Last und ein „notwendiges Übel“.48 Den zuletzt zitierten Briefzeugnissen, die Mozarts Selbsteinschätzung seiner ungewöhnlichen Gaben demonstrieren, möchte ich wenigstens eine historisch verbürgte Äußerung über das Wunderkind Mozart zur Seite stellen, die nicht nur die andere Optik der zeitgenössischen Öffentlichkeit repräsentiert, sondern die auch deshalb besonders interessant ist, weil sie das Urteil eines eher skeptischen Aufklärers darstellt. Ein Freund Diderots, der Diplomat und Schriftsteller Baron Melchior von Grimm, übrigens ein wichtiger Mittelsmann der Mozarts in Paris, verbindet mit seinem Ausdruck der irritierten, aber grenzenlosen Bewunderung zugleich den vielleicht für die Zeit charakteristischen Versuch einer rationalen Klärung der Wirkung eines für ihn sprichwörtlich unbegreiflichen Wunders.
Grimm schreibt in seiner Kritischen Korrespondenz am 1.12.1763:
„Wahre Wunder sind so selten, daß man davon spricht, wenn man einmal eins erlebt. Ein Kapellmeister aus Salzburg mit Namen Mozart ist hier (i.e. in Paris; d.Vf.) kürzlich mit zwei Kindern von allerliebstem Anblick eingetroffen. Seine Tochter spielt hinreißend Klavier; (...) ihr Bruder, der im nächsten Februar sieben Jahr alt wird, ist ein so ungewöhnliches Wunderkind, daß man kaum glauben kann, was man mit seinen Augen sieht und mit seinen Ohren hört.“ (...)
„geradezu unglaublich ist es, ihn eine Stunde lang aus dem Kopfe spielen und sich der Eingebung seines Genies und einer Menge entzückender Einfälle überlassen zu sehen, die er zudem geschmackvoll und geordnet folgen zu lassen weiß.“ (...) „Mühelos liest er alle Noten, die man ihm vorlegt; er komponiert mit wunderbarer Leichtigkeit, ohne zum Klavier zu gehen und seine Akkorde suchen zu müssen.“ (...)
„Dieses Kind wird mich bestimmt noch närrisch machen, wenn ich es öfters höre; es zeigt mir, wie schwer es ist, sich vor Tollheit zu hüten, wenn man Wunder erlebt. Daß der heilige Paulus nach seiner seltsamen Vision den Kopf verlor, setzt mich nicht mehr in Erstaunen.“49
Überschaut man die angeführten lebensgeschichtlichen und historisch-authentischen Briefzeugnisse hinsichtlich ihrer Rede vom Wunderkind Mozart, so fällt auf, dass sie mit ihren Versuchen einer rationalen Klärung der Wirkung des Wunderbaren durchaus eine metaphysische Erklärung in Betracht ziehen. Was den phänomenalen Effekt der öffentlichen Auftritte des jungen Mozart angeht, die dadurch ausgelöste Bewunderung, ja Irritation, so hätte der zuvor schon einmal zitierte Thomas Bernhard hier vielleicht (wie in seinem Roman Der Untergeher im Hinblick auf den phänomenalen Pianisten Glenn Gould) überspitzt von einer (freilich bei Mozart nicht bloß) „klavieristischen Weltverblüffung“ gesprochen.50
Aber von einer romantischen Interpretation, die auf eine Verherrlichung und Verklärung des göttlichen Genies Mozarts und seiner apollinischen Erscheinung im Lichte Raffaels und einer durch ihn historisch vorbereiteten Kunstreligion abzielt, kann weder in den historischen Zeugnissen der Selbstdeutung noch in den zeitgenössischen Dokumenten des 18. Jahrhunderts schon die Rede sein. Auch von einer klassischen Idealisierung des begnadeten Subjekts und von einer Mythisierung des großen Komponisten Mozart sehen die gerade angeführten Dokumente (noch) ab. Das unterscheidet gerade deren Profil von den erst nach Mozarts Tod proklamierten Anschauungen, die im Wesentlichen unter der Voraussetzung romantischer Ideen und eines säkularen kunstfrommen Denkens entstanden sind und die frühe Rezeptionsphase Mozarts mit ihrer Favorisierung der Vokal- und Kirchenmusik geprägt haben. Erst dieser hauptsächlich durch Rochlitz und die Romantik begründeten Tradition einer Sakralisierung der Kunst (die maßgeblich auf Wackenroder und Tiecks Publikationen sowie publikumswirksam dann auf E.T.A. Hoffmann zurückgehen) verdanken sich die ästhetisch wie psychologisch folgenreichen Tendenzen des Mozart-Bildes, welche noch heute ihre Wirkung zeigen. Darüber hinaus wird die hauptsächlich durch E. T. A. Hoffmann richtungweisende Bestimmung und fortwährende Wirkung der romantischen Musikästhetik künftig die Mozart-Darstellungen maßgeblich beeinflussen. In Mörikes Mozarts Bild leuchtet paradigmatisch noch eine Kombination beider Traditionen auf: die einer eher klassischen und spielerischen Wiederaufnahme des mythologisch begründeten apollinischen Genies – und die des Fortlebens einer Tradition typisch romantischer Musikästhetik.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.